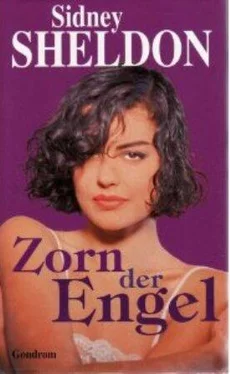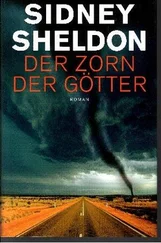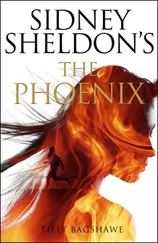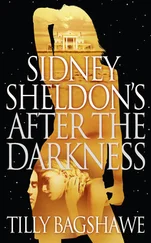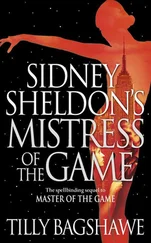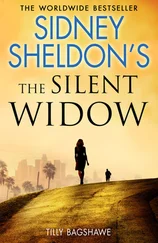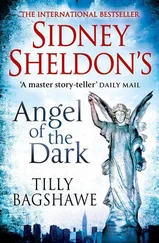Patterson führte Jennifer einen langen Korridor hinunter an eine verschlossene Tür. Er öffnete die Tür mit einem Schlüssel aus einem großen Bund und schaltete das Licht an. Jennifer betrat einen kleinen, kahlen Raum mit eingebauten Regalen. »Hier bewahren wir die Bonbondose der Gefangenen auf.« Er ging zu einem großen Kasten und öffnete den Deckel.
Ungläubig starrte Jennifer in den Kasten. Dann blickte sie Howard Patterson an und sagte: »Ich möchte noch einmal mit meinem Mandanten sprechen.«
Jennifer bereitete sich auf Abraham Wilsons Verhandlung vor, wie sie sich noch nie im Leben auf etwas vorbereitet hatte. Sie verbrachte endlose Stunden über Gesetzbüchern, informierte sich über Verfahrensweisen und Verteidigungsstrategien. In langen Sitzungen versuchte sie, ihrem Mandanten näherzukommen und alle Informationen zu sammeln, die sie kriegen konnte. Es war kein leichtes Unterfangen. Wilson war von Anfang an gehässig und sarkastisch. »Woll'n Se was von mir wiss'n, Schätzchen? Mit zehn hab' ich zum erst'nmal gefickt. Wie alt war'n Sie?« Jennifer zwang sich, seinen Haß und seine Verachtung zu ignorieren, denn sie merkte, daß sich dahinter tiefe Furcht verbarg. Und so ließ Jennifer nicht locker. Sie wollte wissen, wie Wilsons Kindheit gewesen war, sie fragte ihn nach seinen Eltern und den Erfahrungen, die aus dem Jungen einen Mann geformt hatten. Im Verlauf einiger Wochen wurde aus Wilsons Widerstand Interesse, und das Interesse wich Faszination. Noch nie in seinem Leben hatte er einen Anlaß gehabt, über sich selber nachzudenken - was für ein Mensch er war und warum.
Jennifers bohrende Fragen erweckten Erinnerungen, einige davon nur unangenehm, andere unerträglich schmerzhaft. Während der Sitzungen, in denen Jennifer Wilson über seinen Vater ausfragte, der ihn regelmäßig brutal verprügelt hatte, konnte es passieren, daß Wilson ihr befahl, ihn allein zu lassen. Dann stand sie auf und ging, aber sie kehrte immer wieder zurück.
Vorher hatte Jennifer schon wenig Privatleben gehabt, nun hatte sie gar keines mehr. Wenn sie nicht bei Abraham Wilson war, hielt sie sich im Büro auf, sieben Tage in der Woche, vom frühen Morgen bis weit nach Mitternacht, und studierte alles, was sie über Mord und vorsätzlichen oder unbeabsichtigten Totschlag finden konnte. Nachdem sie Hunderte von Gerichtsentscheidungen, Präzedenzfällen und Verhandlungsprotokollen analysiert hatte, beschäftigte sie sich in erster Linie damit, wie man die Anklage in Totschlag umändern konnte.
Abraham hatte den Mann nicht vorsätzlich getötet. Aber würde eine Jury das glauben? Vor allem Geschworene aus der Umgebung? Die Nachbarn von Sing Sing haßten die Sträflinge in ihrer Mitte. Jennifer setzte sich für eine Verlegung des Gerichtsortes ein, und die wurde gewährt. Der Prozeß würde in Manhattan stattfinden.
Dann mußte sie eine wichtige Entscheidung treffen: sollte sie Abraham Wilson in den Zeugenstand rufen? Er erweckte einen durch und durch negativen Eindruck, aber wenn die Geschworenen die Geschichte aus seinem eigenen Mund hörten, konnte sie das vielleicht für ihn einnehmen. Das Problem bestand darin, daß sie damit der Anklage die Möglichkeit gab, Wilsons Vergangenheit und die Liste seiner Straftaten aufzurollen, darunter den Mord, für den er bereits verurteilt war. Sie fragte sich, welchen seiner Assistenten Di Silva gegen sie ins Feld schicken würde. Er verfügte über ein halbes Dutzend qualifizierter Männer, die Mordanklagen vertraten, und Jennifer machte sich mit ihren Techniken vertraut. Sie verbrachte soviel Zeit wie möglich in Sing Sing, besichtigte den Schauplatz des Mordes, sprach mit Abraham, den Wärtern und interviewte Dutzende von Häftlingen, die Thorpes Tod miterlebt hatten.
»Raymond Thorpe hat Abraham Wilson mit einem Messer angegriffen«, sagte Jennifer. »Einem großen Fleischermesser. Sie müssen es doch bemerkt haben.«
»Ich? Ich habe kein Messer gesehen.«
»Sie müssen. Sie standen direkt daneben.«
»Lady, ich hab' wirklich nichts gesehen.« Niemand wollte in die Geschichte verwickelt werden.
Manchmal nahm Jennifer sich die Zeit für eine richtige Mahlzeit, aber meistens schlang sie hastig ein Sandwich am Imbißstand des Gerichtsgebäudes herunter. Sie begann, Gewicht zu verlieren und unter Schwindelanfällen zu leiden. Ken Bailey machte sich Sorgen. Er führte sie zu ›Forlini's‹ gegenüber dem Gericht und bestellte eine ausgiebige Mahlzeit für sie. »Beabsichtigst du, dich umzubringen?«
»Natürlich nicht.«
»Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut?«
»Nein.«
Er betrachtete sie und sagte: »Wenn du einen Funken Verstand hast, läßt du die Finger von dem Fall.«
»Warum?«
»Weil du die reinste Tontaube sein wirst. Jennifer, ich höre doch, was auf der Straße gesprochen wird. Die Presse macht sich schon in die Hose, so wild ist sie darauf, sich wieder auf dich einzuschießen.«
»Ich bin Rechtsanwältin«, sagte Jennifer störrisch. »Abraham Wilson hat ein Recht auf einen fairen Prozeß, und ich werde mich darum kümmern, daß er einen bekommt.« Sie bemerkte den besorgten Ausdruck in Ken Baileys Gesicht. »Keine Sorge, soviel Aufmerksamkeit wird der Prozeß auch wieder nicht bekommen.«
»Ach nein? Weißt du, wer die Anklage vertreten wird?«
»Nein.«
»Robert Di Silva.«
Jennifer betrat das Gerichtsgebäude am Eingang Leonard Street und bahnte sich ihren Weg durch die Menschen, die sich durch die Wandelhalle wälzten, vorbei an uniformierten Polizisten, wie Hippies gekleideten Kriminalbeamten und Anwälten mit Aktentaschen. Sie ging auf den großen, kreisförmig angelegten Informationstisch zu und nahm dann den Aufzug in den sechsten Stock. Ihr Ziel war das Büro des Staatsanwalts. Seit ihrem letzten Zusammentreffen mit Robert Di Silva war beinahe ein Jahr vergangen, und Jennifer freute sich nicht gerade auf das Wiedersehen. Sie beabsichtigte, ihn darüber zu informieren, daß sie Abraham Wilsons Verteidigung niederlegte.
Es hatte Jennifer drei schlaflose Nächte gekostet, eine Entscheidung zu treffen. Den endgültigen Ausschlag hatte die Überlegung gegeben, daß in erster Linie die Interessen ihres Klienten berücksichtigt werden mußten. Normalerweise wäre der Fall Wilson nicht wichtig genug gewesen, daß Di Silva sich selber darum kümmerte. Der einzige Grund für die Aufmerksamkeit des Staatsanwalts lag daher in Jennifers Erscheinen vor Gericht. Di Silva wollte Rache. Er wollte ihr eine Lehre erteilen. Und so blieb ihr keine andere Wahl, als sich von Wilsons Verteidigung zurückzuziehen. Sie konnte nicht zulassen, daß er hingerichtet wurde, nur weil sie einmal einen Fehler begangen hatte. Wenn sie nicht mehr mit dem Fall zu tun hatte, würde Robert Di Silva vielleicht nachsichtiger mit Wilson umgehen. Sie war hier, um Abraham Wilsons Leben zu retten.
Es war ein seltsames Gefühl, die Vergangenheit noch einmal zu durchleben, als sie im sechsten Stock ausstieg und auf die Tür mit dem Schild Staatsanwalt, Staat von New York zuging. Dahinter saß dieselbe Sekretärin am selben Tisch wie damals. »Ich bin Jennifer Parker. Ich habe eine Verabredung mit...«
»Sie können gleich hineingehen«, sagte die Sekretärin. »Der Staatsanwalt erwartet Sie.«
Robert Di Silva stand hinter seinem Schreibtisch, kaute auf einer nassen Zigarre herum und gab zwei Assistenten Instruktionen. Er verstummte, als Jennifer eintrat. »Ich hätte gewettet, Sie würden nicht kommen.«
»Ich bin da.«
»Ich dachte, Sie hätten den Schwanz eingezogen und längst die Stadt verlassen. Was wollen Sie?«
Vor seinem Schreibtisch standen zwei Stühle, aber er forderte Jennifer nicht auf, Platz zu nehmen.
»Ich bin hier, um mit Ihnen über meinen Mandanten zu sprechen, Abraham Wilson.«
Robert Di Silva setzte sich, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und gab vor, nachzudenken. »Abraham Wilson... ach ja. Das ist der Killernigger, der einen Mann im Gefängnis zu Tode geprügelt hat. Es sollte Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten, ihn zu verteidigen.« Er warf seinen beiden Assistenten einen Blick zu, und sie verließen den Raum. »Nun, Frau Kollegin?«
Читать дальше