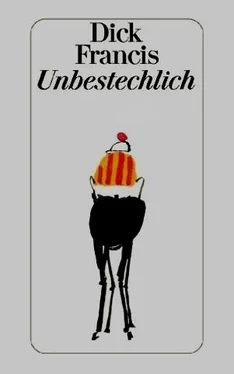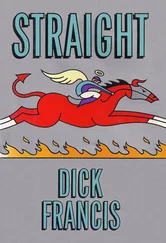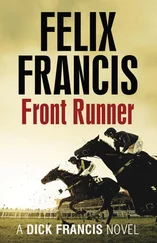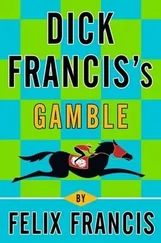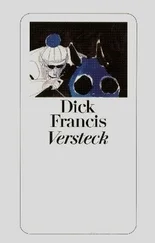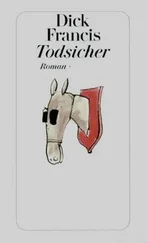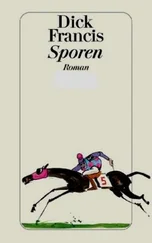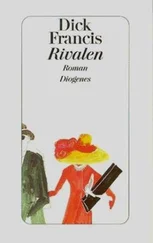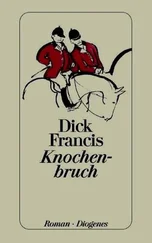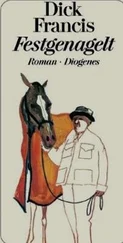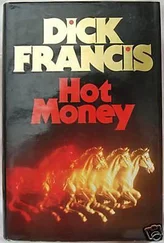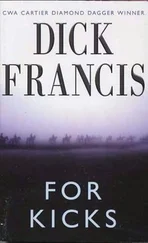Dick Francis
Unbestechlich
Ich habe das Leben meines Bruders geerbt. Habe seinen Schreibtisch, sein Geschäft, sein technisches Spielzeug, seine Feinde, seine Pferde und seine Geliebte geerbt. Ich habe das Leben meines Bruders geerbt und dabei fast das meine verloren.
Derek Franklin, Steeplechase-Jockey, hat genug eigene Probleme. Mit vierunddreißig nähert er sich allmählich dem Ende seiner Karriere, und einer Meinungsverschiedenheit mit dem letzten Hindernis in Cheltenham hat er es zu verdanken, daß er jetzt mit einem gebrochenen Knöchel an Krücken herumhumpelt. Der Tod seines geliebten Bruders Greville stürzt ihn jedoch noch in viel größere Schwierigkeiten.
In einen Strudel ebenso unerklärlicher wie mörderischer Gefahren geschleudert, muß er erkennen, daß Ehrlichkeit eine tödliche Tugend sein kann und daß sein Mut das Böse, das um ihn herum eskaliert, nur noch mehr herausfordert. Seine einzige Überlebenschance besteht darin, die geheimnisvollen Feinde seines Bruders zu identifizieren. Aber Greville, dessen Leben anscheinend so viele Facetten besaß wie die Edelsteine, die er importierte, hat ihm keinerlei Anhaltspunkte hinterlassen.
«Inzwischen gehört der Engländer Dick Francis zu den Eliteschreibern des Genre. Unbestechlich gehört zu seinen besten Romanen.«
Die Weltwoche, Zürich
«Nach 27 erfolgreichen Thriller-Romanen aus dem Turfmilieu gelingt es Routinier Dick Francis auch beim 28. Mal, von der ersten Zeile an Erwartungen zu wecken und Spannungen aufzubauen.«
Pferdespiegel, Winterthur
«Auch in diesem Roman verfügt der Brite Francis über jenen lakonischen Tonfall des Understatements der alle seine Romane auszeichnet und denen der besten >hartgesottenen< Amerikaner ähnlich macht.«
Dick Francis, geboren 1920, war viele Jahre Englands erfolgreichster Jockey, bis ein mysteriöser Sturz 1956 seine Karriere beendete. Seit 35 Jahren schreibt er jedes Jahr einen Roman. Dick Francis wurde unter anderem dreifach mit dem Edgar Allan Poe Award und dem Grand Master Award ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau auf den Cayman-Inseln.
Ich habe das Leben meines Bruders geerbt. Habe seinen Schreibtisch, seine Firma, sein technisches Spielzeug, seine Feinde, seine Pferde und seine Geliebte geerbt. Ich habe das Leben meines Bruders geerbt und dabei fast das meine verloren.
Ich war damals 34 Jahre alt, und eine Meinungsverschiedenheit mit dem letzten Hindernis des Rennens in Cheltenham hatte zur Folge, daß ich an Krücken herumhumpelte. Sollten Sie noch nicht erlebt haben, wie es ist, wenn Ihr Fußgelenk zerschmettert wird, dann haben Sie nichts versäumt. Wie immer war es nicht der Sturz bei voller Geschwindigkeit gewesen, der den Schaden verursacht hatte, sondern die halbe Tonne von Rennpferd, das hinter mir über das Hindernis setzte. Es sprang mit einem seiner Vorderhufe direkt auf meinen Stiefel, und der Arzt, der mir diesen dann vom Bein schnitt, überreichte ihn mir als Andenken. Mediziner haben nun mal einen makabren Sinn für Humor.
Zwei Tage nach diesem Vorfall, als ich mich allmählich mit der Tatsache abzufinden begann, daß ich zumindest sechs Wochen der Rennsaison und damit wahrscheinlich auch meine letzte Chance verpassen würde, noch einmal zu Meisterehren zu kommen (mit Mitte dreißig erreichen Steeplechase-Jockeys den Anfang vom Ende ihrer sportlichen Laufbahn), nahm ich so ungefähr zum zehnten Mal an diesem Morgen den Telefonhörer ab — diesmal jedoch,
um festzustellen, daß nicht noch ein weiterer Freund mich seines Mitgefühls versichern wollte.
«Könnte ich bitte mit Derek Franklin sprechen?«fragte eine weibliche Stimme.
«Ich bin Derek Franklin«, sagte ich.
«Gut. «Die Stimme klang sowohl energisch als auch zögernd, und das war durchaus verständlich.»Wir haben Sie als den nächsten Angehörigen Ihres Bruders aufgeführt gefunden.«
Der Ausdruck» nächster Angehöriger «mußte zu den unheilvollsten gehören, die es gab, dachte ich mit schneller schlagendem Herzen.
Ich fragte langsam, ohne eigentlich die Antwort hören zu wollen:»Was ist geschehen?«
«Ich rufe vom St. Catherine’s Hospital in Ipswich an. Ihr Bruder liegt hier auf der Intensivstation…«
Wenigstens lebt er, dachte ich benommen.
«… und die Ärzte sind der Ansicht, daß Sie davon in Kenntnis gesetzt werden sollten.«
«Wie geht es ihm?«
«Es tut mir leid, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin hier am Krankenhaus als Sozialarbeiterin tätig. Soweit ich aber weiß, ist sein Zustand sehr ernst.«
«Was ist mit ihm?«
«Er hatte einen Unfall«, sagte sie.»Er ist schwer verletzt und hängt am Tropf.«
«Ich komme«, sagte ich.
«Ja, das wäre wohl das beste.«
Ich dankte ihr, ohne eigentlich so recht zu wissen wofür, und legte auf, wobei erst jetzt der Schock physisch spürbar wurde — ich fühlte mich benommen, und meine Kehle war wie zugeschnürt.
Er würde schon wieder auf die Beine kommen, sagte ich mir. Intensivstation — das bedeutete doch nur, daß man sich wirklich intensiv um ihn bemühte. Er würde sich bald wieder erholen, gar keine Frage.
Ich verdrängte alle Befürchtungen und wandte mich statt dessen dem praktischen Problem zu, wie ich mit einem kaputten Fußgelenk etwa 150 Meilen über Land von Hungerford in Berkshire, wo ich wohnte, nach Ipswich in Suffolk gelangen sollte. Zum Glück handelte es sich um den linken Fuß, was bedeutete, daß ich sehr bald wieder in der Lage sein würde, mein Auto zu benutzen, das ein automatisches Getriebe hatte — im Augenblick jedoch verursachte mir mein Fuß noch heftige Beschwerden. Trotz aller Tabletten und Eisbeutel war er heiß und geschwollen und schmerzte stark. Ich konnte das Gelenk nicht bewegen, ohne daß mir der Atem stockte, und das war teilweise meine eigene Schuld.
Da mir die schädigende Unbeweglichkeit von Gipsverbänden schon immer verhaßt gewesen war, ich diesbezüglich fast so etwas wie eine Phobie hatte, war ich ein gut Teil des vorangegangenen Tages damit beschäftigt gewesen, einen leidgeprüften Orthopäden dazu zu überreden, meinem Knöchel die Stütze einer schlichten elastischen Binde angedeihen zu lassen, statt ihn in Gips einzusperren. Mein Orthopäde gehörte zu jenen Chirurgen, die Platten und Schrauben bevorzugen, weshalb er wie gewohnt mit Murren auf mein Ansinnen reagierte. Eine Bandage, wie ich sie haben wolle, möge zwar im Endeffekt besser für die Muskulatur sein, biete aber keinerlei Schutz vor Stößen, wie er mir schon bei anderen Gelegenheiten klarzumachen versucht habe, und würde mir lediglich mehr Schmerzen eintragen.
«Mit so einem Verband kann ich aber sehr viel schneller wieder Rennen reiten.«
«Es wäre an der Zeit, daß Sie damit aufhören, sich die Knochen zu brechen«, sagte er, gab aber achselzuckend und seufzend nach und legte mir eine sehr eng gewickelte Bandage an.»Eines Tages werden Sie sich noch mal was Ernsthaftes antun.«
«Eigentlich breche ich sie mir gar nicht so gerne.«
«Immerhin brauchte ich diesmal nichts zu klammern«, sagte er.»Aber Sie sind verrückt.«
«Ja, herzlichen Dank.«
«Gehen Sie nach Hause und halten Sie Ruhe. Geben Sie Ihren Bändern eine Chance.«
Die Bänder erhielten diese Chance auf dem Rücksitz meines Wagens, während Brad, ein arbeitsloser Schweißer, diesen nach Ipswich lenkte. Brad, schweigsam und störrisch, war gewohnheitsmäßig und aus freien Stücken ohne Job. Er verdiente sich seinen kargen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsarbeiten, die er in unserer Wohngegend für jeden übernahm, der seine Launen zu ertragen bereit war. Da ich sein langes Schweigen seinen seltenen Gesprächen entschieden vorzog, kamen wir gut miteinander zurecht. Er sah aus wie vierzig, war noch keine dreißig und lebte bei seiner Mutter.
Читать дальше