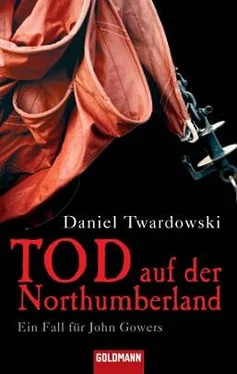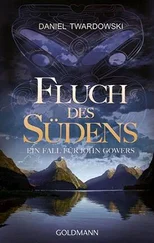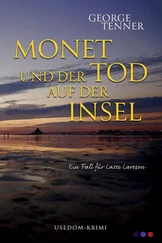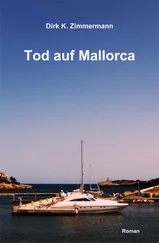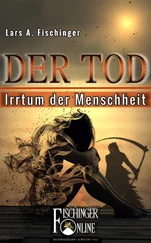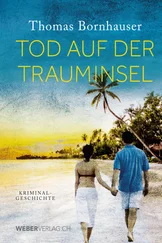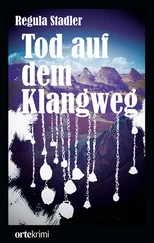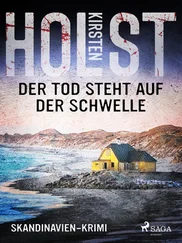Als Mad Hatter begann, in Bibliotheken und Archiven zu überprüfen, ob die abenteuerliche Geschichte des französischen Melders von Bonapartes Schatz überhaupt stimmen konnte, hatte er zuerst über sich selbst gelacht. Schatzsuche – das war etwas für Jungen und Tagediebe, für Leute, die sonst keine Aufgabe hatten. Aber seit Monaten dienstunfähig durch eine Verwundung beim Sturm auf die Bastion Korniloff und auf Halbsold gesetzt, war er ja eben das: ein Mann ohne Aufgabe. Und die Temperaturen des Winters 1855/56 fielen ins Bodenlose, die Lesesäle waren geheizt und die Sache selbst fesselnder, als er anfangs geglaubt hatte.
Schnell fand er heraus, dass Geschichte immer nur eine Konstruktion ist; labil, mühsam zusammengeleimt aus Daten und Fakten, die sich gegenseitig stützen, erklären und eine innere Folgerichtigkeit, eine Kausalität der Ereignisse vorspiegeln sollen, anhand deren sich Menschenverstand durch das Chaos von Zeit und Welt tastet. Ihm fielen dabei stets die jämmerlichen Reihen der Kriegsblinden ein, die, einander die Hand auf die Schulter gelegt, sich auf sicheren Bahnen zu bewegen glauben, oder das Maultier, das einer Mohrrübe nachläuft, die der Narr auf seinem Rücken ihm an kurzer Stange vor die Schnauze hält. Auch der Hund, der seinen eigenen Schatten jagt. Aber er beschäftigte sich nicht mit der Philosophie, die darin steckte. Ihn faszinierten die Lücken.
Er war überrascht, wie viele Lücken es in der Geschichte gab – Tage, Wochen, in denen nach Ansicht der Historiker nichts geschehen war – und wie gut Louis Vivés’ Geschichte vom Schatz Bonapartes in eine dieser Lücken passte. Für hundert Tage, so stand es in den Büchern, hatte Napoleon I. nach seiner Flucht aus Elba Frankreich noch einmal zum Kaiserreich gemacht, aber natürlich war das nur eine hübsche, runde Zahl, die die Schulkinder auswendig lernen konnten. Außerdem klang es besser als achtundsiebzig, neunundachtzig oder dreiundneunzig Tage. Tatsächlich gab es da eine Lücke von drei Wochen, drei ganze Wochen in jenem verregneten Sommer 1815, in denen nicht klar war, wer Frankreich eigentlich regierte.
Napoleon hatte die Schlacht bei Waterloo am 18. Juni verloren und war in der Stille, die die geschlagenen Feldherren aller Zeiten umgibt, nach Paris zurückgekehrt. Aber erst am 8. Juli zog der fette Bourbone, der Bruder des Geköpften, Onkel des verschollenen Dauphins, wieder in die Tuilerien und nahm seine Amtsgeschäfte auf. In den Büchern stand über diese Zeit immer nur, Napoleon habe mit seinen engsten Vertrauten beraten, ob er nach Amerika flüchten oder sich stellen sollte. Und wem er sich stellen sollte, Preußen, Österreichern, Engländern oder einem französischen Tribunal. Nur Historiker konnten so denken. Ein Mann, der in weniger als einem Jahrzehnt Europa erobert hatte, brauchte für diese Überlegung keine drei Wochen. Aber was hatte Napoleon dann getan und geplant in diesen zwanzig Tagen? Wofür war der Marschall Ney wirklich erschossen worden? Und welches Geheimnis hatte er mit sich genommen?
Nach Louis’ Erzählung hatte man in dieser Zeit Bonapartes Privatvermögen und noch etliches andere in eine Gruft geschafft, und alles, was man heute, ein halbes Jahrhundert später, für ein sorgenfreies Leben benötigte, war der richtige Name auf dem richtigen Grabstein auf dem richtigen Friedhof. Dazu eine dunkle Nacht und ein wenig Glück – und all das schien plötzlich kein Traum mehr! Die mysteriösen drei Wochen nach Waterloo, über die nichts in den Büchern stand, machten einen derartigen Ablauf möglich, und bald unterlag er dem uralten Trugschluss aller forschenden, fragenden Nichtwissenschaftler: Je weniger die Fakten Louis’ Geschichte ausschlossen, desto wahrscheinlicher kam sie ihm vor.
Zu dieser Erkenntnis gelangt, bemerkte der kriegsversehrte englische Marineoffizier auf Halbsold zum ersten Mal, dass er nicht allein war in den Lesesälen und Archiven. Dass auch andere Männer forschten und spekulierten, ja womöglich zu denselben Ergebnissen kamen. Er merkte es daran, dass jemand die gleichen Bücher auslieh, dieselben Dokumente einsah wie er. Zuerst betrachtete er das sportlich und ein wenig amüsiert. Aber er legte sich doch schon jetzt auf die Lauer, um seine Konkurrenten zu sehen, ehe er selbst gesehen werden konnte.
118.
Dass der Doktor von Bord gegangen war, ohne sich zu verabschieden, fand Emmeline Carver schäbig genug. Dass auch John Gowers verschwunden war, betrachtete sie als persönliche Beleidigung, obwohl es ihr erst auffiel, als die Northumberland Kapstadt bereits seit zwei Tagen verlassen hatte.
Seitdem aber fragten immer wieder Leute nach ihrem Bruder Daniel, Charles’ Kameraden, Hauptmann Bledsoe, sogar der Kapitän. Und dummerweise hatte sie sich anfangs darauf festgelegt, nichts über seinen Verbleib zu wissen, sodass sie jetzt zwar nicht wie eine sitzengelassene Braut, aber zumindest wie eine im Stich gelassene Schwester aussah. Hätte sie nur gleich gesagt, dass Daniel sich in den Kapkolonien ein neues Leben aufbauen wollte, wäre alles nur halb so peinlich gewesen.
Die Sympathien waren allerdings ganz auf ihrer Seite. Was konnte schließlich das Mädchen für ihre Familie? Für einen Vater, der sich erhängt, für einen Bruder, der sich offensichtlich aus dem Staub gemacht hatte, womöglich mit einem Teil des Erbes. Immerhin, armer Carver, was würden seine Leute zu einer solchen Verbindung sagen? Und hatte er seinen Schwager nicht schon auf St. Helena töten wollen?
Alle, die ihn kennengelernt hatten, waren sich jedenfalls einig, dass Daniel Thompson ein Windhund war. Zuerst seinem Vater das Herz gebrochen, jetzt seiner Schwester davongelaufen. Nach einer Weile legte sich jedoch das mitleidige Kopfschütteln, und zuletzt war auch Emmeline froh, einen so dubiosen Menschen glücklich losgeworden zu sein.
Wie eine Schlange, deren Nest man aufgedeckt hat, fuhr der Inder herum und griff sofort an. Fand den schwarzen Dolch in seinem Gürtel so sicher und selbstverständlich, als wäre er ein Teil seines Körpers. Aber der Schlagring des Weißen hatte seine Nase schon gebrochen, ehe er zustechen konnte.
Noch gab der Mörder nicht auf. Der seltsame Feind umklammerte sein linkes Handgelenk mit beiden Händen. Das war seltsam, denn selbst diejenigen seiner Opfer, die überhaupt Zeit und Kraft zur Gegenwehr fanden, rechneten nicht mit einem Linkshänder. Aber immerhin war dadurch seine rechte Hand völlig frei. Mit aller Kraft schlug er nach der großen Ader am Hals. Er wusste, dass man auch dadurch einen Mann töten kann. Aber in diesem Moment geschahen viele Dinge.
Der Weiße parierte den Schlag mit der Schulter, zog sie zur Deckung hoch, und der tödliche Schlag traf nur die alberne blaue Kappe mit den gekreuzten Schwertern, schlug sie herunter. Zugleich drehten die beiden Fäuste die dunkle Hand mit der zweischneidigen Waffe schmerzhaft herum, ohne dass der Sikh sie deswegen losließ, und ein kräftiger Tritt riss dem Mörder die Beine weg.
Beide fielen zu Boden, stürzten in den Schatten. Noch im Fallen wunderte sich der Singh, der Löwe, über die Schnelligkeit, mit der all das geschah. Er versuchte, sich zu drehen, dachte schon über den nächsten Schlag nach, den Kampf am Boden, in dem er unschlagbar war, als die schwarze Klinge ihm Lunge und Herz durchbohrte. Sein Körper zuckte und zitterte noch lange, wie rasend scharrten die Füße im Staub der Straße, während sein unheimlicher Feind ihn bis zuletzt fest an den Boden presste. Das Einzige, was er darüber hinaus noch wahrnahm, war der Geschmack des Blutes in seinem Mund.
In Gowers’ Rucksack befand sich das Fläschchen mit der Medizin, die der Doktor zuletzt hergestellt hatte. Für sich selbst nahm er nur die Pfeife und den Tabakvorrat des Toten, seine kleine Mundharmonika und das Buch, das Van Helmont angefangen hatte und nun nie mehr zu Ende lesen würde: Fieldings A Journey from this World to the Next . Dort fand er einen Satz, den der Arzt angestrichen hatte und der dem Haus des Todes galt, in das Fieldings bunte Gruppe jüngst Verstorbener eintrat.
Читать дальше