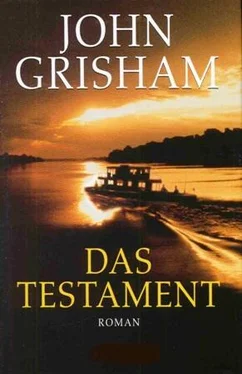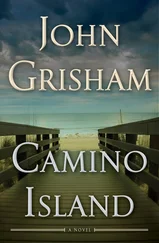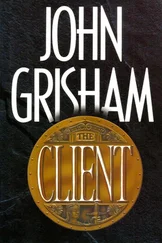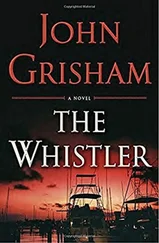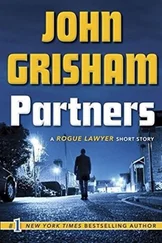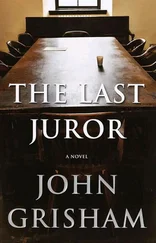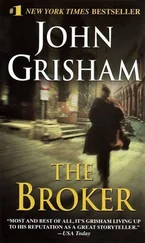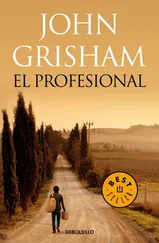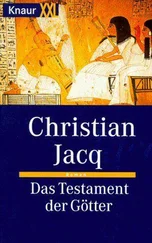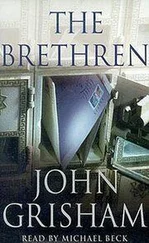Nach zwei Stunden führten die Indianer sie in eine verwirrende Folge schmaler Wasserläufe und stiller Lagunen, und als sie einen breiteren Fluss erreichten, verlangsamten die Kanus eine Weile ihre Fahrt. Die Indianer mussten sich ausruhen. Lako erklärte Jevy durch Zurufe, dass sie in Sicherheit seien. Der schwierige Teil liege hinter ihnen, jetzt müsse man mit keinen Hindernissen mehr rechnen. Bis zum Xeco seien es noch rund zwei Stunden, und der führe geradezu in den Paraguay.
Schaffen wir das allein? fragte Jevy. Nein, lautete die Antwort. Es gebe immer noch Abzweigungen. Außerdem kannten die Indianer eine Stelle am Xeco, die nicht überschwemmt sei. Dort könnten sie die Nacht verbringen.
Wie geht es dem Amerikaner? fragte Lako. Nicht gut, antwortete Jevy.
Der Amerikaner hörte ihre Stimmen und merkte, dass sich das Boot nicht bewegte. Das Fieber wütete in seinem Körper vom Kopf bis zu den Füssen. Er war völlig nass, und auch seine Kleider waren durchnässt. Die Nässe bedeckte ebenfalls das Aluminium des Bootsrumpfes unter ihm. Seine Augen waren zugeschwollen, und sein Mund war so trocken, dass es schmerzte, wenn er ihn nur öffnete. Er hörte, wie Jevy etwas auf englisch sagte, aber er konnte nicht antworten. Das Bewusstsein kam und ging.
In der Dunkelheit fuhren die Kanus langsamer. Jevy blieb näher an ihnen dran und leuchtete von Zeit zu Zeit mit der Taschenlampe, damit ihre Führer die Abzweigungen und Zuflüsse besser erkennen konnten. Die Indianer machten eine Pause, um einen Laib Brot zu essen, etwas Saft zu trinken und sich zu erleichtern. Bei dieser Gelegenheit banden sie die drei Boote aneinander und ließen sie zehn Minuten lang treiben.
Lako machte sich Sorgen um den Amerikaner. Was soll ich der Missionarin über seinen Zustand sagen? wollte er von Jevy wissen. Sag ihr, dass er Malaria hat.
Blitze in der Ferne bereiteten ihrer kurzen Abendessenpause ein Ende. Die Indianer paddelten eifriger denn je.
Seit Stunden hatte niemand festen Boden gesehen. Es gab keine Stelle, an der man hätte anlegen und ein Gewitter abreiten können.
Schließlich ging der Motor aus. Jevy nahm seinen letzten vollen Kanister und startete ihn erneut. Wenn er mit halbem Gas fuhr, würde sein Treibstoff etwa sechs Stunden lang reichen, genug, um bis zum Paraguay zu gelangen. Dort gab es Schiffsverkehr und Häuser. Außerdem wartete irgendwo die Santa Loura. Er kannte die Stelle, wo der Xeco in den Paraguay mündete. Wenn sie von dort flussabwärts fuhren, würden sie gegen Morgengrauen auf Welly stoßen.
Als die Blitze aufzuckten, legten sich die Führer noch mehr in die Paddel, doch war unübersehbar, dass sie allmählich müde wurden. Einmal hielt sich Lako an einer Seite des Motorboots fest und ein anderer Ipica an der anderen. Jevy reckte die Taschenlampe hoch über den Kopf, und sie fuhren zu Tal wie ein Schleppkahn mit zwei
seitlich daran befestigten Schuten.
Allmählich sah man mehr Bäume und dichteres Unterholz. Der Fluss wurde breiter. Zu beiden Seiten war fester Boden. Die Indianer redeten wieder öfter miteinander. Als sie den Xeco erreichten, hörten sie auf zu paddeln. Sie waren erschöpft und bereit, ihr Geleit zu beenden. Immerhin würden sie normalerweise schon drei Stunden schlafen, überlegte Jevy. Sie fanden die Stelle, die sie suchten, und gingen an Land.
Lako erklärte, dass er der Missionarin schon seit Jahren half. Er hatte viele Malariafälle gesehen und die Krankheit selbst dreimal gehabt. Behutsam zog er das Zelt von Nates Kopf und Brust und fasste nach seiner Stirn. Sehr hohes Fieber, sagte er zu Jevy, der im Schlamm stand und die Taschenlampe hielt und möglichst bald zurück ins Boot wollte.
Machen kann man da nichts, sagte der Indianer, als er seine Diagnose gestellt hatte. Das Fieber geht zurück, und in achtundvierzig Stunden kommt der nächste Anfall. Ihn beunruhigten die angeschwollenen Augenlider. Das hatte er bisher noch bei keinem Malariafall erlebt.
Der älteste der Führer sagte etwas zu Lako und wies auf den dunklen Fluss. Dieser erklärte Jevy, er solle sich in der Mitte halten, die schmalen Abzweigungen, vor allem auf der linken Seite, nicht zur Kenntnis nehmen, dann werde er nach zwei Stunden den Paraguay erreichen. Jevy dankte ihnen überschwänglich und legte ab.
Das Fieber ging nicht zurück. Eine Stunde später sah Jevy nach Nate und merkte, dass sein Gesicht immer noch glühte. Er hatte sich wie ein Fetus zusammengekrümmt, war kaum bei Bewusstsein und murmelte unzusammenhängende Worte. Jevy veranlasste ihn dazu, ein wenig Wasser zu trinken, und goss den Rest über sein Gesicht. Der Xeco war breit und ließ sich leicht befahren. Sie kamen an einem Haus vorüber. Es hatte den Anschein, als wäre es das erste in einem ganzen Monat. Wie ein Leuchtturm, der ein verirrtes Schiff grüsst, brach der Mond durch die Wolken und erhellte das Wasser vor ihnen.
»Können Sie mich hören, Nate?« fragte Jevy, ohne dass seine Worte an Nates Ohr drangen. »Unsere Pechsträhne ist zu Ende.«
Er ließ sich vom Mond zum Paraguay leiten.
Das Boot war eine chalana. Es hatte einen flachen Boden, sah aus wie ein Schuhkarton, war zehn Meter lang, zweieinhalb Meter breit, und diente dazu, Fracht durch das Pantanal zu transportieren. Jevy hatte Dutzende solcher chalanas geführt. Er sah das Licht um eine Biegung herum, und als er das Geräusch des Diesels hörte, wusste er gleich, was für eine Art Boot es war.
Außerdem kannte er den Bootsführer, der in seiner Koje schlief, als der Matrose die chalana stoppte. Es war fast drei Uhr morgens. Jevy band sein Boot am Bug fest und sprang an Bord. Man gab ihm zwei Bananen, während er in wenigen Worten seine Situation schilderte. Der Matrose brachte gesüßten Kaffee. Sie waren auf dem Weg nach Norden, wo sie am Militärstützpunkt Porto Indio mit den Soldaten Handel treiben wollten. Sie konnten Jevy zwanzig Liter Treibstoff abtreten. Jevy versprach, ihnen das Geld in Corumba zu geben. Kein Problem, auf dem Fluss half man sich gegenseitig.
Es gab noch mehr Kaffee und einige mit Zucker bestreute Waffeln. Dann erkundigte er sich nach der Santa Loura und Welly. »Sie liegt an der Einmündung des Cabixa«, sagte Jevy. »Da, wo früher der alte Anleger war.«
Die Männer schüttelten den Kopf. »Da war sie nicht«, sagte der Bootsführer. Der Matrose stimmte ihm zu. Sie kannten die Santa Loura, sie hatten sie nicht gesehen. Sie zu übersehen wäre unmöglich gewesen.
»Sie muss da sein«, sagte Jevy.
»Ist sie nicht. Wir sind gestern Mittag am Cabixa vorbeigekommen. Von der Santa Loura haben wir keine Spur gesehen.«
Vielleicht war Welly einige Kilometer weit den Cabixa hinaufgefahren, um nach ihnen Ausschau zu halten. Bestimmt hatte er sich entsetzliche Sorgen gemacht. Jevy würde ihm verzeihen, dass er die Santa Loura eigenmächtig geführt hatte, aber erst nachdem er ihn kräftig zusammengestaucht hatte.
Das Boot musste da sein, davon war er überzeugt. Er trank noch mehr Kaffee und berichtete von Nate und seiner Malaria. In Corumba erzählte man sich, dass die Krankheit seit neuestem wieder im Pantanal wütete. Solche Gerüchte hatte Jevy schon sein Leben lang gehört.
Sie füllten einen Kanister aus einem Fass an Bord der chalana. Als Faustregel galt, dass man während der Regenzeit dreimal so schnell flussabwärts fuhr wie flussaufwärts. Ein Boot mit einem guten Motor müsste den Cabixa in vier Stunden erreichen, die Handelsniederlassung in zehn, und Corumba in achtzehn. Die Santa Loura würde länger brauchen, immer vorausgesetzt, dass sie sie fanden, doch zumindest hätten sie dann Hängematten und etwas zu essen.
Jevy hatte sich vorgenommen, bei der Santa Loura anzulegen und kurze Rast zu halten. Er wollte Nate ins Bett bringen und mit Hilfe des Satellitentelefons Senhor Ruiz in Corumba anrufen. Der konnte dann einen guten Arzt auftreiben, der wissen würde, was zu tun war, wenn sie in Corumba eintrafen.
Читать дальше