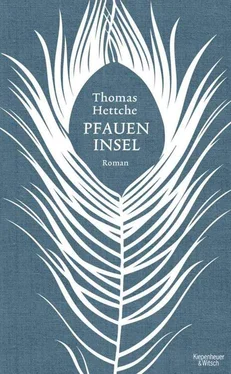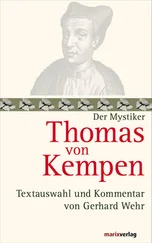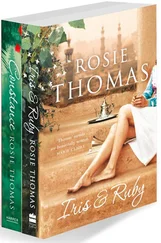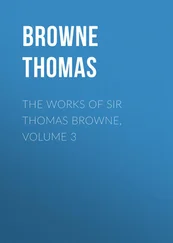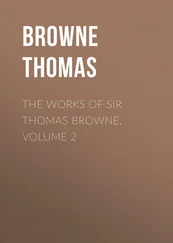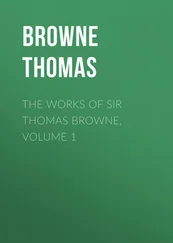Drittes Kapitel. Die Schönheit der Pfauen
Der Pfau schlug sein Rad. Marie kauerte vor ihm auf der nassen Schloßwiese und mummelte sich fest in ihren alten, unförmigen Mantel. Daß sie längst eine junge Frau war, fast zwanzig, spielte für sie selbst die meiste Zeit keine Rolle, da es niemand bemerkte, seit jenem Erlebnis mit Gustav nicht einmal mehr sie selbst.
Der Schnee war in diesem Jahr spät erst geschmolzen, Anfang Mai, und so balzte der Pfau im Matsch. Auf seinem in glänzend purpurblaues Federglas gekleideten Kopf mit den Knopfaugen und dem kleinen, konzentrierten Schnabel zitterte das Krönchen, und Marie meinte zu sehen, welche Mühe er damit hatte, das weite Federrad, diesen in allen Farben glänzenden und schimmernden Mantel, der seinen Kopf umrahmte, immer wieder ein kleines Stück weiterzudrehen, immer wieder von neuem ins Blickfeld der unscheinbar nußbraunen, weißbraunen, lichtbraunen Henne, die gänzlich ungerührt im Dreck nach Körnern pickte, die es dort nicht gab. Wie sehr er sich konzentriert! dachte Marie. Er hat nur Augen für seine Henne, alle Augen der Welt. Und es kam ihr so vor, als versuchte er, sie mit der ganzen Opulenz seiner ornamentalen Pracht davon zu überzeugen, daß es eine Welt außerhalb seines schützenden Farbkreises gar nicht gebe. Sie glaubte es ihm wohl nicht. Und trotzdem: Wie schön er ist! Marie konnte sich nicht satt sehen an der perfekten Symmetrie der Farben.
Alle Pfauen der Insel schienen sich an diesem Tag hier in der Frühlingssonne versammelt zu haben, die langen Schwanzfedern streiften über die bloße, nasse Erde, und so zogen die Hähne weiche, fächernde Spuren hinter sich her, die Hennen hinterließen die spitzigen Abdrücke ihrer nackten Krallen. Das Blau der Männchen hatte im hellen Licht einen deutlich goldenen und grünen Schimmer, jede Feder kupfern gerändert und muschelartig gezeichnet, auf der Rückenmitte waren die Tiere tiefblau, auf der Unterseite schwarz, und die grüne Schleppe mit ihren prächtigen Augenflecken war mehr als einen Meter lang. Mancher Hahn öffnete hin und wieder seinen Schmuck ein wenig wie zur Probe, doch war kein Weibchen in der Nähe, sank das fluffige Farbspiel schnell wieder in sich zusammen, und er stolzierte weiter.
Hier am Schloß hatten sie ihren Stall, hierher brachte Marie ihnen im Winter ihr Futter, das gleiche, das auch die Hühner bekamen, doch die meisten Pfauen hielten sich nur zum Fressen im Stall auf, als Schlafplatz zogen sie die alten Eichen zwischen Kastellanshaus und Schloß vor. Es war ein seltsamer Anblick, wenn sich die Hähne schwerfällig mit kurzen Flügelschlägen auf einen der unteren Äste schwangen. Dicht an dicht dann die blauen, immer umherspähenden Köpfe, umrahmt von den Federn der anderen, im Schlafbaum. Im Sommer duldeten sie derartige Nähe nicht. Nach der Brunft verschwanden sie in alle Ecken der Insel und trugen mitunter heftige Kämpfe um ihr jeweiliges Revier aus. Dann verloren die Hähne auch ihre ganze Pracht. Eben zu der Zeit, wie der Onkel erklärt hatte, da in Indien, wo sie im Dschungeldickicht lebten, der Monsunregen einsetzt, bei dem es ihnen mit nassen Federn unmöglich wäre, auf die Bäume zu kommen.
Ob die Henne ihn erhören wird? Marie betrachtete den balzenden Hahn mit Sympathie. Sie würde sich nicht zieren. Niemals würde sie schön sein, dachte sie traurig und verfolgte gebannt das Spiel zwischen den beiden. Wie er seinen Schmuck werbend immer wieder nach der Henne hindrehte, und wie sie ihn scheinbar nicht beachtete. Wie grotesk ist doch diese Schleppe, dachte Marie, wenn sie sich nicht zum Rad aufspannt, und das tat sie ja meistens nicht. Wie sehr sie den Pfau behinderte. Schönheit ist Willkür. Es gab sie nicht, wenn er ihr nicht gefiel. Ganz egal, ob ich ihn schön finde, dachte Marie, nur ihr muß er gefallen.
Darwin, im fernen England noch ein Knabe, würde einmal angesichts solch balzender Pfauen begreifen: Obwohl die Schleppe es dem Pfau erschwert, seinen Feinden zu entkommen, ist sie für das Überleben seiner Gene doch von Vorteil, denn je schöner, größer, bunter, symmetrischer seine Schwanzfedern, um so größer die Chance, daß ein Weibchen ihn wählt. Und jede Wahl der schönsten Pfauen bringt noch schönere Pfauen hervor. So treiben die unscheinbaren Hennen die Evolution dessen voran, was sie schön finden. Nichts ist Gesetz, alles Entscheidung. Wäre dieser Gedanke in diesem Moment schon in der Welt gewesen, er hätte Marie wohl sehr gefallen. Daß Schönheit der sichtbare Einspruch der Liebe gegen den Kampf ums Überleben ist, gegen die Sphäre des Todes.
Doch Marie wußte davon nichts, und sowenig, wie wir Tiere heute betrachten können, ohne daß jedes einzelne immer nur zum Exemplar einer Gattung wird, war sie damals in der Lage, in ihrer Schönheit etwas anderes zu sehen als Prunk und Überschuß. Eine Grenze, die wir nicht mehr zu überschreiten vermögen, trennt unser Denken von Maries Empfinden. Und doch findet sich, auch wenn die Ideen herzklopfensneu in die Welt kommen, an der Stelle, an der sie sich einmal bilden werden, zuvor schon ein Unbehagen daran, wie alles ist. Unsere Sehnsucht reicht mindestens ebensoweit in die Vergangenheit zurück wie in die Zukunft hinein. Marie also sah die Hingabe dieses Tiers und dachte: Jedes konnte schön sein, es kam nur darauf an, wer es betrachtete. Vielleicht sogar sie selbst. Und vielleicht war jede Schönheit grotesk. Und alles Groteske schön. Und so selbst eine Zwergin schöner noch als eine Königin, dachte Marie, weil sie einzigartig war, und auch eine Königin nichts anderes als eine schöne Frau.
Der Pfau stand jetzt ganz dicht bei der Henne, die sich nicht mehr rührte. Marie kauerte sich noch ein wenig mehr zusammen und schlang die Arme um ihre Knie. Gebannt sah sie zu, was dann geschah. Sehr langsam und zärtlich begann der Pfau den Mantel seiner Federn über sie beide zu senken, über sich und das Weibchen, wie die vielaugigen Flügel der Seraphim. Marie hielt den Atem an.
Doch plötzlich, und bevor sie selbst bemerkt hatte, was ihn störte, fiel die ganze Federpracht in sich zusammen. Der blaugeharnischte Kopf mit den blicklos schwarzen Augen sah sich unruhig um. Dann blökte ein Schaf. Hahn und Henne und auch alle anderen Pfauen flatterten eilig davon, während ein schmutzigweißes Schaf, noch in seiner dichten Winterwolle, über die Wiese heranzockelte, geführt an einem roten Band von ihrem Bruder, der ihr grinsend schon von weitem zuwinkte. Verärgert stand Marie auf. Christians Oberkörper war nackt, und er trug eine Hose aus Schafsfell, deren Zotteln bei jedem Schritt seiner Säbelbeine wippten. Genauso groß wie er, ließ das Tier sich willig von ihm führen, wobei das rote Seidenbändchen, das dazu diente, nur mit einer Schleife um seinen Hals befestigt war.
»Ist dir nicht kalt?«
»Nein, gar nicht, Schloßfräulein.«
Er blieb lachend vor ihr stehen, während das Schaf sofort begann, die wenigen bleichen Halme zu ihren Füßen auszurupfen. Als er sie umarmen wollte, entwand sie sich seinem Griff und vergrub die Hände in den Taschen ihres Mantels. Seit ihr Bruder kaum mehr ins Kastellanshaus kam und statt dessen Gundmann und dem Fasanenjäger bei der wachsenden Zahl von Tieren zur Hand ging, die auf die Insel kamen, war er ihr fremd geworden. Marie wußte gar nicht mehr, wie das angefangen hatte. Zu den Kühen, Schafen und Ziegen der Meierei war zunächst, von Sanssouci herüber, die Fasanerie verlegt worden, seitdem kamen nach und nach immer mehr ungewöhnliche Tiere auf die Insel, Geschenke an den König, schlesische und ungarische Schafe, dann sogar Wasserbüffel, chinesische Schweine und bengalische Hirsche, die ein Graf von Lindenau überbringen ließ, die Gräfin Louise Magni Angoraböcke, Perlhühner, türkische Enten und Goldfische. Alles wurde vom König dankend angenommen und hierher auf die Insel expediert. Auch ein riesiger Braunbär, vor dem Marie sich sehr fürchtete, war als Geschenk aus Rußland in einem eisernen Käfig gekommen und im Wald an einen mächtigen Pfahl gekettet worden, den er seither, vor allem in der Nacht immerzu brüllend, unablässig umrundete.
Читать дальше