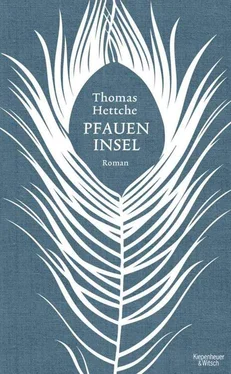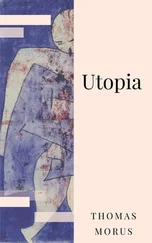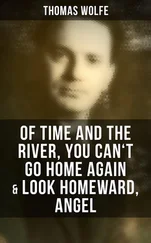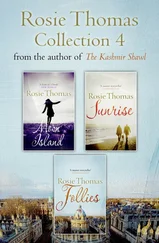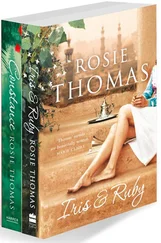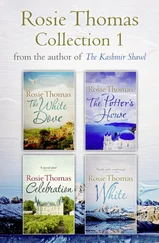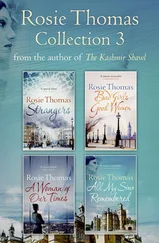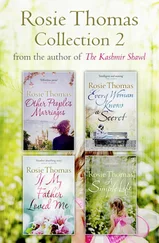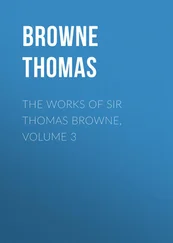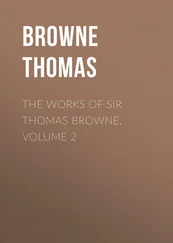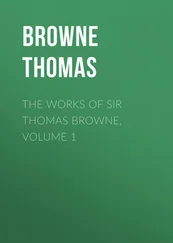Ein schmaler Pfad führte zwischen Kastellanshaus und Schloß zu einem kleinen Gemüsegarten am Ufer hinab, dorthin ging er mit ihr, und sie bemerkte, daß er sich offenbar bemühen mußte, seine Aufregung zu verbergen. Dicht und hoch stand das Schilf. Ein alter Staketenzaun bückte und bog sich unter dem Andrang der Büsche, die ihn hart bedrängten, das Törchen mit rostigen Krampen an alten Pfosten befestigt. In einer Ecke, halb schon im Erlenschatten, ein Dutzend Tontöpfe, die Marie erst bemerkte, als Gustav zielstrebig auf sie zulief. Schon kniete er davor.
»Blau«, stieß er erregt hervor. »Siehst du!«
Die Hortensien in den Töpfen hatten blaue Blüten.
»Ja.«
Sie stand dicht bei ihm und hätte ihm gern über den Kopf gestrichen, weil er sich so freute. Doch als sie ihre Hand tatsächlich nach ihm ausstreckte, sprang er schon wieder auf.
»Weißt du, wie ich es gemacht habe?«
»Sag es mir«, sagte sie.
Es gibt keine blauen Hortensien. Die Blüten dieser eigentlich in Südostasien heimischen Pflanze, die man nach Hortense Lepaute benannt hat, einer Astronomin und Mathematikerin, die 1759 die Ankunft des Halleyschen Kometen ebenso berechnet hatte wie die seinerzeitige Venuspassage, sind entweder rot oder weiß.
»Schilferde! Hier am Zaun, dieser Haufen mit kompostiertem Schilf. Als ich sie damit eintopfte, wurden sie blau.« Aufgeregt machte Gustav ein paar unentschiedene Schritte, dann fiel er vor den Töpfen wieder auf die Knie und hielt ihr eine der Pflanzen hin. Marie berührte die kleinen blauen Blüten mit der flachen Hand.
»Der Onkel kommt auch gleich.«
Sie nickte. Dann nahm sie all ihren Mut zusammen: »Gustav?«
»Das ist schön, findest du nicht?«
»Ja, sehr schön. Gustav?«
»Sieh nur, wie schön sie sind!«
»Ja, wunderschön. Da hast du etwas Wunderschönes gemacht. Aber du mußt auch mich verstehen. Du hast gesagt, du liebst mich.«
Er nahm den Blick nicht von den Blüten. »Ich kann dich nicht lieben«, kam es leise zu ihr herauf.
»Aber warum? Gustav!«
»Weil du ein Tier bist. Und ich bin eine Pflanze.«
Tränen in den Augen, lächelte er ein verzerrtes Lächeln zu ihr hoch und blinzelte gegen die Sonne. Sie verstand zunächst gar nicht, was er da sagte, weil es sie so entsetzte, wie haßerfüllt er die Wörter ausspuckte. Repetierte, als müßte sie sich in eine fremde Sprache hineindenken, immer wieder, was er gesagt hatte. Kämpfte gegen den Wunsch an, wegzulaufen. Nein. Solange es eben dauerte, solange würde sie bleiben, dachte sie, und bewegte sich nicht von der Stelle, bis der Onkel, von der Schloßküche her, den Gemüsegarten betrat, sorgsam das Tor hinter sich schließend, damit die Kaninchen und Pfauen nicht hereinkamen.
»Aber du hast gesagt, daß du mich liebst!« sagte sie schnell noch einmal.
Doch Gustav wischte sich die Tränen ab und sah dem Onkel entgegen, der mit Schürze, Holzschuhen und Strohhut wie ein Gärtner gekleidet war, in der einen Hand den langen Gärtnerstab, in der anderen Armbeuge einen Spankorb mit ein paar Wurzeltrieben. Besonders im Frühjahr genoß er es, den Gehülfen zur Hand zu gehen und selbst im Garten mit anzupacken. Noch bevor Gustav etwas sagen konnte, war sein Blick schon auf die Hortensien gefallen. Gustav strahlte über das ganze Gesicht.
»Onkel!«
»Das hast nicht du entdeckt«, begrüßte Fintelmann seinen Neffen, der ihn verständnislos anstarrte. Er stellte sein Körbchen ab, machte die paar Schritte zu den Töpfen hinüber und betrachtete die Pflanzen. Die Möglichkeit, erklärte er, Hortensien durch verschiedene Zugaben blau zu färben, sei schon seit der Einführung der Pflanze in Frankreich 1789 bekannt. Es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Säuregehalt des Bodens und der Blütenfarbe: Alkalische Erde bringe rote Blüten hervor und saure Erde blaue Blüten.
»Es war im Jahr der Revolution. Als sie den Garten von Versailles stürmten und der berühmte Le Notre …«
»Aber …«, sagte Gustav.
»Was: Aber?«
Gustav räusperte sich. »Warum haben Sie es dann nie selbst getan, wenn Sie davon wußten, Onkel?«
Ferdinand Fintelmann nahm seinen Hut ab und strich sich mit der Hand über den Kopf. Sehr leise sagte er: »Ich mag es nicht.«
»Was denn? Blau?« In Gustavs Stimme schwang Trotz mit, als trüge der Onkel durch sein Versäumnis eine Mitschuld an des Neffen Enttäuschung.
Fintelmann schüttelte den Kopf. »Ich finde, es gehört sich nicht.« Er stützte sich auf den Stab und beugte sich zu seinem Neffen hinab. »Man soll nicht zaubern mit der Natur. Die Sphären nicht vermischen.«
Gustav schüttelte fassungslos den Kopf. Marie aber verstand, was er im Sinn gehabt hatte. So blau wie diese Blumen waren ihre Haare schwarz. Wie alles, was das Feuer verzehrt dort in der Erde, woher sie kam. Man mußte sich nicht entscheiden zwischen Pflanze und Tier, es gab ein Drittes. Etwas jenseits von Tod oder Schönheit. Etwas, das dauerte. Etwas das nicht fraß und sich nicht verschwendete. Das mineralische Reich. Sie war ein Ding. So, wie Kunckel das Glas rot machte, machte die Erde, aus der sie kam, die Blumen blau.
»Womit hast du es gemacht?« wollte der Onkel wissen.
»Mit der Schilferde hier.«
»Interessant. Für gewöhnlich nutzt man Alaun dazu.«
Alaun, echote es in Marie.
Der Onkel bückte sich ächzend nach dem Spankörbchen und wandte sich zum Gehen. Für ihn war die Sache erledigt. Doch nicht für Gustav.
»Ich werde sie dem König zeigen!«
Der Onkel sah sich überrascht nach seinem Neffen um. Skeptisch wiegte er den Kopf. Die Idee gefiel ihm nicht. Es war nicht ehrlich, zumal es die Lieblingsblumen der Königin betraf. Aber wer wußte schon, was daraus entstehen konnte? Er nickte Gustav zu, zögerlich zwar, doch jetzt durchaus wohlwollend. Und bat Marie, schon im Gehen, ihn doch zu begleiten. Froh um diese Bitte, nahm sie ihm den Spankorb aus der Hand, und die beiden verließen den Garten in Richtung Kastellanshaus.

Statt direkt ins Schlafcabinett zu laufen, aus dem sie das Buch genommen hatte, das sie noch schnell zurückbringen wollte, bevor die Königlichen Hoheiten mit den Gondeln aus Potsdam eintreffen würden, schlenderte Marie zunächst noch im Erdgeschoß zu jenem Raum, den sie schon allein wegen seines Namens besonders mochte: das Otaheitische Cabinett. Unter Otaheiti, wie man im 18. Jahrhundert die Gesellschaftsinseln genannt hatte, stellte sie sich eine Weltgegend vor, in der es nur Inseln wie die ihrige hier gab. Und nur Sommer. Und Fische und nackte Menschen. Wie erschrak sie, als sie die Tür aufstieß und der Kronprinz vor ihr stand. Zwei Jahre älter als sie, doch noch immer ein etwas pummeliger Junge, verträumt und weich, hatten sie früher im Park gern miteinander gespielt. Hier aber, das wußte sie, zählte das nicht. Sie getraute sich nicht einmal, das Buch aufzuheben, das sie vor Schreck fallen gelassen hatte.
Aber auch er rührte sich nicht in seiner Uniform, über deren hohem, fest geschlossenem Kragen sich die weichen Wangen wölbten, eine Hand, als sollte er gemalt werden, abgestützt auf dem kleinen runden Tisch in der Mitte des ebenso runden Raums. Die Läden waren geschlossen, um die Wärme auszusperren, und im kühlen Halbdunkel ihrer beiderseitigen Überraschung hörte man nichts als das Kratzen der Metallrechen draußen im Kies der Wege.
»Das ist unsere Insel«, sagte er schließlich und deutete vage auf die Wände um sich.
Es dauerte einen Moment, bis Marie begriff. Doch dann sah sie es, und zwar zum allerersten Mal. Es ist das Otaheitische Cabinett ringsum so mit bemalter Leinwand bespannt, daß man den Eindruck gewinnen kann, man befinde sich in einer Hütte in der Südsee, die immer wieder Ausblicke in eine Landschaft durch gemalte Fenster freigibt, in denen man jedoch, wie sie jetzt entdeckte, dasselbe sah wie in den realen: die gleißende Wasserfläche der Havel. Das war ihr noch nie aufgefallen. Dieser Raum wünschte den Betrachter nicht etwa hinweg in eine andere Hemisphäre, sondern ganz im Gegenteil die Südsee mit Bambus und Palmen hierher ins Preußische, indem er die Pfaueninsel verwandelte.
Читать дальше