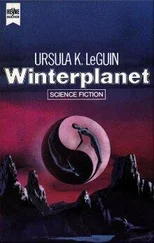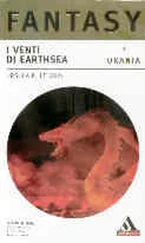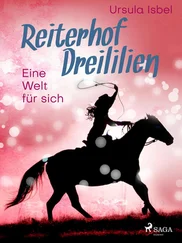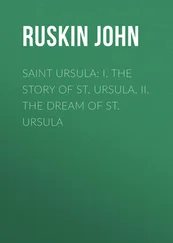Alles schwankte, die Berge grüßten, die satten grünen Matten waren ein Grund, auf dem man stehen könnte (wenn man Grund und Boden hätte), ein Fuß in der Stadt, ein Fuß auf dem Berg, mit Riesenschritten ginge es so zurück in eine Normalität. Claire Kornitzer hatte als Sekretärin bei einem Patentanwalt am Bodensee gearbeitet, solange noch Krieg war, produzierte die Waffenindustrie in der Nachbarstadt: Die Zeppelinwerft, die Motorenfabrik, die Zahnradfabrik und die Aluminiumfabrik, alle liefen auf Hochtouren. Alle arbeiteten fieberhaft an neuen (kriegswichtigen, kriegsentscheidenden, so hieß es) Produkten. Ingenieure tüftelten an Erfindungen, die Firmen meldeten Patente an, noch und noch, man wußte ja nie, man würde nach Kriegsende (so oder so) die Patente ins Ausland verkaufen. Da hatte der Patentanwalt viel zu tun, und er war froh, eine verständige Mitarbeiterin zu bekommen, die durch ihren Mann, der verschollen war, schon in den frühen dreißiger Jahren Erfahrungen mit dem Patentrecht hatte. Er war zufrieden mit Claire, und Claire glaubte, es auch gut getroffen zu haben. Dann wurde die Stadt der Flugzeugwerft, der Maschinenfabriken, der Aluminiumerzeugung bombardiert, eine Dornier trudelte, brannte, lag wie ein großer Torpedokäfer auf dem Rücken, ein Flügel gekippt, aufgerissen. Dem Luftangriff vom 28. April 1944 fiel die Schloßkirche in Friedrichshafen zum Opfer, der Dachstuhl brannte, der Helm kippte, die Orgel und große Teile der Kirchenbänke wurden vernichtet. Weil kein Notdach errichtet werden durfte, blieben die unbeschädigten Deckengewölbe der Witterung ausgesetzt, so daß sich die Deckenfresken mit der Zeit auflösten und der wertvolle Stuck seit dem Herbst 1945 von der Decke herunterstürzte.
Die Büros der Ingenieure waren vor den Angriffen notdürftig aufs Land evakuiert worden und arbeiteten unverdrossen weiter, so hieß es. Aber nach dem Krieg wollte niemand mehr etwas wissen von den Motoren, der Luftfahrtindustrie, der kriegswichtigen Maschinenproduktion und ihren Erfindungen, von dem Hafenwesen, dem Zahnradwesen, dem Eisenbahnausbesserungswesen noch am ehesten. Die Produktionsstätten für Aluminium waren zerstört, das Waffenwissen lag brach, die Firmen zwangsaufgelöst, die Patente wie Blei im Keller, kein Bedarf, nicht einmal mit der Kneifzange anzufassen. Einige Ingenieure, die sich etwas auf ihr Wissen zugute hielten, verschwanden, waren auf klammen Wegen ins Ausland gegangen, hatten sich einfach abgesetzt mit ihren eingerollten Plänen, ihrem strikten Willen zum Siege, und wenn es nicht der Endsieg geworden ist, dann der einer einschmiegsamen Rede, die von Europa säuselte, wenn sie Deutschland meinte, von dem europäischen technischen Fortschritt, der europäischen technischen Überlegenheit, wenn sie Deutschland meinte. Es war zum Lachen. Nahmen sie Patente mit, an denen sie einen Anteil hatten oder von denen sie behaupteten, einen Anteil zu haben? Das war nicht voraussehbar, sagte der Patentanwalt seiner tüchtigen Mitarbeiterin. Also war auch die Niederlage nicht voraussehbar für den Patentanwalt. (Oder undenkbar? Nicht vorstellbar?) Die Technik siegte, die Niederlage war nicht voraussehbar, auch nicht vorstellbar, nicht die vollständige Kapitulation des Luftfahrtwesens, des Maschinenwesens, des Motorwesens, des ganzen menschlichen deutschen Wesens mitsamt seiner Erfindungskraft, seinen Tüftlern und Bastlern. Die deutsche Waffenindustrie mitsamt ihren Erfindungen hatte sich als zerbrechlich erwiesen, sie lag am Boden, und dort sollte sie nach dem Willen der Alliierten bleiben, zertrümmert, abgeräumt. Die Schloßkirche bekam erst 1947/48 mit Schweizer Hilfe ein Notdach, die Schweizer schickten Handwerker, die Handwerker brachten Schokolade für die Kinder mit, das Hämmern und Klopfen war am Seeufer zu hören.
Der Nachkrieg und die Währungsreform hatten auch die Anwaltskanzlei in Turbulenzen gebracht, man dankte Claire Kornitzer, man verwies sie darauf, daß sie als „Evakuierte“ bald die strukturlos gewordene Gegend verlassen würde und mit ihrer Qualifikation (für die hier leider keine Verwendung bestünde) sicher in einer größeren Stadt mehr Glück hätte. Man gab ihr ein brillantes Zeugnis, für das sie eines ihrer guten Farbbänder der Schreibmaschine zur Verfügung stellte, und das war’s. Es drängten junge Frauen, die noch keine Ausbildung hatten, die auch auf den übriggebliebenen Schreibmaschinen gymnastische Übungen machen wollten, es drängte eine Normalität. Für eine Berliner Geschäftsführerin einer GmbH, die abgehalftert worden war aus Gründen, die zehn Jahre später nicht mehr begriffen wurden, war zum zweiten Mal kein Platz. Claire Kornitzer ging stempeln, dann schlüpfte sie in der Verwaltung einer Molkerei unter, zählte die Milchkannen und schrieb Rechnungen und Berichte. Claire Kornitzer, ungebunden, hungrig, ohne Familie (aber mit Sorgen um ihre zerstreute Familie) war eine Belastung, eine Last, die abgeworfen wurde, aus betriebsinternen Gründen, aus nachkriegsbedingten Gründen, wie sie vorher aus Gründen, die die nationalsozialistische Gesetzgebung vorgab, aus ihrem Beruf gedrängt worden war. Ein Ehepartner, der ein Klotz am Bein war. Eine Ehefrau, die sich weigerte, die Scheidung gegen den jüdischen Partner einzureichen, war verloren. Sie war mehrmals zur Gestapo vorgeladen worden und hatte unterschreiben müssen, nichts über diese Vorladungen, die Erschütterungen ihres bürgerlichen Lebens waren, weiterzugeben. Also war sie nicht zur Gestapo vorgeladen worden, also war sie nicht mißhandelt worden, zum Schweigen verdonnert. Also hatte sie das alles nur geträumt, und jede Aussage, jedes Flüstern, jede Äußerung gegenüber einem vertrauten Menschen, der sich dann doch nicht als so vertraut herausstellte, hätte weitere Einschüchterungen zur Folge gehabt, das hatte sie begriffen, das hatten sie einige Männer in einem Büro gelehrt, in dem sie lange warten mußte, bis es Nacht geworden war, bis das Haus nicht mehr vor Schreien und Brüllen und Türenschlagen vibrierte. (Und sie verstand diese Lehre nur so ungefähr, eher mit den Nerven, mit den empfindlichen Fingerspitzen als mit dem Verstand.) Was folgte, auch ohne ihr Verstehen, und besonders ohne ihre Einwilligung: Sie hatte nicht nur nichts zu sagen, sie hatte einzupacken und ihren Mann besser gleich als später aus der Schußlinie zu ziehen, so einfach war das.
Was aber feststand, waren ein paar Daten, Fakten: Das 1. Juristische Staatsexamen von Richard Kornitzer war vollbefriedigend. 1926 promovierte er zum Dr. jur., da ist er gerade mal 23 Jahre alt. Das 2. Juristische Staatsexamen legt er mit „gut“ ab. Das waren hervorragende Noten, ein schneller Student, ein Überflieger, entschlossen, seinen Weg zu gehen. Warum es Einser-Philosophen gibt und Einser-Volkswirte, aber die Noten der Juristen tiefer liegen, weiß kein Mensch zu sagen. Vielleicht um die jungen Juristen nicht zu verwöhnen, während der junge Philosoph weiß, daß auf ihn nicht die geringste Verwöhnung wartet, sondern die rauhe Gewißheit, daß niemand ihn braucht. Hervorragende Juristen werden gebraucht. Ich halte Herrn Dr. Kornitzer zur bevorzugten Beförderung und Anstellung für besonders geeignet , hatte ihm der Landgerichtsdirektor am 15. Januar 1932 in seiner Begutachtung bescheinigt und weiter geschrieben: „Herr Dr. Kornitzer verfügt über eine scharfe Auffassungsgabe, guten Tatsachensinn, geschultes logisches Denken, die Fähigkeit knapper Darstellung und die seltene Gabe, auch verwickelte Sachverhalte klar aufzufassen und prägnant darzustellen. Er hat gründliche Rechtskenntnisse und besonders gute juristische Schulung. Insbesondere hat er sich auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausgezeichnet eingearbeitet. Dementsprechend stehen seine Leistungen weit über dem Durchschnitt und sind durchweg gut gewesen. Bes. Hervorhebung bedürfen seine nach Aufbau, Durchdringung, Klarheit und Kürze gleich ausgezeichneten Urteile. Er hat pünktlich gearbeitet. Seine Führung war gut. Auch sein Gesundheitszustand scheint gut zu sein.“ Das war ein Zeugnis zum Hinter-den-Spiegel-Stecken, ein Zeugnis, das zu allen möglichen Hoffnungen berechtigte.
Читать дальше