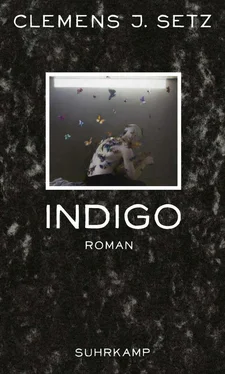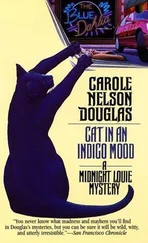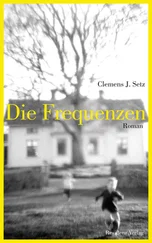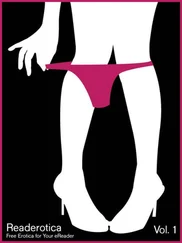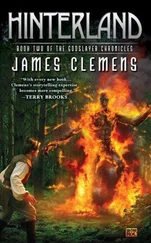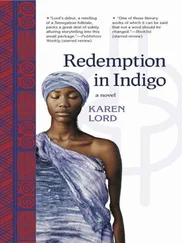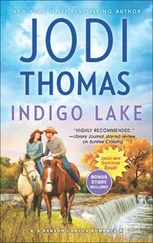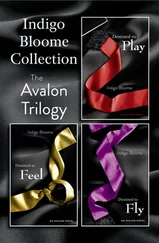Frische Luft strömte durch ein offenstehendes Fenster. Ich spürte sie angenehm an meinen Füßen. Ich hatte heute Morgen vergessen, Socken anzuziehen.
— Ferenc, wie geht’s dir? hörte ich Dr. Rudolph plötzlich fragen.
Ich hielt den Atem an. Die Tür zum Büro stand einen Spalt weit offen.
— Ja … ja … Aber biensüüüür, sagte der Direktor.
Er telefonierte offenbar.
Wo war Robert? Saß er neben ihm, während der Direktor in den Hörer brüllte?
— Ja, das Problem … Wir hatten gerade einen Zwischenfall … Ja … Ich weiß, dass ihr an ihn gedacht habt, aber er nimmt ab … seine Zone … sein Prox… ja … ja … Ach, Ferenc, du alte Sau! Warte, ich werde nur … Du kannst dich darauf verlassen, du kriegst dein Happy End … Augenblick …
Ich erstarrte, die Schritte kamen näher, hoffentlich blickte er nicht zur Tür hinaus. Also riss ich mich los und ging ein paar Schritte Richtung Gangfenster. Da sah ich Robert Tätzel, wie er draußen über den Hof ging, gebeugt. Er ließ den Kopf hängen. In der Hand hielt er einen kegelförmigen Partyhut. Wie war er so schnell … War er an mir vorbeigegangen, und ich hatte es nicht gemerkt, oder … Aber da waren die Schritte des Direktors schon direkt hinter mir, er kam aus dem Büro, ich hörte es so laut und deutlich, als hätten meine Schulterblätter Ohren, vermutlich hielt er sich den schnurlosen Telefonhörer an die Wange.
Also ließ ich mich fallen, brach zusammen, wo ich war.
— Ich ruf dich zurück! hörte ich Dr. Rudolphs Stimme.
Dann wurde ich an der Schulter berührt und angesprochen. Ich ließ die Augen geschlossen und zählte in aller Ruhe bis zehn, bevor ich sie wieder aufmachte und stammelte, mir wäre gerade furchtbar schwindlig geworden. So musste ich dem Direktor, der mir freundlich auf die Beine half, mich am Arm hielt und zur Institutskrankenschwester begleitete, nicht direkt in die Augen blicken.
This was placed here on the fourth of June, 1897 Jubilee year, by the Plasterers working on the job hoping when this is found that the Plasterers Association may still be flourishing. Please let us know in the Other World when you get this, so as we can drink Your Health.
(Zeitkapsel-Nachricht in einer Wand der Tate Britain, durch Zufall entdeckt im Jahr 1985)
Als damals das erste Kind geboren wurde, habe das Leben plötzlich einen Sinn bekommen, sagte Herbert Rauber, der Vater von Marianne Tätzel. Und jetzt, wo ein Enkelkind, Robert, da sei, habe auch das Sterben für ihn einen Sinn bekommen. Denn was sonst sei die Aufgabe eines Großvaters oder einer Großmutter, als einem jungen Menschen vorzusterben, so ähnlich wie ein Klavierlehrer seinem Schüler ein Stück vorspielt? Note für Note werde ihm nähergebracht, sowohl die kleinen Nuancen und Übergänge als auch die große Einheit der Melodie würden veranschaulicht, die Bedeutung, die Einordnung, das Maß. Man zeige ihm vor, dass es das gebe, dass dies Teil jedes Lebens sei: der Zerfall in Einzelteile. Wer vier Großeltern habe, so Herr Rauber, der lerne auch vier Tode kennen. Die vier müssten sterben, damit es ihn, den Jungen, Neuen, geben und damit er weiter hier sein könne. Also leben und sterben sie ihm vor, so gut sie eben können. Sie verhielten sich ihm gegenüber freundlich, seien meist unbedingter und bedingungsloser in ihrer Liebe zu ihm als die Eltern, ihre erzieherischen Aufgaben seien ja nur ein Spiel, eine onkelhafte Heiterkeit umgebe jeden Konflikt — und so blieben sie ihm im Gedächtnis. Und das Enkelkind lerne schon in jungen Jahren (der einzigen Zeit, in der man diese Erkenntnis noch ertrage), dass so etwas möglich und notwendig sei: eine Nachwelt, in der der tote Mensch noch immer weiterexistiert, hochgehalten wird wie eine Handpuppe, zusammengenäht aus den Erinnerungsfetzen im Gedächtnis der Leute, die ihn gekannt haben. Im besten Fall sterbe man dem Enkelkind nicht nur vor, sondern man zeige ihm gleichzeitig, wie wenig schlimm dieser letzte Akt sei, kein Anlass zu echter Verzweiflung. Und das sei bestimmt die nobelste und sinnvollste Tätigkeit, die man im hohen Alter verrichten könne. An dem Tag, da das erste Enkelkind geboren werde, wisse man, dass man sich in Zukunft Mühe geben werde, ja, man werde sich zusammenreißen, gutzu sterben, ohne großes Aufsehen, so friedlich und schmerzlos, wie es einem vergönnt sein werde, so versöhnt und lebenssatt und reif, wie es der eigene Schauspielinstinkt zulasse. Wer kein Enkelkind habe, für das er sterben könne, sei zu bedauern; für ihn gebe es keinen Trost. Denn er werde elendiglich im luftleeren Raum verrecken, ängstlich, hilflos und von allen Seiten bedrängt von dem Gefühl, dass er auf dieser Erde noch so viel zu erledigen gehabt hätte. Kein Enkelkind zu haben, sagte Herr Rauber, sei das schlimmste Defizit, das man als Mensch erleiden könne. Und der Tod eines Enkelkindes sei von allen Dingen, die im Universum geschehen, das widernatürlichste. Auch sei es ihm damals als himmelschreiendes Unrecht erschienen, als es geheißen habe, Robert solle in dieses neue Schulprojekt eingegliedert werden.
Er selber habe einen Bruder mit, nun ja, mit einer psychischen Beeinträchtigung. Johann. Er sei immer strikt gegen jede Form des Wegsperrens gewesen. Das, was man seinem Bruder angetan habe, freilich mit den menschenfreundlichsten Vorsätzen, bleibe unvereinbar mit seinem Bild von der Welt, auf der wir uns alle gemeinsam durchs Leben drehen.
Herbert Rauber war siebzig Jahre alt. Seine Stimme war ungewöhnlich hoch, beinahe weiblich. Er strahlte eine große Ruhe aus, die mich fast um den Verstand brachte. Ich saß in dem mindestens vier Meter hohen Wohnzimmer der Familie Tätzel, dem zentralen Raum ihrer blassblauen Villa in Raaba.
Raaba ist nicht viel mehr als ein an der Südseite der Stadt Graz festhängendes Dorf, mit ihr verschmolzen wie das Männchen des Anglerfisches mit dem um vieles größeren Weibchen. Eine lange Straße, links und rechts Firmenparkplätze mit Fahnenstangen, das war der erste Eindruck, den ich von dem Ort bekam.
Ich hatte mich gefragt, ob es ratsam sei, so bald nach meinem Besuch bei Frau Stennitzer, der mich noch innerlich beschäftigte, bei der Familie Tätzel aufzukreuzen. Julia meinte Nein. Ich ging trotzdem hin. Nach meiner Rückkehr aus Gillingen war ich in einer Art Erstarrung zu Hause gesessen und hatte zu verstehen versucht, was passiert war. Hin und wieder fiel ich in einen fiebrigen Schlaf und träumte von einem Schaf mit einer großen, grauen menschlichen Maske und einem Partyhut. Den Partyhut hatte ich an dem Tag gesehen, als ich Robert zur Telefonkabine begleitet hatte. Mein letzter Tag im Institut. Die Institutskrankenschwester. Bei dem kurzen Gerangel mit Dr. Rudolph im Hof hatte ich mir keine nennenswerten Verletzungen zugezogen — abgesehen vom blauen Auge, ein Glückstreffer dieses dicken, mit seinen kurzen Armen fuchtelnden Mannes. Der Chauffeur war es gewesen, der uns schließlich auseinanderzerrte. Ich hatte dem Direktor einen Schlag in den Bauch versetzt, und er krümmte sich und schien zu warten, ob er sich übergeben musste, während der Chauffeur ihm eine Hand auf den Rücken legte. Aber dann schluckte er schwer und sagte leise, dass ich unverzüglich aus dem Institut und von dem Grundstück verschwinden solle, oder –
— Oder was? Stecken Sie mich in ein Kostüm und lassen mich wegbringen?
Dr. Rudolph zeigte keine Reaktion. Aber der Chauffeur schien zu erschrecken. Er nahm seine Mütze ab und stemmte eine Hand in die Hüfte. Ich zeigte ihm den Mittelfinger. Er machte einen Schritt auf mich zu. Dr. Rudolph hielt ihn zurück — Schüler standen im Hof, die uns beobachteten. Wie Zombies in einem Horrorfilm kamen sie langsam näher, aber dann blieben sie stehen und verteilten sich.
Einige Zeit später saß ich mit zitternden Händen im Zugabteil und versuchte, Julia zu erreichen, aber sie ging nicht ran. Ich warf das Handy durchs Abteil und sammelte hinterher die Teile reumütig ein und baute es wieder zusammen. Und das alles nur wegen ein paar Fragen. Partyhut. Verkleidungen. Relokationen. Ich war ins Stammeln geraten, und es musste offensichtlich gewesen sein, wie wenig ich über die Angelegenheit wusste.
Читать дальше