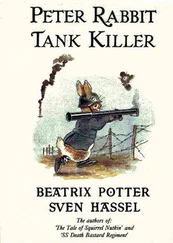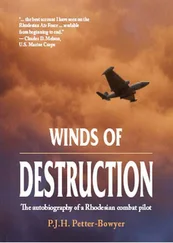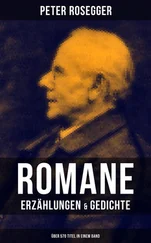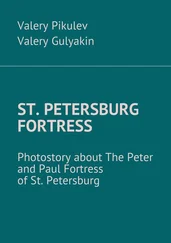Die Zeit vergeht nicht. Die Sonne gewinnt an Kraft. Schattige Plätze locken hinterm Eingang, wo Bänke stehen, Papierkörbe, Blumen in der Rabatte wachsen und auf dem vertrockneter Rasen kleine Bäumen stehen. Über die Fernstraße sausen die Autos nach Stralsund. Den Auspuffen entströmt qualmend Gestank. In den Automobilen, die an mir vorüberfahren, sehe ich zuckende Hände, gestikulierende Person. Ein Fahrzeug drosselt am Ortseingangsschild seine Geschwindigkeit, Türen springen auf, Insassen entsteigen dem Gefährt, recken und strecken sich, lassen Trinkflaschen umgehen, leeren sie mit kräftigen Zügen, um dann wieder einzusteigen, abzurauschen und wenige Minuten später an einem Strand zu sein, im Meer zu baden, sage ich mir, mit trockenem Mund, so fürchterlich allein gelassen, auf dem von Sonne überfluteten Vorplatz, Hitze und Staub ausgeliefert. Wenigstens an eine Flasche Wasser hätte die Adoptionsmutter denken können.
Es gibt hinreichende Gründe für mich, mich nach dem Krankenhausbesuch auf die Stadt zu freuen. Wir werden durch die Metropole bummeln und Schaufenster ansehen. Als dann endlich die Adoptionsmutter am Ausgangstor zu sehen ist, freue ich mich. Es kommt nicht zum Stadtbummel. Mehr als den Namen auf dem Ortseingangsschild bekomme ich von Stralsund nicht zu sehen. Schnurstracks an mir vorbei stürmt die Adoptionsmutter zur Bushaltestelle, in sichtlicher Ergriffenheit und innerlich aufgewühlt, wohl auch von Tränen gezeichnet, dass mir jedwede Frage nicht nur nicht in den Sinn kommt, sondern ich mich gezwungen sehe, ihr hurtig nachzusetzen, zumal der Rückfahrtbus naht, auf den zu sie über die Straße setzt, in den dann in Schnelligkeit eingestiegen wird. Ich sitze schneller als gedacht neben der Erregten auf dem hinteren Sitz des Busses, auf dem Weg Richtung Heimat. Die Adoptionsmutter ringt um Haltung, tupft das Taschentuch gegen die Wangen, murmelt Unverständliches in den Ärmel ihrer leichten Sommerjacke, wischt entgegen aller Erziehung des Buchs zum guten Benehmen sich quer übers Gesicht, dass die Augentusche schmiert. Ich sitze, die Beine unter den Sitz geklemmt, die gesamte Fahrt zurück still und spiele Mitgefühl, bin bockig und so stumm, nicht in Stralsund eingereist zu sein, die lange Wartezeit so umsonst auf dem Kieselvorplatz des Krankenhauses West vor den Toren der Stadt mit dem Stoßen kleiner Steinchen verbracht haben zu müssen. Ich klemme neben der Adoptionsmutter, die sich ihrer Trauer hingibt, über meinen Kopf hinweg entschieden hat, die Flucht anzutreten. Wir langen an. Wir gehen nach Haus. Die Fahrt ist aus. Es gibt nicht einmal zum Trost ein Eis im kleinen Cafe Seeblick. Niederlage will ich den Besuch im Krankenhaus Stralsund nennen, wo ich draußen vor den Toren bleibe, zum ersten Mal in Herzschlagnähe zu meiner leiblichen Schwester bin und davon nicht weiß. Seit diesem Augenblick verändere ich mich. Ich entdecke mich als denkendes Wesen und beginne, mich systematisch aus dem Adoptionsverhältnis zu lösen. Genug ist nicht genug. Die Adoptionseltern sind nicht mehr als Götzenbild anzubeten. Ich begehre auf, die Mutterseele in mir zu retten, den Kult zu zerstören, der mich behindert, mir die Zukunft verstellt und Krämpfe bereitet, die mich eines Tages erledigen werden. Ich will mich mit dem Blut der Mutter nähren, mir alle Angst vor der Nähe zu ihr ausreden, die Hölle auf Erden betreten, wenn in ihr die Möglichkeit besteht, die eigene Mutter dort zu besuchen, um mich von ihr zu befreien und von der Sehnsucht nach der Mutter zu reinigen. Bis ich sie treffe, die richtige, die eigene Mutter, mein Fleischblut, wird mein Zuspruch für die mich beherrschende Realität stetig schwinden; gleichgültiger ist nur noch das lose Blatt im Wind. Wo ich mich auflehne, verliert die Adoption an Boden und der Adoptierte gewinnt Land unter seinen Füßen.
Dein Pochen, guter Rabe, wovor warnt es mich? Du sollst die Mutter nicht aufsuchen, ist die ewige Antwort. Ich mache mich bereit meint, ich richte mich darauf ein, gegen die Adoption zu sein; ein Entschluss, der geheim gehalten werden muss, soll der große Plan am Ende gelingen, ich mich der Adoption entwinden, dem unguten Klima entkommen. Ich entwinde mich der Muttersehnsucht. Ich will in keinen Schoß zurückkehren. Ich bin bereits unterwegs. Ich löse mich von den Sachzwängen. Ich gerate weg von mir auf mich zu, um endlich zu mir zu finden. Die Adoptionsmutter ist längst zu weit in Notlügen verstrickt, als dass sie den Rettungsanker wirft, den nötigen Schnitt machen kann, sich von den Mutter- und Vaterlügen zu lösen. Darüber, woher ich komme, wer ich bin, wo eventuell die Eltern hin verschwunden sind, ist der Mantel des eisigen Schweigens geworfen. Still ruht der See, die Vöglein schlafen, ein Flüstern nur, du hörst es kaum, der Abend naht und senkt sich nieder, still ruht der See, durch das Gezweig, der Schweigeodem weht, das Blümlein an dem Seegestade, stummt das Schweigegebet, die Sterne friedsam niedersehen, oh Kinderherz, gib dich zufrieden, du sollst in Schweigen gehen.
Wir alle, die wir träumen und denken,
sind Hilfsbuchhalter in einem Stoffgeschäft,
wir schließen Bilanz, und der unsichtbare Saldo
spricht immer gegen uns.
Pessoa
JAHRE SPÄTER FÄLLT mir ein entscheidendes Schreiben in die Hände. Ein Brief, nicht an mich adressiert, kommt mir verdächtig vor. Ich nehme ihn an mich, halte den Umschlag über Wasserdampf, entnehme ihm das Schreiben, lese den Inhalt und fasse den Entschluss, ihn ganz für mich zu behalten und selbst zu beantworten. Im Namen der Adoptionseltern antworte ich dem Krankenhaus auf seine Anfrage, ohne die Adoptionseltern in Kenntnis zu setzen. Leichten Herzens und voller guter innerer Gemütsbewegung schreibe ich dem Krankenhaus; nehme die Geschicke des Adoptionshauses in die Hand, übe Rache an der Adoptionsmutter, die mit mir nicht in die Stadt Stralsund gefahren ist und mir die Schwester vorenthalten, bösartig verschwiegen, mich draußen vor den Toren des Krankenhauses warten lassen hat. An der kleinen Reiseschreibmaschine mit dem schönen Namen Kolibri sitze ich, dem Krankenhausleiter in Stralsund dahin gehend Bescheid zu schreiben, dass die Adoptionseltern bereit sind, meine Schwester umgehend aufzunehmen, sie ihnen mehr als willkommen ist im so erwartungsvollen Hause.
Aufhebung nach Volljährigkeit des Angenommenen Ist der an Kindes Statt Angenommene volljährig geworden, so kann das Staatliche Notariat in besonderen Ausnahmefällen auf gemeinsamen Antrag des Annehmenden und des Angenommenen die Annahme an Kindes Statt aufheben. Wurde das Kind durch ein Ehepaar angenommen, kann der Antrag nach dem Tode eines Ehegatten von dem Angenommenen und dem überlebenden Ehegatten gestellt werden.
VON DEN BERUFEN, die mir in der Kindheit vorschwebten, erinnere ich mich an Kosmonaut, Zirkusclown, Tiefseetaucher, Koch. Schriftsteller war nicht dabei. Schriftsteller wäre ich nach dem Willen der Adoptionsmutter geworden. In der Hoffnung, meine Texte würden veröffentlicht, zum Buch werden. In der Vorfreude, ich würde bald aus dem Buch vorlesen, lesend durch die Lande kommen, in ferne Gegenden und andere Städte. Dafür setzte sie eine Weile ihre Person ein, aber nie alles auf eine Karte. Der Adoptionsvater sprach von vergeblicher Kunst. Die Adoptionsmutter schwor ab, beugte sich für das große Ganze, die Einheit der Familie und wollte mich lieber zum Lehrer gemacht sehen. Wir haben im Heim keinen Berufswunsch geformt. Wir sagten uns, dass wir niemals Heimleiter und nie Erzieher werden wollen, das genügte uns. Ich denke, ich wollte eine Zeit lang Schiffskoch werden. Das war um die Jahre, als ich zum Test bei der Köchin zu Gast im Hause gewesen bin. Sie hat mir davon geschwärmt, wie es sei, mit dem Schiff um die Welt zu fahren. Besser als der Kapitän habe es der Koch an Bord. Und werden die Lebensmittel noch so rar, der Koch verliert nicht einen Gramm seiner Fülle, sagte sie. Als mich die Köchin ins Heim zurückbringt, geht auch mein Berufswunsch über Bord, wie man sagt. Ich bin im Leben nicht sonderlich zielstrebig, was ein Berufsleben anbelangt. Ich stehe über viele Monate an einem Säurebottich in einer Fließbandfabrik, hebe glitschige Bildröhren aus dem Band, tauche sie ins Becken, entferne die Beschichtungen, ätze sie weg, schneide mir durch den Gummihandschuh ins Daumenfleisch, verätze mir den Daumen, der dick wird wie eine Gurke, beende das Arbeitsverhältnis, werke in einem Kinderkrankenhaus, wo die Krankenschwestern die Kinder ans Bettgestell binden, wenn sie Ruhe haben wollen und Kaffee trinken. Ich befreie die Kinder immer wieder, bis sie mich deswegen entlassen, ich erstatte Anzeige, beschmutze das feine Nest, bis mir versprochen wird, dem Sachverhalt nachzugehen. Ich trage ein Jahr lang Telegramme aus. Ich arbeite über ein Jahr lang in einer Tischlerei, transportiere mit einem rumänischen Tischlereilaster Holzteile, Türen, Fenster, Balken, bin nach dem Job als Kellner in Zügen unterwegs und fasse im zehnten Arbeitsjahr den Entschluss, Schriftsteller zu werden, mit allen Folgen einer freien Existenz, um eines Tages über meine Mutter zu schreiben. Den Titel Rampenwart für meinen letzten Job im Leben haben sie eigens meinetwegen erfunden. Ich werde als halber Rausschmeißer entlöhnt.
Читать дальше