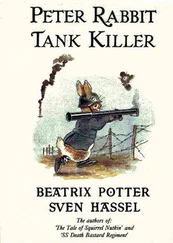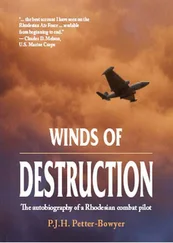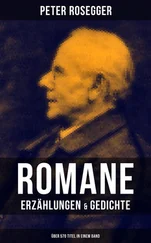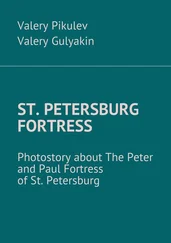Ich verreise mit dem Vati nach Halle an der Saale. Wie schön, sagt die Nachbarin, so einen Vati hat nicht jedes Kind, da wird die Mutti wohl zu Hause nicht lange auf eine Karte aus dem schönen Chemiestandörtchen warten müssen. Und alle Bekannten wissen, wie ich mich auf die Reise mit dem Vati freue, der Vati wird es schon machen, die Mutti hütet das Heim, valeri. Ich soll mit dem Vati schöne Fotos machen, die dann die Mutti ins Album kleben wird, weil sich auf der Welt die Muttis über schöne Fotos von der Reise am meisten freuen. Und dann bringt mich die Mutti mit dem Vati zum Bus und später reisen Vati und Mutti mit mir in dem Bus nach Wismar. Und wenn ich allein wegfahren darf, wird der Vati nicht mit zur Bushaltestelle kommen, sondern die Mutti und die Großmutter werden mich zum Bus bringen und dort verabschieden. Der Vati kommt nur mit, wenn die Mutti das vom Vati verlangt. Der Vati weigert sich auf seine Art, sagt, er habe zu tun, müsse Schularbeiten korrigieren. Und kann er sich nicht herausreden, muss er mithangen und ist eingefangen, um am Bus einen würdigeren Eindruck zu liefern, und liefert nur kurzes Kopfnicken, das die Mutti ärgert. Die Mutti mag Abschiede des Abschiedskusses wegen. Die Mutti leidet darunter, dass der Vati dem Jungen keinen Abschiedskuss gibt. Und macht der Vati sich auf eine Reise, müssen wir alle am Bus stehen, und die Mutti ruft dem Vati zu: Ja, will denn der Vati der Mutti keinen Abschiedskuss geben? Und hält dem Vati die Wange für den Abschiedskuss hin. Aber der Vati will nicht und ist dann in den Bus verschwunden. So macht man das, sagt die Mutti zum Vati, nimmt mich her, will, dass ich mich ihrer Kusswange nähere, sie küsse, meine Lippen zumindest auf Muttis Wangenhaut drücke. Ich setze meine Lippen auf die fettcremige Wange der Mutti. Ich würde lieber ein Massai sein, der dem Besucher in die Hand spuckt, an der Hand des Besuchers riecht, und niemand stört sich an meinem Benehmen, wie man sich in Tibet nicht am Tibetaner stört, streckt er dem Fremden seine Zunge entgegen und tippt mit dem Finger seiner linken Hand hinterm Ohr tickend an den Kopf, als würde er dir einen Vogel zeigen. Ich riebe viel lieber dem neuseeländischen Maori die tropfende Nase, als mit meinen Lippen in Mutticreme zu versinken. Mit steigendem Alter berühre ich die Wange der Mutti immer weniger, meide den Muttikuss, wo ich ihn nur meiden kann. Wie ich versucht bin, nicht Mutti und Vati zu sagen. Aus Mutti wird Mutt und Mu, aus Vati Vat und Va und später kommt da kein Vatimutti mehr über meine Lippen, nur noch ein wie Vati oder Mutti klingendes Brummein. Es wäre doch wohl das Mindeste, was sie einem abverlangen könne, was ihr zustünde, sagt sie, geküsst zu sein und als Mutti angeredet zu werden. Das kleine Opfer werde ich doch aufbringen, ich könnte mit dem Bus verunglücken, was sie mir nicht und keinem Menschen wünscht, und stürbe ohne Abschied und Kuss, den sie Küsschen nennt.
Ich sehe keinen Menschen je zu uns herüberblicken, um sich daran zu ergötzen, wie das Adoptivkind sich von seiner Adoptionsmutter verabschiedet. Es ist den Leuten vollkommen unwichtig. Ich vermeide in der Schule, wo ich einige Male vertretungsweise auch vom Adoptionsvater unterrichtet werde, Vati zu ihm zu sagen. Ich räuspere mich, schnippe mit den Fingern, um seine Aufmerksamkeit zu erregen und nur nicht Vati oder gar Sie zu ihm zu sagen, den ich sonst ja duze und zu Hause nicht einmal Vati nennen brauche. Es ist für mich kein Werden und Glücklichsein, wo stets Äußerlichkeit und Anstand zu beachten sind, die Oberschenkel übereinandergeschlagen, Ellenbogen nicht aufs Tischtuch gehören, man sich nie lümmeln darf. Ich schwärme für Malcolm X, wovon die Familie nichts weiß. Einer wie Malcolm X gibt der Mutti keinen Abschiedskuss mehr, Malcolm hat sich niemals von seiner Mutti zwingen lassen, am Pilgerreisebus nach Mekka ihr die fettige Cremewange zu küssen. Malcolm X wäre, von seiner Mutti zum Abschiedskuss gezwungen, nicht Malcolm X geworden. Ich sitze im Bus am Fenster, weiß die Adoptionsmutter draußen, weiß, dass sie zu mir schaut und will, dass ich ihr durch die Scheibe winke und Handküsse zuwerfe. Ich mache das eine Zeit lang. Aber dann schaue ich nicht mehr gerne zu ihr hin, spiele Neugierde, blicke zur anderen Seite, nach hinten und konzentriert in Busfahrtrichtung, um nur nicht winken zu müssen. Später versuche ich die Adoptionsmutter abzuwimmeln, indem ich sage, dass ich längst groß genug wäre, dass man mich nicht zum Bus bringen müsse, dass ich den kurzen Weg gut und gerne allein schaffe, dass die anderen Kinder schon abfällig reden, was die Mutti nicht abhält, weiterhin zum Bus zu kommen. Was ist schon dabei, wenn zwei sich küssen, da ist doch nichts dabei, das kann ruhig jeder wissen, weil es sich so gehört, wie sie betont, dass die Leute nichts Falsches denken. Und hält dem Jungen noch lange die cremige Wange hin, bis ich mich ihrer zu erwehren weiß, die Großmutter ins Spiel bringe, von ihr zum Bus gebracht werden will, die nicht von mir geküsst sein will, nur gute Miene macht und den Rückweg antritt, kaum dass der Bus zu sehen ist. Die frische Luft, sagt sie, tue ihr gut. Der Großmutter genügt, dass ich sie, wenn mir danach ist, kurz umarme und Tschüss zu ihr sage. Die Großmutter lacht herzlich auf, bin ich versucht, ihr scherzhaft einen angedeuteten Kuss zu senden; und findet albern und zuckt zurück, hat, wie sie sagt, wohl lange vor dem Krieg mal einen Kuss zum Abschied bekommen und kann sich nur dunkel daran erinnern; weiß nicht einmal mehr, ob oder wie er und sie sich je geküsst haben, ihr im Krieg gefallener Mann, der so wenig ein Küsser gewesen ist wie sie eine Küsserin und der ohne Gruß und Kuss aus ihrem Leben geschieden ist.
Mein Vater, mein Großvater, was haben sie gesehen? Sie lebten jeder ihr Leben in der Einform. Ein einziges Leben vom Anfang bis zum Ende, ohne Aufstiege, ohne Stürze, ohne Erschütterung und Gefahr, ein Leben mit kleinen Spannungen, unmerklichen Übergängen; in gleichmäßigem Rhythmus, gemächlich und still, trug sie die Welt der Zeit von der Wiege bis ins Grab. Sie lebten im selben Land, in derselben Stadt und fast immer sogar im selben Haus; was außen in der Welt geschah, ereignete sich eigentlich nur in der Zeitung und pochte nicht an ihre Zimmertür. Stefan Zweig in: Die Welt von gestern.
ICH WERDE MEIN EIGEN NICHT. Ich bleibe ein Pseudonym. Ich bleibe für mich, lebe unter dem falschen Namen der Adoptionseltern, den ich ertragen will, bis ich groß genug bin und in einem Alter, den Adoptionsmantel abzulegen. Mit über fünfzig Jahren erst lege ich den Mantel der Adoptionszeit ab, trage meine künstliche Haut zu Grabe, nehme innerlich den Namen der Mutter, des Vaters an, den Namen, wie er in meiner Geburtsurkunde eingetragen worden ist, von Heim zu Heim getragen, durch die Adoption dann ad acta gelegt, um nicht mehr in der namentlichen Hülle der Adoptionseltern wie in einer Zwangsjacke zu stecken und unter falschem Namen beerdigt zu sein. Ich empfinde mich mit dem Adoptionsnachnamen unter fremder Flagge unterwegs. Ich sollte unterm falschen Namen neue Wege eröffnet bekommen und habe mich gegen ihn benommen, mir Wege verbaut, die Tore rücksichtslos zugeschlagen, durch die ich als Heimkind hätte nie gehen können, weil die Adoptionsmutter mich nicht zur Schwester nach Stralsund geführt hat zum Beispiel, und ich nicht mit der Schwester an der Hand dann zur Mutter, zum Vater aufbrechen konnte. Ach, Schwesterlein, wann gehn wir nach Haus, morgen, wann die Hähne krähn, wollen wir nach Hause gehen, ach Brüderlein, gehen wir nach Haus, ach, Schwesterlein, wie bist du so blass, dieses macht der Morgenschein mir auf meinen Wängelein.
Im Heim hätte man mich informiert, würde ich nach Verwandtschaft gefragt haben. In der neuen Familie herrschte Mutterverschweigen. Mir ist ein Dach aus Schweigen über meinem Haupt gezimmert worden. Das Schweigen deckte alle Tatsache zu. Ich erfuhr nicht, dass unweit von uns an derselben Ostseeküste meine Schwester lebt. Schweigen deckte mich zur Nacht zu. Schweigen erweckte mich am Morgen. Ich wusch mich mit dem Wasser und der Seife des Schweigens. Ich lebe unter fremdem Namen und ich esse Schweigen zu meiner Person als Morgenbrot und bekomme Schweigen als Mittagsmahl vorgesetzt, zum Abend hin ist mir ihre Verschwiegenheit dick aufs Butterbrot geschmiert. Ich werde im Stoff des Schweigens eingekleidet und habe mich in Jacke wie Schuh, Hose wie Weste und unterm lustig anmutenden Pudel auf dem Kopf als Persona non grata in der Hülle des Schweigens wohlzufühlen. Ich bekomme einen neuen Namen und verliere mit ihm meine Unverletzlichkeit. Ich lebe unter falschem Namen. Ich werde durch die Adoptionseltern diplomatisch vertreten, sie nehmen an meiner Stelle Aufgaben wahr, die mich als Heimkind entrechten. Ich werde Gast in ihrem Staate. Ich habe das Kinderheim nach ihrem Willen nicht mehr zu betreten. Sie sind ab nun das gastgebende Land und fühlen sich ermächtigt, über meinen Kopf hinweg das Kinderheim zum Sperrgebiet zu machen. Jeden Besuch des Heimes meinerseits werten sie als Grenzverletzung. Geben vor, mich gegen Beschädigungen durch Heimkontakt zu Heimkindern zu schützen. Ich möchte ausbrechen und sitze in ihrer Botschaft als alleinige Geisel fest.
Читать дальше