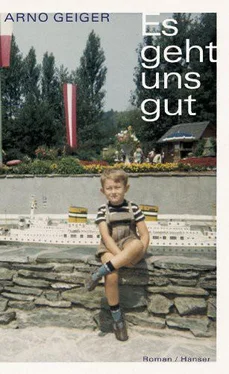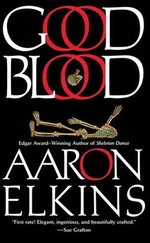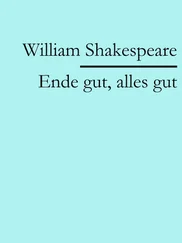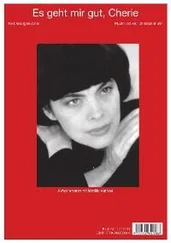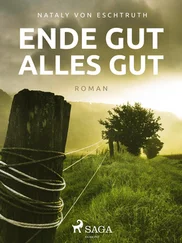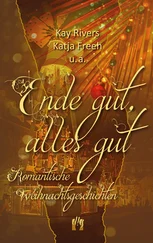— Um es genau zu sagen, an einer Eichelverzierung dieses Samowars.
— Ist nicht möglich, sagt Philipp.
— Kein Zweifel, insistiert der Freund: Während Potocki mit Freunden Tee getrunken hat. Von einer Kanonenkugel kann nicht die Rede sein.
— Ausgerechnet. Ein Samowar. Eine Eichelverzierung.
Doch was der Freund sagt, klingt überzeugend, er hat, wie er behauptet, das ganze Buch gelesen, beide Bände, das Vorwort, das Nachwort und weiß der Kuckuck was noch, während Philipps Quellen diffus sind (wie die der Donau). Alles mutmaßlich und nichts gewiß. Er kann sich nur darauf hinausreden, daß Potocki gegen die Ungenauigkeit bestimmt nichts einzuwenden hätte.
— Ernsthafte Arbeit, so oder so, sagt Philipp und bringt das Gespräch zu einem raschen Ende.
Im stillen und aus Gründen, die mit den Fakten nichts zu tun haben, steht Philipps Entschluß, auf der Version mit der Kanonenkugel zu beharren, in dem Moment ohnehin schon fest; als kleine Huldigung an die Gebrechlichkeit der Welt, die jeder sich zusammenbaut. Der Gedanke an das beharrliche Feilen ist anschließend zwar nicht mehr derselbe, weil Fakten das Hartnäckigste sind, was man sich vorstellen kann. So sagt man. Es bekümmert Philipp, daß auch diese Geschichte nicht wahr ist oder in Wahrheit nicht so, wie er es will. Aber er leistet Widerstand, er stemmt sich dagegen.
Und später, als er wieder auf der Vortreppe sitzt (gegen die Sonne blinzelt, auf einen Anruf von Johanna wartet, der er keinesfalls zuvorkommen will), hat er sogar einen lichten Moment. Da versöhnt er sich mit all diesen Kleinigkeiten, die so sehr ins Gewicht fallen. Da fühlt er sich einen Moment lang erhaben über den trostlosen Ehrgeiz der Faktentreue. Denn auf der Vortreppe gehört alles ihm. Dort ist er alleiniger Besitzer des Wetters, der Liebe, des polnischen Grafen, aller Tauben auf dem Dach und einer großen Einsamkeit. Er sagt sich: Wenn einer mit einem Ballon über dem Haus stünde und in meine Länderei schaute, was würde er dann von mir denken? Er würde hoffentlich einen sehr günstigen Eindruck von mir gewinnen, und ohne darauf bestehen zu wollen, ist doch anzunehmen, daß ich ( trotzdem bleibt das wichtigste Wort) ausreichend Anlaß gäbe, von ihm beneidet zu werden.
Und während er so brütet und während er sich wünscht, daß Johanna besagte Ballonfahrerin wäre auf der Suche nach dem Wetter von morgen, fällt die Asche seiner Zigarette, an der er, wie meistens, in sehr unregelmäßigen und langen Abständen zieht, von selbst. Er schiebt die Asche mit der Schuhspitze dort, wo eine Assel kauert, in eine Mulde, wo die verputzte Oberfläche der untersten Stufe abgeschilfert ist.
Im Rauch des letzten Zuges legt er dem jungen Stanislaus folgende Worte in den Mund:
— Fragen kann man sich vieles. Es ist auch schön, daß man manches denken kann. Aber das ist auch schon wieder alles.
Er befindet sich im Dunkelsteiner Wald, tastet mit aufgestellten Lichtern die zurückweichenden und sich wieder aufbäumenden Straßenränder ab, an jeder Kreuzung auf dem brüchigen Fahrdamm rangierend, er wüßte gerne, wohin die Hinweisschilder gekommen sind und wer die wenigen vorhandenen Schilder verdreht hat und wofür das Bezahlen von Steuern gut sein soll, wenn nicht einmal auf die Beschilderung der Straßen Verlaß ist, und ob unter den neuen Herren vielleicht doch alles besser wird, breitere Straßen, hellerer Mond, bessere Orientierung. Auch die Grenzen der Phantasie haben sich unter dem Druck der Übermacht verschoben: Das große Reich der Ordnung und Gerechtigkeit hebt an. Na ja, denkt er, vorstellbar ist vieles, auch das Unwahrscheinliche, doch muß man von dem ausgehen, was wahrscheinlich ist, weshalb er an die nationalsozialistische Verheißung nicht recht glauben kann. Von glauben wollen ist noch nicht einmal die Rede. Klüger wäre es (zumindest träte der gewünschte Effekt verläßlicher ein), wenn er sich so schnell nicht wieder zu einer derartigen Zusammenkunft überreden ließe. Wobei: Ablehnen wäre auch schwer möglich gewesen aufgrund der Dienstreise und der zufälligen Anwesenheit in der Gegend. Die glücklose Suche nach einer halbwegs plausibel klingenden Ausrede hat ihn verlegen gemacht, so daß er sich kurzerhand zusagen hörte. Selbstverständlich werde er, allein aus Verbundenheit mit den werten (bedauernswerten) —.
(Stille.)
— Und wo genau soll das stattfinden?
Also ist er den Vertretern des niederösterreichischen Bauernbundes nach Ratzersdorf gefolgt, einem Flecken nördlich von Sankt Pölten, wo behördliche Störungen nicht zu befürchten sind, wie es hieß. Und alles wegen Geldangelegenheiten, um die Versorgung der Familien jener christlichsozialen Gesinnungsgenossen sicherzustellen, die seit dem Einmarsch in Dachau angehalten werden und von denen niemand vorherzusagen weiß, wann sie wieder freikommen. Richard versprach einen namhaften Betrag, und weil er dank dieser Zusage abkömmlich war, hielt ihn niemand zurück, als er sich verabschiedete, noch ehe er sein Bier getrunken hatte. Das war ihm dann auch wieder nicht recht. Wenigstens ein paar höfliche Einwände hätte er gerne gehört.
Jetzt irrt er seit gut einer halben Stunde durchs nächtliche Land, zwischen kleinsten, in Feldschneisen geduckten Ansiedlungen ohne jegliche Straßenbeleuchtung (was für ein Marktpotential, durchfährt es ihn). Wie Hasen springen die Häuser durchs Licht und zurück in die Deckung, wo man die Hand vor Augen nicht sieht. Von Bewohnern kein Zeichen, keine Menschenseele, alle im Bett. Das Kreuz schmerzt Richard, so spannt er den Oberkörper über den Lenker, den Hals langgestreckt, damit der Blick hinter den hastigen Scheinwerfern nicht zurückbleibt. Als an einer größeren Kreuzung wieder nur ein blecherner Pfeil mit Krems , aber nicht Sankt Pölten aus der Schwärze durchs Licht ruckt, nimmt er entnervt den Weg dorthin, weshalb er Wien erst kurz vor Mitternacht erreicht.
Lediglich Frieda ist noch auf, das Kindermädchen (das Hausmädchen, das Mädchen für alles). Sie sitzt in der Küche an dem mit Blech überzogenen Arbeitstisch und schreibt an einem Brief. Während sie ihre Schleifen malt, murmelt sie jedes Wort Silbe für Silbe vor sich hin. Richard, am Treppenabsatz, den Hut in der Hand, versucht mit schräggeneigtem Kopf aus dem in die Diele dringenden Gemurmel einzelne Wörter herauszulösen. Er horcht angestrengt, dabei wird ihm bewußt, daß man Wünsche haben kann, die einander direkt widersprechen: Den Wunsch, Alma nicht zu betrügen, und den Wunsch, in die Küche zu gehen und das Kindermädchen aufzufordern, den Brief später zu Ende zu schreiben. Er besinnt sich darauf, wie Frieda am Nachmittag vor seiner Abreise im Garten eine Decke ausgebreitet und sich in die Sonne gelegt hat, um im Freien den Schlaf nachzuholen, der ihr in der Nacht zuvor entzogen worden war. Sie schmierte sich mit Creme ein, und solange sie damit beschäftigt war, hatte Richard sie betrachtet, ihre kurzen dunkelblauen Hosen, das bunte, quergestreifte Ruderleibchen und das weiße, auf beiden Seiten verknotete Tuch am Kopf. Vorne ließ das Tuch einen Teil der roten Haare sehen, den Stolz der ganzen Person, auf der rechten Seite schaukelten die verknoteten Enden des Tuches vor Friedas kräftigen Brüsten. Jetzt, in der Erinnerung, kommen ihm ihre Brustwarzen wie runzlige Stielaugen vor, die ihm mit seltsamem Grimm über Tage hinweg und auf Umwegen über Ybbs und Ratzersdorf nachsehen bis hierher.
Was geschieht? Was in den letzten Monaten viel zu oft geschehen ist: Daß sich der Vizedirektor der städtischen Elektrizitäts-Werke mit einer Hutblume unmöglich macht, Dr. Richard Sterk, Ende dreißig, doch kraft seines Amtes und seiner Würde ein gereifter Mann, der um sein Versagen weiß und trotzdem nicht in der Lage ist, dem Ganzen ein Ende zu machen. Er kommt von diesem Mädchen nicht los, obwohl es allerhöchste Zeit wäre. Sooft er den Beschluß faßt, daß es das definitiv letzte Mal sein wird oder gerade ist oder war, so oft sehnt er den Augenblick herbei, an dem er erneut mit Küssen über diese kinderspeckige Weinviertler Molligkeit herfällt. Er will es und will es gleichzeitig nicht. Bereits mit dem warmen, rauhen Kleid in der einen Hand, wenn er unter Friedas Achseln riecht, wenn er mit der anderen Hand die Speckröllchen streichelt, dort, wo der Büstenhalter einschneidet (der rote Büstenhalter, der auf der Vorderseite heller ist als auf der Rückseite): Wenn er diesen BH öffnet und Friedas weiße Brüste herausquellen und Frieda ihm währenddessen die Namen ihrer zwölf Geschwister psalmodiert: Da schwört er dem Mädchen heftig ab, so wahr ich hier stehe, um es kurz darauf ebenso heftig zu nehmen. Diesmal dreht er sie herum, sie beugt sich bereitwillig nach vorn und die Sommernacht und das Zirpen der Heuschrecken und die Dünste der Küche und das Knallen einer Fliege am gekippten Fenster — und — und — die wie von einer obszönen Feuchtigkeit glänzenden Ausläufer von Friedas durchgebogenem, durchgedrücktem Rücken im Licht der Deckenlampe und das Erlöschen der Glanzpartikel, als Richard sich nochmals nach vorn beugt, um Friedas dicke Brüste zu berühren. Dann, mit den Händen ihre Hinterbacken auseinander- und hochschiebend, während Frieda in ihr rechtes Handgelenk beißt, weil ihr gerade ein Stöhnen ausgekommen ist, stößt er hastig in diese wohlig warme, hinter dem borstigen Haarbüschel versteckte Höhle hinein, von alles überflutender Lust getrieben und von nicht minder heftiger Reue geplagt. Mit dem beunruhigenden Unterschied, daß die Lust hinterher rasch abklingt, die Reue jedoch bleibt. Die Reue kommt mit, als Richard sich mit angehaltenem Atem neben Alma ins Bett schiebt. Sie nimmt nicht ab mit dem Rasierschaum, den Richard sich in der Früh aus dem Gesicht schabt, und sie bohrt in seiner Magengrube, während er im Amt telefonisch mitteilt, daß er an diesem Tag nicht kommen werde, weil er die Dienstreise genausogut daheim aufarbeiten könne. Das trifft sogar zu, ist ihm normalerweise trotzdem kein hinreichender Grund für eine englische Woche. Vielmehr hat er beschlossen, diesen Samstag mit Alma und den Kindern zu verbringen und nebenher einen Weg ausfindig zu machen, wie unauffällig beendet werden kann, was nie hätte beginnen dürfen. Er will nicht den Rest seines Lebens in solcher Unordnung verbringen, das fällt ihm nicht im Traum ein. Oft empfindet er eine solche Abscheu gegen sich, und weil er Abscheu gegen sich empfindet, auch eine Abscheu gegen Frieda, daß es ihn Überwindung kostet, sich im eigenen Haus von einem Zimmer ins nächste zu bewegen. Ich darf kein Doppelleben führen, ermahnt er sich beim Mittagessen. Das wiederholt er einige Male zur Bekräftigung, skandiert es mit je einem Löffel Frittatensuppe: Ich darf kein Doppelleben führen . Aber am Ende weiß er nicht, ob ihn der Gedanke schreckt oder — noch schlimmer — ob es ihm schmeichelt, daß ihm dieses Doppelleben seit fünfeinhalb Monaten, seit Ende Februar, besser (wenn auch nicht leichter) von der Hand geht, als er es sich zugetraut hätte.
Читать дальше