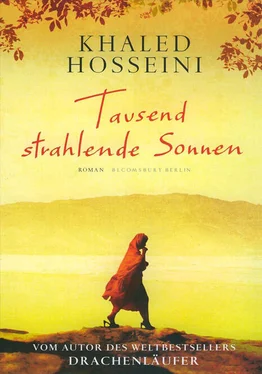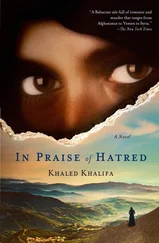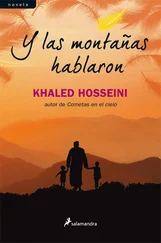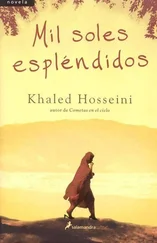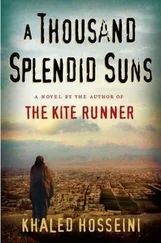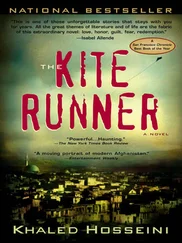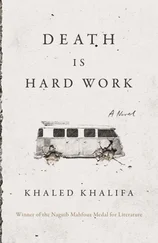Raschid tippte ihr auf die Schulter und reichte ihr etwas.
»Hier.«
Es war ein dunkelbrauner Seidenschal mit perlenverzierten Fransen und goldener Saumstickerei.
»Gefällt er dir?«
Mariam blickte zu Raschid auf und war von seiner Reaktion gerührt. Er blinzelte und wich ihrem Blick aus.
Sie dachte an Jalil und die auftrumpfende Art, mit der er sie immer beschenkt und so sehr eingeschüchtert hatte, dass sie nur ein zaghaftes Danke hervorbringen konnte. Nana hatte recht, was Jalils Geschenke anging. Sie waren halbherzige Zeichen von Reue, unaufrichtige Gesten, mit denen er weniger ihr als sich selbst einen Gefallen zu tun und Abbitte zu leisten versuchte. Dieser Schal dagegen war ein wahres Geschenk.
»Er ist wunderschön«, sagte sie.
Am Abend desselben Tages besuchte Raschid sie wieder in ihrem Zimmer. Aber anstatt im Türrahmen stehen zu bleiben und zu rauchen, kam er herein und setzte sich zu ihr aufs Bett. Die Federn knarrten, und das Gestell neigte sich unter seinem Gewicht.
Er zögerte einen Moment, schob ihr dann seine Hand in den Nacken und fuhr mit seinen fleischigen Fingern über ihre Halswirbel. Mit dem Daumen strich er über das Schlüsselbein, die Höhlung darüber. Mariam fing zu zittern an. Die Hand drängte tiefer. Die schartigen Fingernägel verhakten sich im Baumwollstoff ihrer Bluse.
»Ich kann nicht«, krächzte sie und starrte in sein vom Mondlicht beschienenes Gesicht, auf die massigen Schultern, die breite Brust und das aus dem Kragenausschnitt wuchernde dichte graue Haar.
Seine Hand lag jetzt auf ihrer rechten Brust und drückte zu. Sie hörte ihn tief durch die Nase einatmen.
Er schlüpfte zu ihr unter die Decke. Sie spürte, wie er sich zuerst am eigenen Gürtel und dann an der Kordel ihrer Hose zu schaffen machte. Sie selbst verkrallte die Finger im Laken. Er wälzte sich auf sie, rutschte hin und her. Mariam schloss die Augen und biss die Zähne aufeinander.
Der Schmerz kam plötzlich und überraschend heftig. Sie riss die Augen auf, schnappte nach Luft und biss sich auf den Knöchel des Daumens. Sie schlug mit dem freien Arm aus, bekam Raschids Hemd am Rücken zu fassen und zerrte daran.
Raschid hatte sein Gesicht in ihrem Kissen vergraben, während Mariam mit weit aufgesperrten Augen an seiner Schulter vorbei an die Decke starrte, seinen heißen Atem im Nacken spürte und am ganzen Körper zitterte. Die Luft zwischen ihnen roch nach Tabak, Zwiebeln und dem gegrillten Lammfleisch, das sie zum Abend gegessen hatten. Als seine Wange ihre Ohrmuschel streifte, bemerkte sie, dass er sich rasiert hatte.
Als es vorbei war, ließ er keuchend von ihr ab, wälzte sich zur Seite und legte den Unterarm auf die Stirn. Im Dunkeln sah sie die blau leuchtenden Zeiger seiner Armbanduhr. Für eine Weile lagen beide reglos Seite an Seite auf dem Rücken, ohne einander anzusehen.
»Du brauchst dich für nichts zu schämen, Mariam«, sagte er mit leicht schleppender Zunge. »So etwas machen Mann und Frau, wenn sie verheiratet sind. Das haben selbst der Prophet und seine Frauen gemacht. Es ist nichts Schlimmes dabei.«
Bald darauf schlug er die Decke zurück, stand auf und ging. Zurück blieben für sie der Schmerz im Unterleib, der Anblick am Himmel festgefrorener Sterne und eine Wolke, die wie ein Brautschleier den Mond verhüllte.
Es wurde Ramadan im Herbst des Jahres 1974. Zum ersten Mal erlebte Mariam, wie der Anblick der neuen Mondsichel eine ganze Stadt verändern konnte und Einfluss nahm auf Zeit und Stimmung. Über Kabul breitete sich schläfrige Stille aus. Der Straßenverkehr ließ nach, die Märkte leerten sich, die Restaurants drehten ihre Lichter aus und schlossen die Türen. Auf den Straßen war niemand zu sehen, der rauchte oder ein dampfendes Glas Tee in der Hand hielt. Zur iftar -Stunde, wenn die Sonne im Westen unterging und die Kanone auf dem Berg Shir Darwaza donnerte, brach die Stadt ihr Fasten mit Brot und einer Dattel. So auch Mariam, die zum ersten Mal in den fünfzehn Jahren ihres Lebens die angenehme Süße eines gemeinschaftlichen Erlebnisses schmeckte.
Raschid hielt sich nur einige wenige Tage an die Fastenvorschriften, und wenn er es tat, wurde er übellaunig. Hunger machte ihn schroff, gereizt und ungeduldig. Als Mariam eines Abends etwas länger für die Zubereitung der Mahlzeit brauchte, fing er an, Brot und Rettich zu essen, und als sie ihm dann Reis, Lammfleisch und ein Okra- qurma vorsetzte, rührte er es nicht an. Ohne ein Wort zu sagen und mit vor Wut angeschwollenen Adern an den Schläfen kaute er sein Brot und starrte vor sich hin. Als Mariam ihn ansprach, schaute er durch sie hindurch und steckte ein weiteres Stück Brot in den Mund.
Mariam war froh, als der Fastenmonat endete.
Damals in der kolba war Jalil immer am ersten der drei Tage des Zuckerfestes Eid-ul-Fitr nach Ramadan zu Besuch gekommen. Herausgeputzt in Anzug und Krawatte, brachte er Eid -Geschenke mit. Einmal war es ein Wollschal für Mariam. Zu dritt tranken sie Tee, und wenig später machte sich Jalil wieder auf den Weg.
»Um mit seiner richtigen Familie Eid zu feiern«, sagte Nana, als er den Fluss überquerte und noch einmal winkte.
Auch Mullah Faizullah kam immer an diesem besonderen Tag. Er brachte Mariam in Folie eingepackte Schokoladenstücke, einen kleinen Korb mit gefärbten, hart gekochten Eiern und Kekse in einer Blechbüchse. Wenn er gegangen war, kletterte Mariam mit ihren Geschenken in eine der Weiden. Auf einem Ast hoch oben lutschte sie dann Mullah Faizullahs Schokolade und ließ die Papierhüllen fallen, die sich wie silberne Blütenblätter um den Fuß des Baumes legten. Kaum war die Schokolade verzehrt, machte sie sich über die Kekse her, und danach malte sie mit einem Bleistift Gesichter auf die Eier, die er ihr mitgebracht hatte. Von solchen kleinen Vergnügungen abgesehen, hatte Mariam wenig Freude am Zuckerfest. Eid, die Zeit, in der sich feierlich ausstaffierte Familien untereinander besuchten, war ihr ein Graus. Sie stellte sich immer vor, dass die Luft über Herat vor Heiterkeit knisterte und hochgestimmte, lachende Menschen einander mit Freundlichkeiten und Glückwünschen überhäuften. Dann senkte sich Trübsal auf sie herab wie ein dunkler Schleier, der sich erst wieder lüftete, wenn Eid vorbei war.
In diesem Jahr sah Mariam das Zuckerfest ihrer Kindheitsvorstellungen zum ersten Mal mit eigenen Augen.
Raschid und sie gingen aus. Die Straßen waren voller Menschen, die, ungeachtet des kalten Wetters, von einem Verwandtschaftsbesuch zum nächsten eilten. Nie zuvor hatte sich Mariam inmitten einer so lebhaften Menge bewegt. In der eigenen Straße erkannte sie Fariba und ihren Sohn Noor wieder, der einen Anzug trug. Fariba, die einen weißen Schal angelegt hatte, ging an der Seite eines kleinen, schüchtern wirkenden Mannes mit Brille. Auch der ältere Sohn war dabei — Mariam erinnerte sich, dass Fariba ihr bei ihrem ersten Treffen vor dem tandoor seinen Namen, Ahmad, genannt hatte. Im Unterschied zu seinem jüngeren Bruder machte er mit seinen tief liegenden, nachdenklichen Augen einen ernsten, fast schon erwachsenen Eindruck. Um seinen Hals hing eine Kette mit glitzerndem Allah- Anhänger.
Fariba hatte Mariam offenbar auch erkannt, trotz der Burka. Sie winkte ihr zu und rief: »Eid mubarak!«
Unter ihrer Burka deutete Mariam ein Kopfnicken an.
»Du kennst also diese Frau, die Frau des Lehrers«, sagte Raschid.
Mariam verneinte.
»Du gehst ihr besser aus dem Weg. Sie ist eine neugierige und geschwätzige Person. Und ihr Mann hält sich für was Besonderes, weil er studiert hat. Tatsächlich aber ist er eine Maus. Schau ihn dir an. Sieht er nicht aus wie eine Maus?«
Sie gingen nach Shar-e-Nau, wo Kinder in frischen Hemden und bunten, perlenbesetzten Westen umhertollten und ihre Eid- Geschenke untereinander verglichen. Frauen schwenkten Teller voller Süßigkeiten. In den Fenstern der Geschäfte hingen schmuckvolle Laternen; aus Lautsprechern dröhnte Musik. Fremde wünschten Mariam und Raschid im Vorübergehen »Eid mubarak«.
Читать дальше