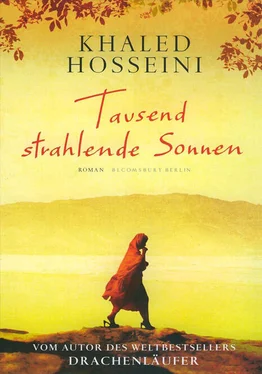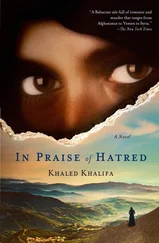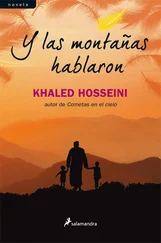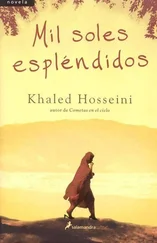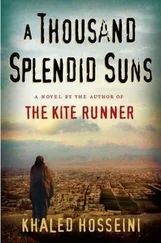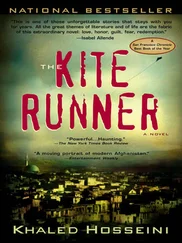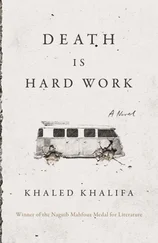»Dem armen Mädchen haben die Zähne geklappert, Hakim. So sehr hat sie gezittert.«
Sie habe dann, fuhr Fariba fort, zu ihr aufgeblickt und mit dünner, zaghafter Stimme gefragt: »Ist doch nicht weiter schlimm, oder? Ist doch normal, nicht wahr?«
Wieder im Bus mit Raschid. Und es schneite wieder. Heftiger diesmal. Der Schnee häufte sich auf Gehwegen und Dächern, bildete weiße Krusten auf der Rinde der Bäume. Vor ihren Läden schaufelten Händler den Zugang frei. Eine Handvoll junger Burschen jagte einen schwarzen Hund. Mariam warf einen Blick auf Raschid. Er hatte die Augen geschlossen. Er summte nicht. Auch Mariam machte die Augen zu und senkte den Kopf. Sie wollte heraus aus ihren kalten Socken, aus dem feuchten Wollpullover, der auf der Haut kratzte. Sie wollte raus aus dem Bus.
Zu Hause angekommen, legte sie sich auf die Couch. Raschid warf ihr eine Steppdecke über.
»Was soll man von solch einer Antwort halten?«, sagte er zum wiederholten Mal. »Die kann man von einem Mullah erwarten, aber ein Arzt, dem man teures Geld bezahlt, sollte sich wahrhaftig etwas Besseres einfallen lassen als: ›Gott will es so.‹«
Mariam zog die Knie an und sagte, dass sie etwas Ruhe brauche.
»Gott will es so«, brummte er.
Er ging auf sein Zimmer und rauchte den ganzen Tag.
Mariam lag auf der Couch, hielt die Hände unter den Knien verschränkt und starrte in das Schneegewirbel vor dem Fenster. Sie erinnerte sich, dass Nana einmal gesagt hatte, jede einzelne Schneeflocke sei das Seufzen einer gekränkten Frau irgendwo auf der Welt. Alle Seufzer stiegen zum Himmel empor, verdichteten sich dort zu Wolken und zerbrächen in winzige Teile, die dann lautlos auf die Menschen herabfielen.
»Zur Erinnerung daran, wie sehr wir Frauen leiden«, hatte sie gesagt. »Wie still wir alles ertragen, was uns aufgebürdet wird.«
Allein schon der Gedanke an die ungebaute Wiege oder an den kleinen Wildledermantel in Raschids Kleiderschrank löste Schmerzen der Trauer in Mariam aus, deren Schärfe sie immer wieder aufs Neue überraschte. Dann fantasierte sie, dass das Kind zur Welt komme; sie konnte es hören, sein hungriges Schmatzen, Sabbern und Plappern. Sie spürte es an der Brust liegen. Die Trauer überschwemmte sie in solchen Momenten, riss sie fort und machte sie schwindeln. Mariam konnte selbst kaum glauben, ein Wesen, das sie nie gesehen hatte, auf so verstörende Weise vermissen zu können.
Aber es gab auch Tage, an denen der Kummer erträglich schien und der Gedanke an eine Rückkehr zum gewohnten Alltag möglich war, ohne daran zu verzweifeln, Tage, an denen es sie nicht übermäßig viel Kraft kostete, aus dem Bett zu steigen, ihre Gebete zu sprechen, das Haus in Ordnung zu bringen und für Raschid zu kochen.
Mariam scheute sich, das Haus zu verlassen. Sie beneidete die Nachbarinnen und deren Kinderscharen. Manche hatten sieben oder acht und schienen selbst nicht zu wissen, wie gesegnet sie waren, wie glücklich sie darüber sein mussten, dass sie diese Kinder austragen, zur Welt bringen und an ihren Brüsten stillen durften. Kinder, die nicht mit Blut, Seifenlauge und dem Schmutz von Fremden in den Abfluss irgendeines Badehauses gespült worden waren. Mariam ertrug es nicht, wenn sie Klagen über angeblich missratene Söhne oder faule Töchter hörte.
Eine innere Stimme versuchte sie mit gut gemeinten, aber unangebrachten Tröstungen zu besänftigen.
Du wirst andere Kinder haben, inschallah. Du bist jung. Es werden sich bestimmt weitere Gelegenheiten bieten.
Doch Mariams Trauer war alles andere als diffus. Sie trauerte um dieses Kind, dieses besondere Kind, das sie für kurze Zeit so glücklich gemacht hatte.
Manchmal glaubte sie, dass das Kind eine unverdiente Segnung und sein früher Tod eine Strafe für das war, was sie Nana angetan hatte. War es nicht so, dass sie ihrer Mutter die Schlinge gewissermaßen eigenhändig um den Hals gelegt hatte? Verräterische Töchter verdienten es nicht, selber Mütter zu werden. Die Strafe war durchaus gerecht. Mariam hatte schreckliche Träume, in denen Nanas Dschinn an ihr Bett geschlichen kam, ihr mit seinen Klauen in den Unterleib fuhr und das Kind entriss, während Nana vor Freude und Genugtuung laut auflachte.
An manchen Tagen war Mariam voller Wut. Dann gab sie Raschid die Schuld an ihrem Verlust, weil er die Stirn gehabt hatte, seinen eitlen Stolz zu feiern, in seiner Anmaßung überzeugt davon, Vater eines Sohnes zu werden. Weil er dem Kind schon einen Namen gegeben und Gottes Einverständnis einfach schon vorausgesetzt hatte. Seinetwegen war sie in dieses Badehaus gegangen, wo irgendetwas, vielleicht der Dampf, das schmutzige Wasser oder die Seife zu dem geführt hatte, was geschehen war. Nein, nicht Raschid. Die Schuld lag bei ihr. Sie wurde wütend auf sich selbst und warf sich vor, auf der falschen Seite geschlafen, das Essen zu stark gewürzt und, statt genügend Früchte zu sich zu nehmen, zu viel Tee getrunken zu haben.
Es war Gottes Schuld. Er hatte sie verhöhnt, ihr nicht gewährt, was er so vielen anderen Frauen gewährte. Er hatte ihr in quälerischer Absicht das größte Glück versprochen, um es ihr sogleich wieder zu entreißen.
Aber alles Wüten, all diese Schuldzuweisungen halfen ihr nicht weiter. Im Gegenteil. Es war kofr, frevelhaft, solche Gedanken zuzulassen. Allah war nicht gehässig und schon gar nicht ein kleinlicher Gott. Mullah Faizullahs Worte gingen ihr durch den Kopf: Segensreich ist Der, in Dessen Hand die Herrschaft ruht, Der über alle Dinge Macht hat, Der Tod und Leben geschaffen hat, damit Er dich prüfe.
Von Schuldgefühlen gepeinigt, ging Mariam in solchen Momenten in die Knie und flehte um Vergebung dafür, dass sie solchen Gedanken nachgehangen hatte.
Seit dem Tag im Badehaus zeigte sich Raschid verändert. Er verlor schnell die Geduld mit Mariam und herrschte sie dann an. Wenn er abends von der Arbeit nach Hause kam, wechselte er kaum ein Wort mit ihr. Er aß, rauchte, ging zu Bett und kam manchmal mitten in der Nacht zu ihr, um sich abzureagieren, wobei er in letzter Zeit immer gröber zur Sache ging. Er war schnell beleidigt, mäkelte an dem Essen, das sie ihm vorsetzte, beschwerte sich über die Unordnung im Vorhof und machte sie im Haus auf Stellen aufmerksam, die seiner Meinung nach nicht sauber genug waren. Zwar führte er sie freitags immer noch manchmal in die Stadt aus, ging aber immer mehrere Schritte vor ihr her, sprach kein Wort und achtete nicht auf sie, die fast rennen musste, um ihm folgen zu können. Lachen sah sie ihn kaum noch. Er kaufte ihr auch keine Süßigkeiten oder Geschenke mehr und verzichtete darauf, Sehenswürdigkeiten zu benennen, wie er es früher getan hatte. Auf ihre Fragen antwortete er, wenn überhaupt, unwirsch.
Eines Abends saßen sie gemeinsam im Wohnzimmer und hörten Radio. Der Winter ging seinem Ende entgegen. Die kalten Winde, die einem Schnee ins Gesicht bliesen und die Augen tränen ließen, hatten sich gelegt. Der Schnee auf den Zweigen der hohen Ulmen taute. An seiner Stelle würden sich in wenigen Wochen hellgrüne Knospen ausbilden. Raschid wippte gedankenverloren mit dem Fuß zum Takt der tabla eines Hamahang-Liedes und zwinkerte den Rauch seiner Zigarette aus den Augen.
»Bist du mir gram?«, fragte Mariam.
Raschid antwortete nicht. Nach der Musik kamen die Nachrichten. Eine Frauenstimme berichtete, der Präsident habe erneut eine Gruppe sowjetischer Berater nach Moskau zurückgeschickt, wogegen der Kreml aller Voraussicht nach Protest einlegen werde.
»Ich mache mir Sorgen und fürchte, dass ich dich verärgert haben könnte.«
Raschid seufzte.
»Ist das so?«
Er sah sie an. »Wie kommst du darauf?«
»Ich weiß nicht, aber seit ich das Kind…«
»Glaubst du etwa, so einer wäre ich? Nach allem, was ich für dich getan habe?«
Читать дальше