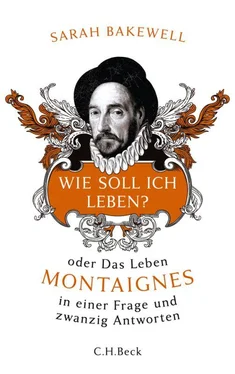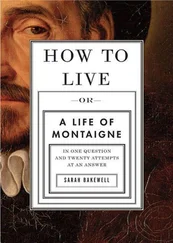Es stimmt, die Essais erreichten allmählich die Grenzen des Fasslichen. Durch all die Wucherungen hindurch lässt sich manchmal dennoch das Skelett der Erstausgabe erkennen; in modernen Editionen sind die verschiedenen Entstehungsphasen durch Buchstaben gekennzeichnet: A für die Ausgabe von 1580, B für die von 1588 und C für alles andere danach. Man hat den Eindruck, als stünde man vor der von Schlingpflanzen überwucherten Tempelanlage von Angkor Wat, und fragt sich, wie wohl eine weitere Schicht D ausgesehen hätte. Hätte Montaigne noch dreißig Jahre gelebt, er wäre immer weiter so verfahren, bis das Buch tatsächlich unlesbar geworden wäre. Er war wie der Maler Frenhofer in Balzacs Erzählung Das unbekannte Meisterwerk , der sein Frauenporträt immer wieder umarbeitet, bis es nur noch ein undurchdringliches Gewirr aus Farben und Linien ist. Oder hätte Montaigne genau gewusst, wann es aufzuhören galt?
Wir können diese Frage nicht beantworten, aber es scheint, als hätte er zum Zeitpunkt seines Todes nicht den Eindruck gehabt, er hätte diese Grenze erreicht. Aus seinen letzten Lebensjahren ist ein Exemplar der Essais mit zahlreichen Anmerkungen überliefert, das — nachdem es in die Hand der Herausgeberin seines Nachlasses geraten war — zur Grundlage fast aller weiteren Montaigne-Ausgaben wurde. Diese Herausgeberin war eine außergewöhnliche junge Frau, die in Paris in sein Leben trat, als er gerade die Ausgabe von 1588 abgeschlossen hatte: Marie de Gournay.
18
Frage: Wie soll ich leben?
Antwort: Gib die Kontrolle auf!
Tochter und Schülerin
Marie le Jars de Gournay, Montaignes erste bedeutende Herausgeberin, war äußerst begeisterungsfähig und emotional, und all diese Gefühle schleuderte sie Montaigne bei ihrer ersten Begegnung in Paris ungeniert entgegen. Sie wurde die bei weitem wichtigste Frau in seinem Leben, wichtiger als Ehefrau, Mutter und Tochter, jene übermächtige Trias, die in seinem Haus den Ton angab. Wie diese drei überlebte auch sie ihn: wenig überraschend, denn sie war zweiunddreißig Jahre jünger als er. Als sie sich kennenlernten, war Montaigne fünfundfünfzig und sie dreiundzwanzig.
Marie de Gournay, 1565 geboren, hatte in vieler Hinsicht ähnliche Startbedingungen wie Montaigne, allerdings mit zwei entscheidenden Unterschieden: Sie war eine Frau, und sie war weniger begütert. Ihre Familie stammte aus dem niederen Landadel und lebte teils in Paris, teils auf dem Schloss und Landgut Gournay-sur-Aronde in der Picardie, das ihr Vater 1568 gekauft hatte. Als Erwachsene benannte sich Marie nach diesem Anwesen. Dieses Recht war traditionell den Söhnen vorbehalten, aber es war typisch, dass sie sich über solche Regeln hinwegsetzte. Sie war entschlossen, mehr vom Leben einzufordern, als Geschlecht und Status ihr zugestanden.
Der Tod ihres Vaters im Jahr 1577, ein Schicksalsschlag für die ganze Familie, veränderte ihr Leben von Grund auf. Es fehlte an Geld, und da das Leben in Paris teurer war als in der Picardie, zog sich die Familie fast ganz aus der Hauptstadt zurück. Im Jahr 1580 war Maries Lebenskreis auf die Provinz beschränkt. Doch sie war ein eigensinniger Teenager und brachte sich mit Hilfe der Bücher aus der Familienbibliothek selbst eine Menge bei. Sie las lateinische Autoren mit Hilfe der französischen Übersetzung und schuf sich auf diese Weise ein Fundament humanistischer Bildung, so gut sie es eben konnte. Das Ergebnis war ein zusammengestückeltes, unsystematisches Wissen, aber die junge Frau war hochmotiviert.
Dieser anarchische Bildungseifer hätte Montaigne gefallen, zumindest theoretisch. Denn in der Praxis kann man sich kaum vorstellen, dass er sich mit dem begnügt hätte, was Marie de Gournay sich aneignete. Montaigne konnte es sich leisten, sich über schulische Bildung geringschätzig und über die Ehrfurcht seines Vaters vor Büchern ironisch zu äußern; Marie jedoch war stolz auf das, was sie erreicht hatte, denn es war schwer erkämpft. Sie konnte leicht in die Defensive gedrängt werden und hatte oft das Gefühl, man lache sie aus. Natürlich, sagte sie, fänden die Leute es lustig, einer Frau zu begegnen,
die den Anspruch erhebt, auch ohne formale Ausbildung zu lernen, weil sie sich rein mechanisch selbst Latein beibrachte, indem sie sich mit Übersetzungen neben dem Original behalf, und es deshalb niemals wagen würde, die Sprache zu sprechen, aus Angst, einen falschen Schritt zu tun — eine Gelehrte, die das Metrum eines lateinischen Verses nicht sicher bestimmen kann; eine Gelehrte ohne Griechisch und Hebräisch und ohne die Fähigkeit, die alten Autoren wissenschaftlich zu kommentieren.
Diesen wütenden und gequälten Ton legte Marie ihr Leben lang nicht ab. In Peincture de mœurs , einem Selbstporträt in Versen, beschrieb sie sich als einen Wirrwarr aus Verstand und Gefühl, unfähig, ihre Emotionen zu verbergen. In ihren Schriften lebte sie dieses Dilemma aus.
Ähnlich emotional beschreibt sie ihre erste Begegnung mit Montaigne — zuerst mit seinen Essais , dann mit deren Verfasser. Irgendwann mit achtzehn, neunzehn stieß sie, offenkundig per Zufall, auf eine Ausgabe der Essais . Diese Erfahrung war so erschütternd, dass ihre Mutter befürchtete, die Tochter habe den Verstand verloren, und ihr Nieswurz geben wollte, ein traditionelles Mittel gegen Wahnsinn. So jedenfalls erzählt es Marie de Gournay. Sie hatte das Gefühl, in Montaigne ihr zweites Ich gefunden zu haben, den einzigen Menschen, zu dem sie sich aufrichtig hingezogen fühlte, und den einzigen, von dem sie sich verstanden glaubte. Diese Erfahrung teilte sie mit vielen seiner Leser:
Woher wusste er das alles über mich? (Bernard Levin)
Es kommt mir vor, das sei ich selbst. (André Gide)
Hier ist ein Du, in dem mein Ich sich spiegelt, hier ist die Distanz aufgehoben. (Stefan Zweig)
Gournay wollte Montaigne unbedingt persönlich kennenlernen, doch als sie Erkundigungen einholte, hieß es, er sei tot. Als sie dann ein paar Jahre später, 1588, mit ihrer Mutter in Paris war, erfuhr sie, dass er noch lebte. Und nicht nur das, sein Name war in aller Munde. Kühn schickte sie Montaigne eine Einladung ihrer Familie: ein ungewöhnlicher Schritt für eine junge Frau ihres Ranges gegenüber einem sehr viel älteren Mann aus einer höheren sozialen Schicht, über den ganz Paris sprach. Montaigne, angetan von ihrer Chuzpe und den Schmeicheleien einer so jungen Frau nicht abgeneigt, nahm die Einladung an und besuchte sie am folgenden Tag.
Marie de Gournays Schilderung zufolge war diese Begegnung emotional intensiv und intim, wenngleich nicht in körperlicher Weise, denn am Ende lud er sie in aller Form ein, seine geistige Adoptivtochter zu werden, ein Angebot, das sie sofort annahm. Wie die Unterhaltung im Einzelnen verlief, kann man sich nur ausmalen. Schwärmte sie ihm von ihrem Gefühl der inneren «Affinität» vor? Erzählte sie ihm die Geschichte mit der Nieswurz? Man kann sich gut vorstellen, dass sie in einem wirren Redeschwall mit allem herausplatzte. In einem späten Einschub zu den Essais beschreibt Montaigne eine merkwürdige Episode, offenkundig bei einer ihren folgenden Begegnungen. Er sah «eine Jungfer» — weitere Bemerkungen lassen keine Zweifel daran, dass es sich um Marie de Gournay handelte, die,
um ihre Zuneigung, die Inbrunst ihrer Versprechen und auch ihre Standhaftigkeit zu bezeugen, eine große Nadel hervorzog, die sie in ihren Haaren trug, und sich damit vier, fünf tiefe Stiche in den Arm beibrachte, so dass ihre Haut aufriss und sie vom Blut überströmt wurde.
Wann immer dieser an Selbstverstümmelung grenzende Akt geschah, man darf vermuten, dass es Marie de Gournay war, die bei dieser Begegnung die Unterhaltung bestritt. Der Gedanke einer Vater-Tochter-Beziehung stammte wahrscheinlich eher von ihr als von ihm. Vielleicht versuchte Montaigne sogar, aus ihrer Begeisterung sexuellen Vorteil zu ziehen, musste aber einsehen, dass es besser war, sie als seine Adoptivtochter zu betrachten. Vom ersten Augenblick ihrer Montaigne-Lektüre an hatte Gournay das Gefühl gehabt, geistig derselben Familie anzugehören wie er, jetzt wurde dies auch offiziell bekräftigt. Montaigne trat an die Stelle ihres verstorbenen Vaters, und sie wurde in den kleinen Kreis der Frauen um ihn herum aufgenommen, die ihm, Montaigne, ohnehin ein Rätsel waren.
Читать дальше