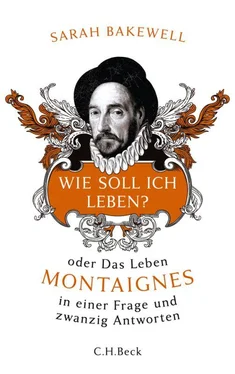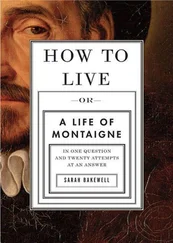An dem Vorwurf ist aber durchaus etwas dran. Montaignes Erinnerungsvermögen war bestimmt besser, als er zugeben wollte. Jeder Mensch fühlt sich manchmal von seinem Gedächtnis im Stich gelassen, das ist ganz normal. Und ein undiszipliniertes, sprunghaftes Gedächtnis war in Anbetracht von Montaignes lockerer Erziehung und seines Unwillens, sich Zwang anzutun, nicht weiter verwunderlich. Wenn er immer wieder die Unzulänglichkeit seiner Erinnerung bekundet, so kann man darin auch einen impliziten Hinweis auf Tugenden sehen, die er für wichtiger hielt. Hierzu zählte paradoxerweise die Aufrichtigkeit. Das Sprichwort sagt: Ein Lügner muss ein gutes Gedächtnis haben. Wenn Montaigne nichts behalten konnte, musste er die Wahrheit sagen. Ein schlechtes Gedächtnis zwang auch dazu, sich in seinen Reden und Anekdoten kurz zu fassen, und ermöglichte ein sicheres Urteil. Menschen mit einem guten Gedächtnis haben den Kopf voll, Montaignes Kopf jedoch war so wunderbar leer, dass dem gesunden Menschenverstand nichts in die Quere kommen konnte. Und schließlich vergaß ein vergesslicher Mensch auch rasch die Kränkungen, die andere ihm zufügten, und hegte weniger Groll. Kurzum, er präsentierte sich als jemand, der auf einer Wolke des glückseligen Vergessens durch die Welt schwebte.
Ein Bereich, in dem Montaignes Gedächtnis gut zu funktionieren schien, wenn er es nur wollte, war die Wiedergabe persönlicher Erlebnisse wie des Reitunfalls. Er verlor sich nicht in netten, oberflächlichen Anekdoten, sondern konnte seine inneren Gefühle wiedergeben — nicht bis in die kleinste Einzelheit, weil ihn Heraklits Fluss forttrug, dennoch aber sehr präzise. Der Psychologe Dugald Stewart meinte im 19. Jahrhundert, Montaignes schlechtes Gedächtnis habe ihn für diese Art der Beobachtung geradezu prädestiniert. Montaigne war empfänglich für jenes «unfreiwillige» Sicherinnern, das später auch Proust in Bann schlug: für den unvermittelten Einbruch der Vergangenheit in die Gegenwart, ausgelöst durch einen längst vergessenen Geschmack oder Geruch. Solche Momente scheinen nur dann möglich, wenn man tief in das Meer des Vergessens eintaucht, wenn man in der richtigen Stimmung ist und über Ruhe und Muße verfügt.
Montaigne erzwang nichts. «Nur ganz behutsam darf ich es in Anspruch nehmen», schrieb er über sein Gedächtnis. «Es dient mir zu seiner, nicht zu meiner Stunde.» Was man unbedingt festhalten will, entzieht sich nur noch mehr. Umgekehrt prägt sich einem nichts tiefer ein als das, was man unbedingt vergessen möchte.
«Was mir sonst leicht und natürlich von der Hand geht, will mir nicht gelingen, wenn ich es mir ausdrücklich vorschreibe und gebiete.» Seinem Gedächtnis eigene Wege zu erlauben war Teil seiner Strategie, sich in seinem Handeln von der Natur leiten zu lassen. In seiner Kindheit war das Ergebnis oft, dass er faul und nichtsnutzig erschien, was er in vieler Hinsicht wohl auch war. Trotz der ständigen Bemühungen seines Vaters, ihn zu motivieren, schrieb er, sei er «so schwerfällig, schlaff und verschlafen gewesen, dass man mich meiner Saumseligkeit nicht einmal zum Spielen entreißen konnte».
Seiner eigenen Einschätzung nach war er nicht nur müßiggängerisch, sondern auch schwer von Begriff. «Schon ein winziges Wölkchen», schrieb er, trübe ihm derart den Blick, dass er «zum Beispiel nie auch nur das leichteste Rätsel zu lösen vermochte […]. Daher verstehe ich von allen Spielen, die sein [des Geistes] Mitspiel erfordern — Dame und Schach etwa oder Karten und dergleichen —, nur die gröbsten Züge.» Er war «schwer von Begriff» und «statt findig — lahm; vor allem aber litt ich an einer unglaublichen Gedächtnisschwäche». Er tut so, als hätten alle seine Talente und Begabungen in friedlichem Schlummer gelegen.
Aber es gab auch Vorteile. «Was ich einmal begriffen habe, behalte ich» und «Was ich freilich sah, das sah ich gut», behauptete er. Darüber hinaus benutzte er seine träge Gemütsart gern als Deckmäntelchen, unter dem er «kühne Gedanken» und unabhängige Ansichten verstecken konnte. Seine angebliche Unzulänglichkeit ermöglichte es ihm, etwas viel Wichtigeres für sich in Anspruch zu nehmen als eine schnelle Auffassungsgabe: ein gesundes Urteilsvermögen.
Montaigne wäre ein gutes Beispiel für die Bewegung «Slow Movement», die sich seit ihren Anfängen Ende des 20. Jahrhunderts langsam und bedächtig zu einem regelrechten Kult entwickelt hat. Wie Montaigne erklären auch die Anhänger dieser Bewegung die Langsamkeit zum Lebensprinzip. Ihr Manifest ist Sten Nadolnys Roman Die Entdeckung der Langsamkeit , der die Lebensgeschichte des Polarforschers John Franklin erzählt. Franklin wird als Kind gehänselt, doch im hohen Norden entdeckt er die seinem Naturell angemessene Umgebung: einen Ort der Gemächlichkeit, wo man innehalten und nachdenken kann, ohne überstürzt handeln zu müssen. Der 1983 erschienene Roman wurde zum Weltbestseller und sogar als alternatives Managementhandbuch empfohlen. Unterdessen entwickelte sich die Slow-Food-Bewegung, die in Italien als Protest gegen die Eröffnung eines McDonald’s-Restaurants in Rom gegründet worden war, zu einer Philosophie vom guten Leben.
Montaigne hätte all das sehr gut nachvollziehen können. Für ihn war Langsamkeit der Schlüssel zur Weisheit und Mäßigung die Geisteshaltung gegen die Exzesse und den religiösen Fanatismus, die zu seinen Lebzeiten Frankreich beherrschten. Zum Glück war er von seinem Charakter her gegen beides immun und ließ sich nicht von einem religiösen Eifer mitreißen, der seine Zeitgenossen erfasst zu haben schien. Ich «bleibe fast immer in derselben Verfassung, wie es für schwere und träge Körper kennzeichnend ist», schrieb er. Sein träges Naturell habe ihn resistent gegen Einschüchterungen gemacht, da er «völlig unfähig gewesen wäre, sich dem Joch von Zwang und Gewalt zu beugen».
Aber wie so oft bei Montaigne ist auch das nur die halbe Wahrheit. Als junger Mann konnte er durchaus über die Stränge schlagen, und er war rast- und ruhelos. In den Essais schreibt er: «Ich weiß nicht, was mir schwerer fällt: den Geist oder den Körper an einem Punkt festzuhalten.» Vielleicht spielte er die Rolle des trägen Faulenzers nur, wenn es ihm passend schien.
«Das meiste von dem, was man gelernt hat, wieder vergessen» und «schwer von Begriff sein» sind zwei von Montaignes besten Antworten auf die Frage, wie man leben soll. Diese Bedächtigkeit verhalf ihm zu sicheren Urteilen und immunisierte ihn gegen Fanatismus und Täuschungen, denen andere ausgeliefert waren. Und sie ermöglichte ihm, seinen eigenen Gedanken nachzugehen, wohin immer sie ihn führten — das Einzige, worauf es ihm wirklich ankam.
Begriffsstutzigkeit und Vergesslichkeit konnten trainiert werden, Montaigne jedoch war überzeugt, dass er das Glück hatte, beides von Geburt an zu besitzen. Seine Neigung, den eigenen Vorstellungen zu folgen, wurde schon früh offenkundig und manifestierte sich in einer erstaunlichen Selbstsicherheit: «Ich erinnre mich, dass seit meiner zartesten Kindheit an meiner Körperhaltung und meinem Gebaren irgend etwas auffiel, das auf einen gewissen eitlen und törichten Stolz hinzudeuten schien.» Die Eitelkeit war oberflächlich, er war allenfalls «besprenkelt» damit. Aber seine innere Unabhängigkeit schenkte ihm Coolness. Stets bereit, seine Ansichten kundzutun, war der junge Montaigne auch bereit, andere auf das warten zu lassen, was er zu sagen hatte.
Der junge Montaigne in unruhigen Zeiten
Seine lässige Überlegenheit auch nach außen hin zur Schau zu stellen wurde ihm durch seine geringe Körpergröße erschwert: ein Umstand, der ihm zu ständigen Klagen Anlass gab. Bei Frauen falle die Körpergröße nicht ins Gewicht, schrieb er, und könne durch andere Vorzüge ausgeglichen werden. Bei Männern hingegen sei eine stattliche Gestalt die einzige «Schönheit» — und ausgerechnet daran mangelte es ihm.
Читать дальше