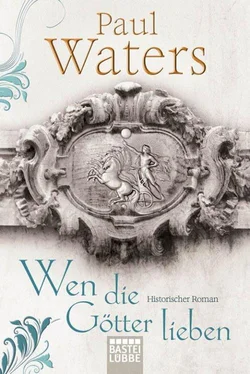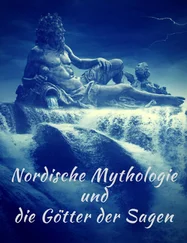Achselzuckend verzog ich das Gesicht. Ich hatte geglaubt, man werde uns ins Soldatenquartier bringen.
Schließlich gelangten wir in einen hellen Raum mit hohen Fenstern und Kassettendecke. Niemand war da. Bevor der Diener uns allein ließ, sagte er: »Der Cäsar wird sogleich kommen.«
»Augenblick!«, rief ich und wäre ihm beinahe hinterhergerannt. »Wieso Cäsar? Das muss ein Irrtum sein. Ich bin nicht gekommen, um den Cäsar zu sprechen. Er kennt mich gar nicht. Ich möchte zu Oribasius.«
Der Diener musterte mich, als würde ich wirres Zeug faseln. Ehe ich noch etwas sagen konnte, näherten sich Stimmen. Ich überlegte, wie ich dem Vetter des Kaisers meine Anwesenheit erklären sollte. Anstelle eines kaiserlichen Prinzen sah ich jedoch inmitten seines Gefolges denselben Mann, dem ich im Jupitertempel begegnet war.
»Drusus!«, rief er aus und kam sofort auf mich zu. »Siehst du, Oribasius? Er ist gekommen, wie ich gesagt habe. Und du musst Marcellus sein. Seid gegrüßt. Ich freue mich, dass ihr endlich da seid.«
Er wandte sich ab, um dem Diener eine Anweisung zu geben, und erst als dieser mit »Ja, Cäsar« antwortete, wurde mir die Wahrheit deutlich. Er hatte sich zurechtgemacht, wenn auch nicht allzu sehr; er trug eine abgetragene hellbraune Tunika mit rotem Mäandermuster und war auf kunstvolle Weise frisiert. Er sprach mit Marcellus, fragte ihn, ob man uns unverzüglich vorgelassen habe, und erklärte, wir müssten sofort wieder in der Zitadelle wohnen. Marcellus, selbstsicher wie immer, antwortete mit der gewohnten wohlerzogenen Höflichkeit – er war durch Autorität und Titel nie eingeschüchtert.
Inzwischen füllte der Raum sich mit Höflingen, Dienern und Offizieren. Plötzlich wurde es laut im Vorzimmer, und dann kam auch schon der Präfekt zu uns herein.
Seine kastanienbraunen Haare waren in kleine kunstvolle Locken gelegt. Er trug einen feinen dunkelblauen Mantel, der an der Schulter mit einer edelsteinbesetzten Brosche aus Goldfiligran zusammengehalten wurde. Die Anwesenden unterbrachen ihre Gespräche und betrachteten ihn. Man hätte tatsächlich meinen können, er sei der Cäsar. Er sprach mit seinem Sekretär, dem Mann, der uns aus der Zitadelle geworfen hatte, wobei er den Blick in die Runde schweifen ließ, um festzustellen, wer anwesend war. Als er in meine Richtung schaute, stockte sein schweifender Blick für einen winzigen Moment, und ich wusste, dass er mich erkannt hatte, obwohl er versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen. Er ging auf Julian zu, der von einer Beamtenschar umringt war; doch bevor er zu ihm durchkam, wandte Julian sich ab und rief mir und Marcellus zu: »Kommt, gehen wir an einen ruhigeren Ort, wo wir uns unterhalten können!«
Ich sah, wie Florentius abrupt innehielt, ehe er sich wieder seinem Sekretär zuwandte. Julian bemerkte davon nichts.
Wir begaben uns in ein angrenzendes Zimmer. Oribasius folgte uns und schloss die Tür. Der Raum war klein und schmucklos. Unter dem Fenster standen ein Tisch und ein paar schlichte Eichenstühle; an der Wand sah ich einen Bücherschrank mit Gittertüren. Bis auf die Bücher hätte dies ein Raum in einer Schenke sein können.
»Ich hoffe, du verzeihst mir wegen gestern Abend«, sagte Julian. »Vermutlich hast du uns mehr erschreckt als wir dich. Es gefiel mir gar nicht, mich im Schatten zu verbergen, während du dich allein wähntest. Es war schändlich, das gebe ich zu, aber ich musste vorsichtig sein.« Er blickte Oribasius an; dann fügte er mit dem Hauch eines Lächelns hinzu: »Weißt du, es wäre nicht gut, wenn bekannt würde, dass der Vetter des großen Constantius sich im Tempel des Jupiter herumtreibt.«
Er ging an den Tisch und zog einen Brief unter einem Onyxklotz hervor. »Der kam von Eutherius. Er schreibt, er sei am Hofe aufgehalten worden.«
»Das tut mir leid zu hören«, sagte ich. Die Enthüllung, wer der Mann im Tempel tatsächlich war, machte mir noch immer zu schaffen, und ich hatte mich an meine schroffen Worte bei unserer Begegnung erinnert, doch sie schienen ihm nichts auszumachen. Als ich meiner Bemerkung den Titel »Cäsar« anfügte, winkte er ab und sagte: »Nenn mich Julian. Unter Freunden soll das genügen.«
Er bedachte mich mit einem unbeholfenen, ein wenig verlegenen Lächeln, als wäre er ein schüchternes, aber höfliches Kind. Dann, wieder ernst geworden, hob er den Brief und zeigte auf einen kleinen Riss in einer Ecke. »Seht ihr?«, sagte er. »Hier haben die Hofspione das Siegel erbrochen. Sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, es zu verschleiern.«
Er folgte meinem Blick und nickte, als er sah, dass ich verstand.
»Wahrscheinlich seid ihr entsetzt, aber man gewöhnt sich an solche Dinge. Eutherius wird damit gerechnet und seine Worte entsprechend gewählt haben. Hört zu …« Kurz überflog er das Schreiben, dann las er vor: »Außerdem kann ich zu meiner Freude berichten, dass der göttliche Constantius sich weiterhin von den besten Köpfen des Reiches beraten lässt.« Lachend sah er auf. »Das ist seine Art, mir mitzuteilen, dass der Oberkämmerer Eusebius noch immer die Politik bestimmt – sehr zu meinem Nachteil!«
Er wollte fortfahren, doch Oribasius, der bisher schweigend an der Tür gestanden hatte, räusperte sich unauffällig. Julian blickte zu ihm hinüber und schien sich zu besinnen. »Aber«, sagte er nach kurzem Innehalten, »es ist nicht nötig, euch mit dem Oberkämmerer zu langweilen.« Er schaute wieder in den Brief. »Was ich eigentlich gesucht habe, ist die Stelle, wo er schreibt, ihr würdet hier in Paris warten und dass ihr Freunde seid und ich euch trauen kann … Ah, da ist es ja.« Zufrieden las er die Worte vor, wie man ein Kompliment weitergibt. Als er geendet hatte, legte er das Blatt beiseite und stellte den Briefbeschwerer darauf.
»Weißt du«, sagte er, wobei er sich vom Tisch herumdrehte, »ich glaube, bei unserer Begegnung hatte ein Gott seine Hand im Spiel. Meinst du nicht auch? Es muss einen höheren Sinn haben, dass wir uns in diesem Tempel getroffen haben, den sicherlich seit einem Jahr keine Menschenseele betreten hat.« Er blickte seinen Freund an. »Jetzt sag mir nicht, das hätte nichts zu bedeuten, Oribasius!«
Aus dem großen Empfangsraum drang das Stimmengewirr herein. Julian starrte finster auf die Tür.
»Jetzt sollte ich wohl besser zu ihnen gehen«, sagte er. »Bitte verzeih mir die kleine Irreführung im Tempel, Drusus. Und auch du, Marcellus. Wollt ihr heute Abend mit mir speisen?«

Wir zogen wieder in der Zitadelle ein, nicht in das kleine Zimmer unter der ausladenden Zeder wie zuvor, sondern in eine vornehme Zimmerflucht, die auf den Innenhof hinausging. Sie hatte einen Marmorboden; an der Wand prangte ein Fresko, eine Flusslandschaft mit Booten und Weinterrassen, an denen Männer bei der Lese waren.
Marcellus stand am Fenster und schaute über den Hang am anderen Ufer der Seine, wo die Reitersoldaten ihre Übungen absolvierten. Wir hatten uns gerade über Julian unterhalten.
»Hast du bemerkt, dass er schüchtern ist und es durch Reden zu verbergen sucht?«, sagte er. »Und ich habe das unbestimmte Gefühl, dass da noch etwas anderes ist.«
»Was denn?«
»Das kann ich nicht näher bestimmen. Etwas Persönliches, als würden er und Oribasius ein Geheimnis teilen.«
»Nun, sie sind gemeinsam aus dem Osten gekommen. Sie kennen sich seit Jahren.«
»Ja, vielleicht ist es das.« Er verfiel in Schweigen und beobachtete eine Zeit lang die Pferde. Dann sagte er: »Aber das ist nicht alles, das spüre ich. Es kommt mir so vor, als wollte er etwas mitteilen, traute sich aber nicht.«
Читать дальше