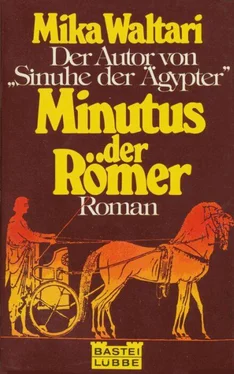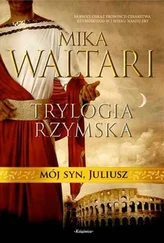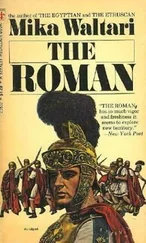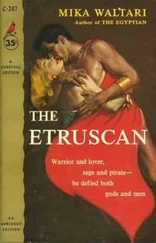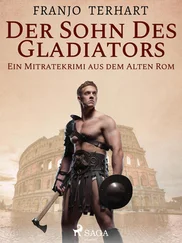Ich traute meinen Ohren nicht. »Du glaubst wirklich, daß er vergiftet wurde und daß du selbst von dem Gift gekostet hast?« fragte ich.
Titus sah mich ernst an und antwortete: »Ich glaube es nicht, ich weiß es. Frag mich nicht, wer der Schuldige ist. Agrippina war es nicht, denn sie entsetzte sich zu sehr, als es geschah.«
»Wenn das wahr wäre, könnte im auch glauben, daß sie Claudius vergiftete, wie das Gerücht noch immer hartnäckig behauptet.«
Seine Mandelaugen blickten mich mitleidig an. »Wußtest du nicht einmal das?« fragte er. »Sogar die Hunde Roms scharten sich um Agrippina und heulten Tod, als sie zum Forum niederstieg, nachdem die Prätorianer Nero zum Imperator ausgerufen hatten.«
»Dann ist die Macht gefährlicher, als ich je glaubte«, sagte ich.
»Die Macht ist zu schwer, um von einem einzigen Manne getragen zu werden, so klug auch seine Ratgeber sein mögen«, stimmte mir Titus bei. »Keiner der Herrscher Roms hat sie ertragen, ohne durch sie verdorben zu werden. Ich habe während meiner Krankheit Zeit genug gehabt, über diese Dinge nachzudenken, und doch denke ich immer noch eher gut als schlecht von den Menschen. Auch von dir will ich gut denken, da du zu mir gekommen bist, um mich offen nach der Wahrheit zu fragen. Ein Mann kann sich zwar verstellen, aber ich glaube nicht, daß du im Auftrag Neros gekommen bist, um mich auszuhorchen, was ich vom Tode meines besten Freundes denke. Ich kenne Nero. Er glaubt, er habe durch seine Bestechungsgeschenke alle seine Freunde dazu gebracht, zu vergessen, was geschehen ist, und er möchte selbst am liebsten vergessen. Ich habe ein Messer bereitgehalten für den Fall, daß du gekommen wärst, um mir zu schaden.«
Er zog einen Dolch unter dem Kissen hervor und schleuderte ihn fort, um mir zu zeigen, daß er mir vertraute, aber er sprach im folgenden zu vorsichtig und überlegt, als daß ich hätte glauben können, daß er mir ganz traute. Wir zuckten gleichsam schuldbewußt zusammen, als plötzlich eine schöngekleidete junge Frau eintrat, der eine Sklavin mit einem Korb folgte. Sie war schlank und breitschultrig wie Diana, ihr Gesicht war feingeschnitten, aber hart, und ihr Haar war auf griechische Art zu kleinen Locken gekräuselt. Sie sah mich mit ihren grünschillernden Augen fragend an, und diese Augen kamen mir so bekannt vor, daß ich dumm zurückstarrte.
»Kennst du meine Base Flavia Sabina nicht?« fragte Titus. »Sie bringt mir jeden Tag die Speisen, die mir der Arzt verordnet und deren Zubereitung sie selbst überwacht hat. Möchtest du mir nicht als mein Freund beim Mahl Gesellschaft leisten?« Ich begriff, daß das Mädchen die Tochter des Flavius Sabinus, des Präfekten von Rom und älteren Bruders Vespasians war. Vielleicht hatte ich sie schon einmal bei irgendeinem großen Mahl oder bei einem festlichen Umzug gesehen, da sie mir so bekannt vorkam. Ich grüßte sie voll Ehrerbietung, aber die Zunge wurde mir trocken in meinem Munde, und ich starrte wie verzaubert ihr Gesicht an.
Ohne die geringste Verlegenheit tischte sie mit ihren eigenen Händen ein spartanisch einfaches Mahl auf. Es gab nicht einmal Wein zu trinken. Ich aß aus Höflichkeit mit, aber die Bissen blieben mir im Halse stecken, wenn ich sie ansah. Ich sagte mir, daß noch keine Frau beim allerersten Anblick einen solchen Eindruck auf mich gemacht hatte.
Nach dem Grund fragte ich mich vergeblich. Sie selbst schien keine Lust zu verspüren, mit mir zu liebäugeln. Sie war kühl, verschlossen, schweigsam und stolz, ganz die Tochter des Stadtpräfekten, und während ich aß, quälte mich immer stärker die Empfindung, daß das Ganze ein Traum sei. Wir tranken nur Wasser, und dennoch fühlte ich mich leicht berauscht. Schließlich fragte ich: »Warum ißt du selbst nichts?«
Sie antwortete spöttisch: »Ich habe das Essen zubereitet. Ich bin nicht euer Mundschenk und habe auch keine Ursache, mit dir Brot und Salz zu teilen, Minutus Manilianus. Ich kenne dich.«
»Wie willst du mich kennen, wenn ich dich nicht kenne?« fragte ich gekränkt.
Flavia Sabina streckte ohne Umstände ihren schlanken Zeigefinger aus und betastete mein linkes Auge. »Deinem Auge ist jedenfalls nichts geschehen, Narbengesicht«, sagte sie bedauernd. »Wenn ich ein wenig geschickter gewesen wäre, hätte ich dir den Daumen hineingedrückt. Ich hoffe, du hast von meinem Fausthieb wenigstens ein blaues Auge gehabt.«
Titus horchte überrascht auf und fragte: »Habt ihr miteinander gerauft, als ihr Kinder wart?«
»Nein, ich wohnte als Kind in Antiochia«, antwortete ich zerstreut, aber plötzlich glomm eine Erinnerung auf, und ich bekam vor Scham einen roten Kopf. Sabina sah mich forschend an, genoß meine Verwirrung und rief: »Aha, jetzt ist es dir wieder eingefallen! Du warst mit einer Bande von Sklaven und Strolchen unterwegs, ihr wart betrunken und verrückt und triebt euren Unfug auf offener Straße. Wir haben sehr wohl in Erfahrung gebracht, wer du bist, aber mein Vater wollte dich aus Gründen, die du selbst am besten kennst, nicht vor Gericht bringen.«
Ich erinnerte mich nur zu gut. Im letzten Herbst, auf einem von Neros nächtlichen Streifzügen, hatte ich versucht, ein Mädchen anzufangen, das uns entgegenkam, aber ich hatte von ihrer kleinen Faust einen solchen Schlag aufs Auge bekommen, daß ich auf den Rücken fiel, und hatte eine Woche lang ein blaues Auge gehabt. Ihre Begleiter griffen uns an, und Otho hatte später das Gesicht voll Brandblasen von einem Schlag mit einer brennenden Fackel. Ich war in jener Nacht so betrunken, daß ich kaum wahrnahm, was geschah.
»Ich habe dir nichts Böses getan. Ich nahm dich nur in die Arme, als wir im Dunkeln zusammenstießen«, verteidigte ich mich nun. »Wenn ich gewußt hätte, wer du bist, würde ich mich gleich am nächsten Tag bei dir entschuldigt haben.«
»Du Lügner«, entgegnete sie. »Versuche nur ja nicht noch einmal, mich zu umarmen. Es könnte dir noch schlechter ergehen als beim letzten Mal.«
»Ich würde es nie wagen«, versuchte ich zu scherzen. »In Zukunft ergreife ich die Flucht, wenn ich dich von weitem sehe, so übel bist du mit mir umgesprungen.«
Ich ergriff jedoch nicht die Flucht, sondern begleitete Sabina bis zum Haus des Stadtpräfekten. Ihre grünschillernden Augen waren voll Gelächter, und ihre nackten Arme waren glatt wie Marmor. Eine Woche später sammelte mein Vater ein Gefolge von zweihundert Klienten und ließ sich zum Haus des Flavius Sabinus tragen, um für mich um die Hand seiner Tochter anzuhalten.
Tullia und Tante Laelia hätten noch andere Partien für mich gewußt, aber diese Verlobung war nicht die schlechteste. Daß die Flavier arm waren, fiel bei dem Vermögen meines Vaters nicht ins Gewicht.
Auf Sabinas Wunsch wurden wir nach der längeren Formel getraut, obwohl ich nicht die Absicht hatte, in irgendein Priesterkollegium einzutreten, aber Sabina sagte, sie wolle eine Ehe fürs ganze Leben schließen und sich nicht gleich wieder scheiden lassen. Ich tat, was sie wollte, und wir waren noch nicht lange verheiratet, als ich bemerkte, daß ich ihr in noch so manchen anderen Dingen ihren Willen tat.
Die Hochzeit war ein großes Fest. Auf Kosten meines Vaters und im Namen des Stadtpräfekten wurden nicht nur der Senat und die Ritterschaft, sondern auch das ganze Volk zum Mahl geladen. Nero war ebenfalls anwesend und wollte unbedingt als Brautführer auftreten und zur Flötenbegleitung eine unanständige Hochzeitshymne singen, die er selbst gedichtet hatte. Zuletzt aber schwenkte er höflich seine Fackel auf und nieder und ging wieder, ohne einen Streit anzufangen.
Ich nahm Sabina den feuerroten Schleier vom Haupt und den gelben Hochzeitsmantel von den Schultern. Als ich aber die beiden festen Knoten in ihrem Leinengürtel lösen wollte, setzte sie sich mit grünfunkelnden Augen zur Wehr und rief: »Ich bin eine Sabinerin! Nimm mich zum Raube, wie die Sabinerinnen geraubt wurden!«
Читать дальше