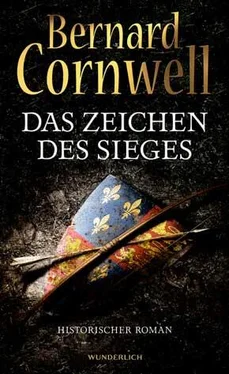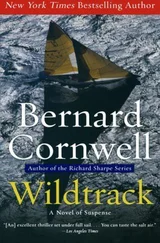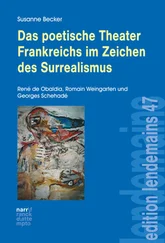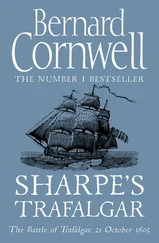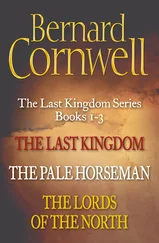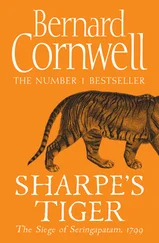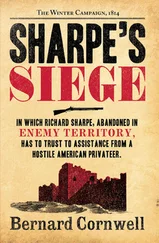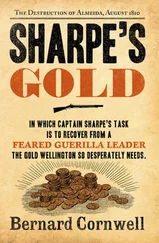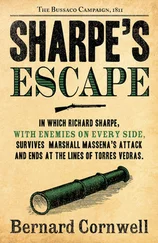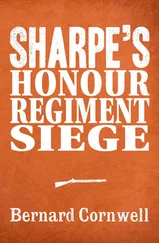Nun hatte Sir John Keegan allerdings recht damit, jedem Versuch, die Zahl der Beteiligten an mittelalterlichen Schlachten zu schätzen, eine «erhebliche Unsicherheit» zu attestieren. Wir sind in der glücklichen Lage, dass eine Reihe von Augenzeugen die Schlacht von Agincourt beschrieben haben, auch haben wir weitere schriftliche Quellen, die wenig später entstanden sind, und dennoch gehen darin die Schätzungen zu den Zahlen sehr weit auseinander. Englische Chronisten veranschlagen die Zahl der französischen Kräfte irgendwo zwischen 60000 und 150000, während in französischen und burgundischen Quellen alles zwischen 8000 und 50000 zu finden ist. Die vertrauenswürdigsten Augenzeugen setzen die französischen Kräfte mit 30000, 36000 und 50000 an, und sie alle tragen zu der erheblichen Unsicherheit bei, die Dr. Curry noch erheblicher macht. Ich selbst beschloss schließlich, mich der allgemein anerkannten Schätzung anzuschließen, dass etwa 6000 Engländer gegen rund 30000 Franzosen kämpften. Das war, wie ich betonen möchte, nicht das Ergebnis intensiver akademischer Studien, sondern eher das Bauchgefühl, dass sich in der zeitgenössischen Reaktion auf diese Schlacht ein ganz außerordentliches Ereignis spiegelt, und das Außerordentlichste an all den Berichten über Agincourt ist nun einmal dieses Missverhältnis zwischen den Zahlen der Beteiligten auf beiden Seiten. Ein englischer Kaplan, der die Schlacht miterlebt hat, schätzte dieses Missverhältnis auf dreißig Franzosen pro Engländer, eine offenkundige Übertreibung, und doch unterstützt sie die überlieferte Sicht, dass es die schiere zahlenmäßige Ungleichheit der beteiligten Parteien war, die das Volk dazu brachte, in Agincourt etwas wahrhaftig Außergewöhnliches zu sehen. Dennoch, ich bin kein Wissenschaftler, und Dr. Currys Schlussfolgerungen abzulehnen scheint mir vermessen.
Dann, noch im gleichen Jahr, in dem Dr. Currys Buch erschien, wurde Juliet Barkers Werk Agincourt veröffentlicht und erwies sich als anschauliche, großangelegte und fesselnde Schilderung des Feldzugs und der Schlacht. Juliet Barker würdigt Dr. Currys Schlussfolgerungen, lehnt sie jedoch Höflich und entschieden ab, und da Juliet Barker eine ebenso gute Wissenschaftlerin wie Schriftstellerin ist und sie, ebenso wie Dr. Curry, in französischen und englischen Archiven recherchiert hat, fühlte ich mich berechtigt, meinem Instinkt nachzugeben. Jeder Leser, der mehr über den Feldzug und die Schlacht wissen möchte, ist gut beraten, alle drei Bücher zu lesen, die ich erwähnt habe. Das Antlitz des Krieges von John Keegan, Agincourt, A New History von Anne Curry und Agincourt von Juliet Barker. Ich sollte noch anfügen, dass, obwohl ich viele, sehr viele Quellen genutzt habe, um diesen Roman zu schreiben, das Buch, das ich wieder und wieder mit neuem Vergnügen gelesen habe, Juliet Barkers Agincourt war.
Jenseits aller Debatten steht die disparate Zusammensetzung der englischen Armee. Sie bestand zum größten Teil aus Bogenschützen, deren Zahl die der Feldkämpfer schon beim Auszug aus England um das Dreifache übertraf und am Sankt-Crispins-Tag um das Sechsfache. Noch immer werden Auseinandersetzungen darüber geführt, endlose Auseinandersetzungen, wo diese Bogenschützen aufgestellt waren, ob sie alle an den Flanken der englischen Armee standen oder ob sie vor der Kampflinie der Feldkämpfer eingesetzt wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bogenschützen vor der Front standen, einfach weil ihr Rückzug zwischen den Reihen der Feldkämpfer, rechtzeitig bevor der Kampf Mann gegen Mann einsetzte, viel zu schwierig gewesen wäre. Ich meine, dass die überwiegende Mehrheit zur Rechten und Linken der Hauptkampflinie aufgestellt wurde. Eine gute Erörterung über die Rolle von Bogenschützen im Kampf findet sich in Robert Hardys phantastischem Buch Longbow, A Social and Military History.
Soweit möglich habe ich versucht, den historischen Ereignissen zu folgen, die sich an jenem feuchten Sankt-Crispins-Tag in Frankreich zugetragen haben. Kurz zusammengefasst, scheint es sicher zu sein, dass die Engländer zuerst vorrückten (und offenbar hat Henry wirklich gesagt: «Gefährten! Es geht los!») und ihre Kampflinie weiter vorne gerade noch innerhalb der Reichweite eines Bogenschusses neu aufstellten und dass die Franzosen törichterweise nichts gegen dieses Manöver unternahmen. Dann provozierten die Bogenschützen mit einem Pfeilhagel den ersten französischen Angriff. Dieser erste Angriff wurde von berittenen Feldkämpfern geführt, deren Aufgabe es war, die Bogenschützen auseinanderzutreiben und zu schlagen, doch dieser Versuch scheiterte. Zum Teil, weil sogar Pferde mit Rüstungen verhängnisvoll leicht von Pfeilen verletzt werden konnten, und zum Teil wegen der Stöcke, die als Hindernis ausreichten, um dem Angriff jede Wucht zu nehmen. Einige der zurücklaufenden französischen Pferde scheinen von den Pfeilen so verrückt gemacht worden zu sein, dass sie in die vorrückende erste französische Kampfeinheit galoppierten und in den dichten Reihen ein wahres Chaos verursachten.
Diese erste Kampfeinheit, die vermutlich aus achttausend Feldkämpfern bestand, hatte ohnehin schon ernsthafte Probleme. Das Feld von Agincourt war kurz zuvor für den Winterweizen gepflügt worden, und es stimmt, wenn Nicholas Hook sagt, dass man für den Winterweizen tiefer pflügt als für den Frühlingsweizen. Zudem hatte es in der vorausgegangenen Nacht wolkenbruchartig geregnet, und so mussten sich die Franzosen durch zähe Lehmerde schleppen. Es muss ein Albtraum gewesen sein. Niemand kam schnell voran, und die ganze Zeit über ging der Pfeil-beschuss weiter, und je näher die Franzosen an die englische Linie kamen, desto tödlicher wurden die Pfeile. Auch über die Wirkung von Bogenschüssen wird viel diskutiert. Einige Wissenschaftler behaupten, dass auch die kräftigste Ahlspitze, mit dem stärksten Eibenbogen geschossen, keine Plattenrüstung durchbohren kann. Doch warum sonst sollte Henry so viele Bogenschützen aufgestellt haben? Die Pfeile konnten den Rüstungsstahl durchbohren, auch wenn der Schuss dazu im rechten Winkel auftreffen musste, und zweifellos hielten die besten Rüstungen, etwa solche aus Mailand, besser stand. Und wenn nichts anderes, dann zwang der Pfeilsturm die Franzosen mit geschlossenen Visieren vorzurücken, wodurch ihre Sicht ganz wesentlich eingeschränkt wurde.
Ein guter Bogenschütze konnte in einer Minute fünfzehn Pfeile zielgenau abschießen. (Ich habe das jemanden mit einem Bogen tun sehen, der ein Zuggewicht von 110 Pfund hatte, also zwanzig bis dreißig Pfund weniger als die Bögen, die in Agincourt eingesetzt wurden, aber immer noch viel mehr als jeder moderne Wettkampfbogen. ) Wenn wir annehmen, dass die Bogenschützen von Agincourt einen Durchschnitt von zwölf Pfeilen in der Minute erreichten und dass 5000 Bogenschützen dort waren, bedeutet das, dass in einer Minute 60000 Pfeile auf die Franzosen geschossen wurden, eintausend Pfeile in der Sekunde. Es bedeutet außerdem, dass die Bogenschützen in zehn Minuten 60000 Pfeile abgeschossen hätten, und die Folgerung daraus ist, dass ihnen recht schnell die Pfeile ausgegangen sein müssen. Doch der Pfeilsturm hatte erreicht, dass die Flanken des ungeordneten französischen Vorstoßes nach innen auf die wartenden englischen Feldkämpfer zu gedrängt wurden. Dieses Schrumpfen der französischen Linie muss die Flanken der englischen Armee, die auf beiden Seiten mit Bogenschützen besetzt waren, dem Beschuss der französischen Armbrustschützen ausgesetzt haben, doch es Hegt kein Hinweis darauf vor, dass die Franzosen diese Gelegenheit nutzten. Abgesehen von einigen Salven zu Beginn der Schlacht scheinen die französischen Armbrustschützen sich kaum am Kampf beteiligt zu haben, ein schwerwiegender Fehler, der dem fatalen Mangel an Führerschaft auf der französischen Seite zugeschrieben werden muss.
Читать дальше