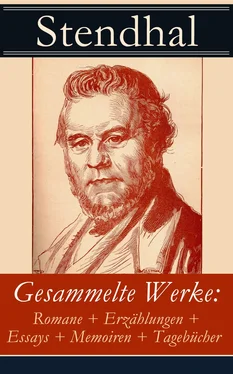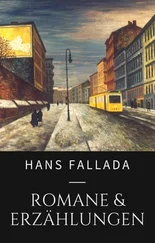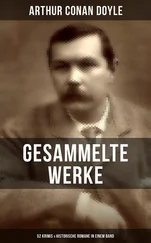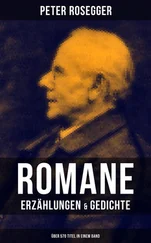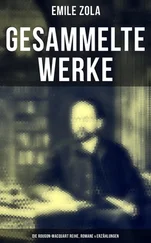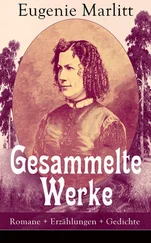›Nein,‹ fuhr dieses vor Eifersucht flammende Herz fort, ›anders läßt sich ihr entsagungsvolles Stilleben auf dem Lande unmöglich erklären. Tag für Tag, Mahlzeit für Mahlzeit das scheußliche Gesicht des Marchese del Dongo und dazu die niederträchtige Heuchlerfratze des Marchesino Ascanio, die noch schlimmer ist als die des Alten! Trotz alledem, ich will ihr offen und ehrlich dienen! Zum mindesten habe ich das Vergnügen, sie nicht mehr nur durch mein Opernglas zu sehen.‹
In der Scala legte der Kanonikus den Damen die Sachlage klar und deutlich auseinander. Im Grunde war Binder gar nicht ungünstig gesinnt. Es war ihm recht lieb, daß sich Fabrizzio aus dem Staube gemacht hatte, ehe der Haftbefehl aus Wien eingegangen war. Aber er konnte nichts Entscheidendes in der Sache tun; wie in allen anderen Angelegenheiten wartete er auf Befehle von oben. Täglich schickte er genaue Abschriften aller Ermittlungen nach Wien; im übrigen wartete er ab.
Er verlangte aber: erstens, daß Fabrizzio in seiner Verbannung in Romagnano alle Tage in die Messe gehe, daß er einen geistvollen, monarchisch gesinnten Beichtvater nähme und ihm nur ganz harmlose Dinge beichte; zweitens, daß er mit niemandem verkehre, der als aufgeklärter Mensch galt, und immer nur mit Abscheu von revolutionären Dingen wie von etwas streng Verpöntem spräche; drittens, daß er sich in keinem Kaffeehaus blicken ließe und nie andere Zeitungen als die Amtsblätter von Turin und Mailand läse, im allgemeinen eine Abneigung gegen jede Lektüre zur Schau trüge, insbesondere nichts läse, was nach 1720 gedruckt sei, die Romane von Walter Scott allenfalls ausgenommen.
Diesen Bedingungen fügte der Kanonikus ein wenig boshaft als vierte hinzu, er müsse vor allen Dingen irgendeiner hübschen Dame des Landes, selbstverständlich aus der vornehmen Gesellschaft, offenkundig den Hof machen. Damit werde er beweisen, daß er nicht den finsteren, unzufriedenen Geist eines angehenden Verschwörers habe.
Vor dem Zubettgehen schrieben die Gräfin und die Marchesa zwei endlose Briefe an Fabrizzio, in denen sie ihm in reizendster Besorgnis die Ratschläge, die Borda gegeben hatte, darlegten.
Fabrizzio hatte ganz und gar keine Neigung zu Verschwörungen. Er liebte Napoleon, hielt sich in seiner Eigenschaft als Edelmann für ein bevorzugtes Wesen und fand das Bürgertum lächerlich. Seit seiner Schulzeit hatte er nie ein Buch in die Hand genommen, und auch da hatte er keine anderen Bücher gelesen als solche, die von Jesuiten zurechtgestutzt waren. Er nahm seinen Wohnsitz in einem prächtigen Landschloß unweit Romagnanos, einem Meisterwerk des berühmten Baukünstlers San Micheli. Da es seit dreißig Jahren unbewohnt war, regnete es in alle Zimmer hinein, und kein Fenster schloß ordentlich. Er beschlagnahmte die Pferde des Verwalters und ritt sie früh wie abends. Er war wortkarg und nachdenklich. Der Rat, sich eine Geliebte aus der staatsgetreuen Gesellschaft zu wählen, erschien ihm spaßig, aber er befolgte ihn buchstäblich. Zum Beichtvater nahm er einen ränkesüchtigen jungen Priester, der Bischof werden wollte (wie der Beichtvater vom Spielberg: Für den General (1812 Marschall) Gouvion-Saint-Cyr (1764-1830) hat Stendhal eine Vorliebe. Er nennt ihn öfters in seinen Büchern. Vergleiche auch seine Erwähnung im Briefe an Balzac.). Mitunter legte er drei Meilen zu Fuß zurück und hüllte sich in ein Geheimnis, das er undurchdringbar wähnte, um den ›Constitutionnel‹ zu lesen, den er erhaben fand. ›Das ist ebenso schön wie Alfieri und Dante!‹ rief er oftmals aus. Darin hatte Fabrizzio eine Ähnlichkeit mit den jungen Franzosen, die sich viel angelegentlicher mit ihren Pferden und ihren Zeitungen beschäftigen als mit einer ihnen treuen Geliebten. Jedoch war in seiner unverdorbenen und starken Seele noch kein Raum zur Nachäfferei der anderen, und er gewann keine Freunde in der Gesellschaft des Städtchens Romagnano. Seine Schlichtheit galt für Hochmut; man wußte mit diesem Sonderling nichts anzufangen. »Er ist mißvergnügt, weil er nicht der Erstgeborene seines Hauses ist«, meinte der Pfarrer.
Wir wollen freimütig gestehen, daß die Eifersucht des Kanonikus Borda nicht ganz grundlos war. Nach seiner Heimkehr aus Frankreich erschien Fabrizzio der Gräfin Pietranera wie ein schöner Fremdling, den sie früher einmal gut gekannt hatte. Hätte er Liebesworte gesprochen, dann hätte sie ihn wiedergeliebt, zumal sie für sein Verhalten und für seine Art eine leidenschaftliche, ja grenzenlose Bewunderung hegte. Aber Fabrizzio umarmte sie in so ungemein harmloser Dankbarkeit und unbefangener Zuneigung, daß sie sich vor sich selber geschämt hätte, wenn sie hinter dieser geradezu kindlichen Freundschaft ein anderes Gefühl gesucht hätte. ›Im Grunde‹, sagte sich die Gräfin, ›mögen mich etliche Freunde, die mich vor sechs Jahren am Hofe des Fürsten Eugen gekannt haben, noch hübsch und sogar noch jung finden, doch für ihn bin ich die achtbare Tante und ohne jegliche Schonung meiner Eigenliebe muß ich es wohl sagen – ein Frau von Jahren.‹ Die Gräfin täuschte sich in der Beurteilung des Alters, das sie erreicht hatte, aber nicht in der Weise alltäglicher Frauen. ›In seinen Jahren‹, fügte sie hinzu, ›sieht man die Spuren der Zeit übertriebener, als sie wirklich sind; ein Mann von reiferer Lebenserfahrung hingegen…‹
Die Gräfin war in ihrem Salon auf und ab gegangen, dann blieb sie vor einem Spiegel stehen und lächelte. Man muß wissen, daß das Herz der Gräfin Pietranera seit ein paar Monaten durch eine seltsame Persönlichkeit ernstlich bestürmt wurde. Kurze Zeit nach Fabrizzios Abreise nach Frankreich war die Gräfin in tiefe Schwermut verfallen. Ohne daß sie es sich recht gestand, hatte sie sich viel mit ihm zu beschäftigen begonnen. Alles, was sie tat, erschien ihr reizlos und, wenn man so sagen darf, ohne Saft und Kraft. Sie glaubte, Napoleon, der seine italienischen Untertanen an sich fesseln wollte, werde Fabrizzio in seine persönliche Umgebung nehmen.
»Er ist für mich verloren!« rief sie weinend. »Nie werde ich ihn wiedersehen! Er wird mir Briefe schreiben, aber was bin ich ihm in zehn Jahren?«
In dieser Gemütsverfassung unternahm sie eine Reise nach Mailand; sie hoffte, dort genauere Nachrichten über Napoleon und, wer weiß, vielleicht auch auf Umwegen über Fabrizzio zu erhalten. Ihre tatenlustige Seele war des eintönigen Daseins, das sie auf dem Lande führte, bereits überdrüssig. ›Das ist tödliche Langweile, aber kein Leben!‹ sagte sie sich. Tag für Tag sah sie dieselben gepuderten Köpfe, den Bruder, den Neffen Ascanio und deren Kammerdiener! Was waren die Spaziergänge am See ohne Fabrizzio? Ihr einziger Trost lag in ihrer innigen Freundschaft mit der Marchesa. Aber seit einiger Zeit begann ihr diese Freundschaft zur Mutter Fabrizzios, die älter als sie war und vom Leben nichts mehr erwartete, nicht mehr so viel Freude zu machen.
Seit Fabrizzios Abreise war die Gräfin Pietranera in dieser sonderbaren Stimmung. Von der Zukunft erhoffte sie nicht viel; ihr Herz bedurfte des Trostes und neuer Anregung. Nach Mailand zurückgekehrt, fand sie ein leidenschaftliches Vergnügen an der neueren Oper; stundenlang schloß sie sich einsam in die Loge des Generals Scotti, ihres alten Freundes, ein. Die Menschen, deren Gesellschaft sie aufsuchte, um Nachrichten über Napoleon und seine Armee zu erfahren, kamen ihr gewöhnlich und grob vor. Zu Hause improvisierte sie dann auf ihrem Klavier bis drei Uhr morgens.
Eines Abends wurde ihr in der Loge einer ihrer Freundinnen, wo sie Neuigkeiten aus Frankreich einholen wollte, der Graf Mosca, Minister von Parma, vorgestellt, ein Weltmann, der über Frankreich und Napoleon in einer Weise plauderte, die ihrem Herzen neuen Stoff zu Hoffnungen und Befürchtungen gab. Am Abend darauf suchte sie diese Loge wieder auf. Der geistvolle Mann war ebenfalls da, und während der ganzen Vorstellung unterhielt sie sich mit ihm auf das beste. Seit Fabrizzios Weggang hatte sie noch keinen Abend so angenehm verlebt.
Читать дальше