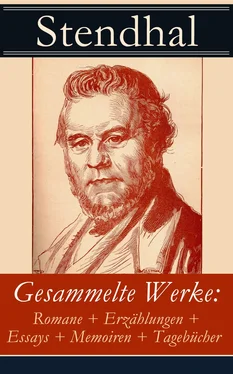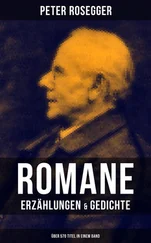Die seltsamsten Bilder spukten in Fabrizzios Kopf, und er war zu jedem anderen Zeitvertreib unfähig, außer zu dem, darüber nachzugrübeln, was seine Tante ihm so Wichtiges mitzuteilen habe.
Auf seiner Fahrt durch Frankreich wurde er zweimal angehalten, aber er wußte sich durchzuschwindeln. Diese Unannehmlichkeiten verdankte er seinem italienischen Paß und seiner sonderbaren Eigenschaft als Barometerhändler, zu der sein jugendliches Gesicht und sein verbundener Arm nicht gerade paßten.
Endlich fand er in Genf einen Mann aus der Dienerschaft der Gräfin, der ihm erzählte, daß er, Fabrizzio, bei der Mailänder Polizei angezeigt sei, und zwar, weil er Napoleon Vorschläge zu einer großen, sich über das ganze ehemalige Königreich Italien erstreckenden Verschwörung überbracht habe. Wozu, hieß es in der Anzeige weiter, habe er sonst auf seiner Reise einen falschen Namen angenommen? Seine Mutter wolle versuchen, den wahren Sachverhalt zu beweisen, das heißt, erstens, daß er niemals die Schweiz verlassen, zweitens, daß er das Schloß urplötzlich nach einem Zwist mit seinem älteren Bruder verlassen habe.
Bei dieser Nachricht überkam Fabrizzio ein stolzes Gefühl. »Ich soll eine Art Gesandter bei Napoleon gewesen sein!« sagte er sich. »Ich soll die Ehre gehabt haben, mit diesem großen Mann zu sprechen! Hätte es Gott so gefallen!« Er erinnerte sich, daß sein Vorfahr in der siebenten Generation, der Enkel jenes Dongo, der im Gefolge Sforzas nach Mailand gekommen war, die Ehre gehabt hatte, von den Feinden des Herzogs erwischt und geköpft zu werden, als er nach der Schweiz ging, um den löblichen Kantonen Vorschläge zu machen und Truppen zu werben. Vor seinem geistigen Auge erschien jener Stich aus der Chronik seiner Familie, der sich auf dieses Geschehnis bezog. Als er den Kammerdiener ausfragte, merkte er, daß dieser über eine Einzelheit besonders aufgebracht war, die ihm schließlich trotz dem ausdrücklichen und mehrfach eingeschärften Verbote der Gräfin entschlüpfte, nämlich, daß es Ascanio, sein älterer Bruder, gewesen sei, der ihn bei der Mailänder Polizei verleumdet habe. Diese grausame Kunde verursachte bei unserem Helden eine Art Tobsuchtsanfall.
Um von Genf nach Italien zu kommen, muß man über Lausanne. Fabrizzio wäre am liebsten auf der Stelle zu Fuß aufgebrochen und wäre zehn bis zwölf Meilen marschiert, obwohl die Post von Genf nach Lausanne schon in zwei Stunden abfahren mußte. Zu guter Letzt geriet er in einem der traurigen Genfer Kaffeehäuser noch mit einem jungen Menschen in Streit, der ihn, wie er sagte, sonderbar angesehen habe. Und das stimmte durchaus. Der phlegmatische und vernünftige Genfer, der an nichts dachte als an Geld, hielt ihn für verrückt. Beim Eintritt in das Kaffeehaus hatte Fabrizzio wilde Blicke nach allen Seiten geworfen und dann die Tasse Kaffee, die man ihm brachte, über seine Beinkleider verschüttet. Bei dem Wortwechsel entsprach Fabrizzios erste Bewegung ganz dem Cinquecento. Statt den jungen Genfer einfach zu fordern, zog er seinen Dolch und warf sich auf ihn, um ihn zu erstechen. In diesem Augenblick der Leidenschaft vergaß er alles, was er vom Ehrenkodex gelernt hatte, und folgte nur dem Instinkt oder, besser gesagt, den Erinnerungen seiner Kindertage.
Der Vertrauensmann, den er in Lugano traf, schürte seine Wut durch neue Einzelheiten noch mehr. Beliebt, wie Fabrizzio in Grianta war, hätte ohne das liebenswürdige Vorgehen seines Bruders kein Mensch seinen Namen erwähnt. Jedermann hätte getan, als wisse er ihn in Mailand, und nie wäre die Mailänder Polizei auf seine Abwesenheit aufmerksam geworden.
»Zweifellos haben die Zollbeamten Ihren Steckbrief,« sagte der Bote seiner Tante zu ihm, »und wenn Sie auf der Hauptstraße reisen, werden Sie an der Grenze des lombardo-venezianischen Königreichs festgenommen.«
Fabrizzio und seine Leute kannten in den Bergen zwischen Lugano und dem Comer See jeden Weg und Steg.
Sie verkleideten sich als Jäger, das heißt als Schmuggler, und da sie ihrer drei waren und recht energische Mienen zur Schau trugen, begnügten sich die Grenzwächter, die ihnen begegneten, mit einem Gruß. Fabrizzio richtete es so ein, daß er das Schloß erst gegen Mitternacht erreichte. Um diese Stunde waren sein Vater und die gepuderten Bedienten schon lange schlafen gegangen. Mühelos kletterte er in den tiefen Graben und stieg durch ein kleines Kellerfenster in das Schloß, wo er von seiner Mutter und seiner Tante erwartet wurde. Bald kamen seine Schwestern herbeigeeilt. Die Zärtlichkeitsergüsse und Tränen wollten nicht aufhören, und kaum begann man sich vernünftig zu unterhalten, als die ersten Strahlen der Morgensonne diese Menschen, die sich nun nicht mehr für unglücklich hielten, an die Flüchtigkeit der Zeit mahnten.
»Vermutlich hat dein Bruder keine Ahnung von deiner Heimkehr«, sagte die Pietranera zu ihm. »Ich habe seit seiner schönen Tat kein Wort mehr mit ihm gesprochen, wofür mir seine Eigenliebe die Ehre erwiesen hat, beleidigt zu sein. Heute beim Abendessen habe ich geruht, das Wort an ihn zu richten. Ich mußte einen Vorwand finden, um meine tolle Freude zu bemänteln, die ihn hätte argwöhnisch machen können. Als ich dann bemerkte, daß er auf diese scheinbare Aussöhnung ganz stolz war, habe ich mir sein Behagen zunutze gemacht und ihn über die Maßen zum Trinken verleitet. Sicherlich hat er heute nicht daran gedacht, sich auf die Lauer zu legen, um sein Spionieren fortzusetzen.«
»Wir müssen unseren Husaren in deinen Gemächern verbergen«, rief die Marchesa. »Er kann nicht sogleich wieder abreisen. Für den ersten Augenblick sind wir nicht genügend Herr unseres Denkens, und doch handelt es sich darum, die schreckliche Mailänder Polizei auf die beste Art zu beschwichtigen.«
Man befolgte ihren Vorschlag, aber es fiel dem Marchese und seinem ältesten Sohne tags darauf doch auf, daß die Marchesa ununterbrochen im Zimmer ihrer Schwägerin weilte.
Wir wollen uns nicht dabei aufhalten, den zärtlichen Freudenrausch zu schildern, der an diesem Tage jene glücklichen Wesen beseelte. Die italienischen Herzen werden viel mehr als unsere von Argwohn und törichten Gedanken gequält, die ihnen eine feurige Einbildungsgabe heraufbeschwört, dafür aber sind ihre Freuden inniger und währen länger. Jenen ganzen Tag über waren die Gräfin und die Marchesa vollkommen bar aller Vernunft. Sie nötigten Fabrizzio, seinen ganzen Bericht noch einmal zum besten zu geben. Schließlich kam man überein, die allgemeine Freude in Mailand weiter zu genießen, da es allzu schwierig dünkte, sie vor den Späheraugen des Marchese und seines Sohnes Ascanio länger zu verbergen.
Man nahm die gewöhnliche Barke des Hauses und fuhr nach Como. Anders zu handeln, hätte tausendfachen Verdacht erweckt. Als sie in Como anlegten, tat die Marchesa so, als ob sie in Grianta Papiere von größter Wichtigkeit vergessen hätte. Schnell schickte sie die Ruderknechte dahin zurück, so daß diese Leute keinerlei Beobachtungen darüber anstellen konnten, auf welche Weise die beiden Damen ihre Zeit in Como verbrachten. Kaum angekommen, mieteten sie auf gut Glück einen Wagen, wie sie an dem bekannten hohen mittelalterlichen Turm über dem Mailänder Tor auf Fahrgäste zu warten pflegen. Unverzüglich fuhr man ab, ohne daß der Kutscher Zeit hatte, mit irgendwem ein Wort zu wechseln. Eine Viertelstunde vor der Stadt begegnete den Damen ein Jäger, den sie kannten und der ihnen, da die Damen keinen männlichen Begleiter hatten, seine Ritterdienste bis an die Tore von Mailand anbot, wohin er einen Jagdausflug machte. Alles ging gut, und die Damen plauderten mit dem jungen Mann auf das vergnügteste, als an einer Biegung der Landstraße um den entzückenden Hügel und das Wäldchen von San Giovanni drei verkleidete Gendarmen den Pferden in die Zügel fielen.
»Ach, mein Mann hat uns verraten!« rief die Marchesa und ward ohnmächtig. Ein Wachtmeister, der ein wenig zurückgeblieben war, trat stolpernd an den Wagenschlag und sagte mit einer Stimme, als ob er aus dem Wirtshaus käme:
Читать дальше