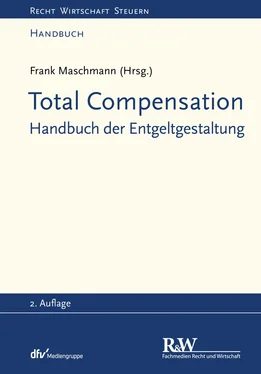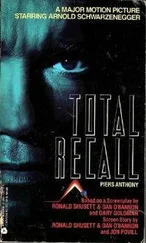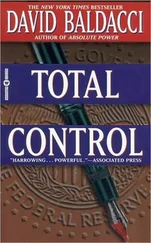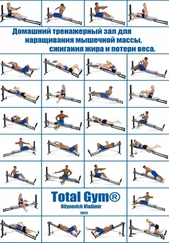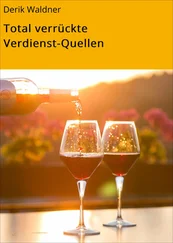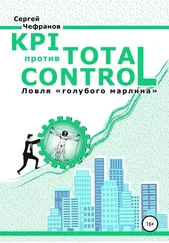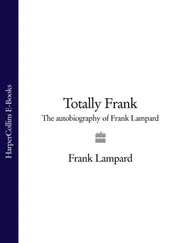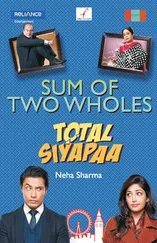24
Eine Ausnahmevon diesem Grundsatz kann jedoch zum einen dann vorliegen, wenn es im Tarifvertrag deutliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Tätigkeitsbeispiele nicht als „Richtbeispiele“ im genannten Sinne anzusehen sein sollen, sondern dass es auch bei Vorliegen einer dort genannten Tätigkeit die abstrakten Anforderungsmerkmale sein sollen, die die Eingruppierung bestimmen. Eine solche Regelung ist zu akzeptieren.
25
Beispiel: ETV Systemgastronomie (Dehoga) 2005, in dem es jeweils nach den Beispielstätigkeiten heißt: „soweit die in der Überschrift/den Oberbegriffen bzw. in der Tarifgruppendefinition geforderten Voraussetzungen erfüllt sind.“16
26
Ein Rückgriff auf die allgemein formulierten Anforderungen ist zum anderen dann erforderlich, wenn auch bei der Erfüllung eines Tätigkeitsbeispiels eine sichere Zuordnung zu einer Entgeltgruppe nicht möglich ist, etwa wenn bestimmte Tätigkeiten mehreren Entgeltgruppen unterschiedlicher Wertigkeit zugeordnet sind oder wenn die Tätigkeitsbeschreibung einen unbestimmten Rechtsbegriff enthält, der nicht aus sich selbst heraus ausgelegt werden kann und zu dessen genauerer Bestimmung deshalb die allgemeinen Merkmale herangezogen werden müssen.17 Bei deren Auslegung kann jedoch wieder auf die Richtbeispiele zurückgegriffen werden,18 z.B. zur Möglichkeit des Vergleichs mit im Wesentlichen gleichwertigen Tätigkeiten.
27
Einen völlig anderen Weg dagegen hat auch hier das neue Entgeltsystem in der Metall- und Elektroindustriebeschritten. Die meisten Bezirke haben den bei ihnen vereinbarten ERA-Tarifverträgen einen Katalog von „Niveaubeispielen“ beigefügt, in denen detailliert zahlreiche einzelne Tätigkeiten dargestellt und mit einer tariflichen Bewertung versehen werden. Nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Tarifverträge sollen diese „Niveaubeispiele“ jedoch keinesfalls als Richtbeispiele im klassischen Sinn angesehen werden (was bereits wegen der Detailliertheit der Beispiele, die teilweise konkreten Stellenbeschreibungen sehr ähnlich sind, kaum möglich ist), sondern lediglich als „zusätzliche Informations-, Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Bewertung und Zuordnung der übertragenen und auszuführenden Arbeiten zu den Entgeltgruppen (dienen); maßgeblich für die Eingruppierung sind die Merkmale der jeweiligen Entgeltgruppe“.19
2. Die rechtlichen Grundlagen für die Verbindlichkeit des Entgeltschemas im Arbeitsverhältnis
28
Eine Eingruppierung anhand eines abstrakten Vergütungsschemas erfolgt nur, wenn dieses für das Arbeitsverhältnis verbindlich ist. Dies ergibt sich nicht allein aus der Existenz eines solchen Schemas, sondern bedarf einer Rechtsgrundlage.
a) Normative Geltung eines tarifvertraglichen Vergütungssystems
29
Sind die Parteien eines Arbeitsverhältnisses tarifgebunden, d.h. Mitglieder einer Tarifvertragspartei oder – im Falle der Arbeitgeberseite – selbst Partei eines Tarifvertrags (sog. Haus- oder Firmentarifvertrag, vgl. § 2 Abs. 1 TVG), gelten dessen Normen im Rahmen seines Geltungsbereichs für das Arbeitsverhältnis unmittelbar und zwingend(§ 4 Abs. 1 TVG). Davon umfasst ist auch ein ggf. tariflich vereinbartes tarifliches Vergütungssystem.20
30
Ist ein Tarifvertrag mit einer Vergütungsordnung für allgemeinverbindlicherklärt worden (§ 5 TVG, im Ergebnis auch nach einer Rechtsverordnung gem. §§ 7, 7a AEntG), gilt er normativ in allen Arbeitsverhältnissen, die in seinen Geltungsbereich fallen. Dies ist derzeit insbesondere in den Branchen Bauhaupt- und -nebengewerbe, Gebäudereinigung, Sicherheitsdienste, Arbeitnehmerüberlassung, Pflegedienste usw. der Fall.21 Damit sind auch die entsprechenden, dort ggf. geregelten Entgeltordnungen für das Arbeitsverhältnis verbindlich .
b) Arbeitsvertragliche Bezugnahme auf den Tarifvertrag
31
Haben die Parteien des Arbeitsvertrags – ausdrücklich oder konkludent – die Anwendung eines Tarifvertrags oder eines Tarifwerks, das ein solches allgemeines Vergütungsschema enthält, vereinbart, so ist dieses verbindlich für ihr Arbeitsverhältnis. Die vertragliche Vereinbarung kann sich auch – was nicht selten ist – auf die Anwendung des tariflichen Vergütungsschemas beschränken, ohne dass sonstige tarifliche Regelungen Anwendung finden sollen. Ein gewichtiges Indiz für einen solchen dynamischen Bezug auf die tariflichen Vergütungsregelungen entnimmt das BAG etwa regelmäßig der Kennzeichnung des Entgelts im Arbeitsvertrag als „Tarifgehalt“.22 Der Unterschied zur normativen Geltung besteht darin, dass die Anwendung des Tarifvertrags jederzeit einvernehmlich genauso abbedungen werden kann, wie sie vereinbart worden ist. Weiterhin ist die vertraglich vereinbarte Anwendung auch dann verbindlich, wenn sie ein – tarifliches – Vergütungsschema betrifft, das eigentlich nicht einschlägig ist, weil auch fremde oder abgelaufene oder sonst unwirksame Tarifverträge wirksam in Bezug genommen werden können.23
32
Beispiel: Vertragliche Verweisung auf die hessischen Metalltarifverträge in einem außerhalb des Bezirks Hessen gelegenen Betrieb eines (hessischen) Unternehmens.24
33
Zur Charakterisierung der Verweisungsklauseln auf einen Tarifvertrag hat sich eine Unterteilung eingebürgert, die jedoch nicht abschließend ist, sondern lediglich eine „Hilfestellung“ bei der Auslegung und Anwendung darstellt. Danach lassen sich folgende Formen unterscheiden:
– Mit der statischen Verweisungsklausel wird der Inhalt eines ganz bestimmten Tarifvertrags in einer konkreten, d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt geltenden Fassung zum Inhalt des Arbeitsverhältnisses gemacht.
– Mit der kleinen dynamischen Verweisungsklausel nehmen die Parteien Bezug auf einen Tarifvertrag/ein Tarifwerk in seiner jeweiligen Fassung; die vereinbarten Arbeitsbedingungen folgen dabei den tariflichen Änderungen.
– Mit der großen Verweisungsklausel (auch „Tarifwechselklausel“ genannt) binden die Parteien ihr Arbeitsverhältnis an diejenigen Tarifverträge, an die der Arbeitgeber jeweils selbst gebunden ist.25
34
Zu beachten ist dabei, dass die einzelvertragliche („kleine“) dynamische Verweisung auf den jeweiligen Tarifvertrag und seine Vergütungsordnung nicht immer einschränkungslos ist. Eine Sonderform dieser Verweisung ist die sog. „ Gleichstellungsabrede“. Mit ihr wird vereinbart, dass die Dynamik der Verweisung, also die Heranziehung des jeweils geltenden Tarifvertragsunter der auflösenden Bedingung steht, dass der Arbeitgeber auch seinerseits normativ jeweils an den Tarifvertrag gebunden ist. An einer solchen Vereinbarung kann insofern ein Interesse des Arbeitgebers bestehen, als sie dazu führt, dass bei einem Wegfall seiner eigenen Tarifgebundenheit (sei es durch Verbandsaustritt, durch Wechsel in die OT-Mitgliedschaft oder durch den Übergang des Betriebs auf einen nicht tarifgebundenen Erwerber, § 613a Abs. 1 BGB) die Dynamik der Verweisung abreißt und von diesem Zeitpunkt die in Bezug genommene Vergütungsordnung nur noch statisch anzuwenden ist. Damit wäre ein Gleichlauf von normativ geltenden und vertraglich in Bezug genommenen Tarifbestimmungen gewährleistet. Eine solche auflösende Bedingung muss aber in der Verweisungsklausel hinreichend deutlich und ausdrücklich vereinbart sein, um die beabsichtigte Rechtsfolge herbeizuführen.26 Die früher von der Rechtsprechung des BAG vertretene Auffassung, eine solche auflösende Bedingung sei bei tarifgebundenen Arbeitgebern stets als vereinbart anzusehen, hat das BAG aufgegeben und lediglich für vor dem 1.1.2002 vereinbarte sog. „Alt-Verträge“ einen entsprechenden Vertrauensschutz gewährt.27
Читать дальше