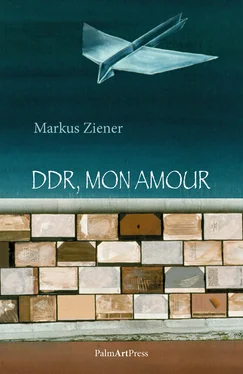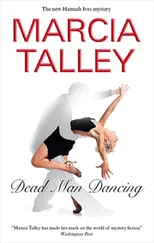„Und wie er das sagte”, warf nun der Mann ein. „Er schleuderte uns diesen Satz regelrecht entgegen, voller Wut, voller Aggression.”
„Mein Mann und ich schauten uns an, dann nahmen wir unser Gepäck und gingen hinaus zu dem wartenden Taxi. Mein Mann hat sich nicht einmal richtig von Frank verabschiedet, ich habe ihn noch kurz gedrückt.
Das war das letzte, was wir von ihm gesehen haben.“ Die Erzählung hatte mich so beeindruckt, dass ich die Geräuschkulisse um mich herum gar nicht mehr wahrnahm. Nach einem langen Moment des Schweigens fragte ich:
„Und wo leben Sie jetzt? Etwa hier?“
„Ja, hier in Fladungen. Ich habe eine Arbeit als Fahrlehrer gefunden”, sagte der Mann.
Als ahnte er meine nächste Frage, ergänzte er: „Wir wollten zunächst in eine große Stadt in Westdeutschland ziehen und noch einmal ganz von vorne anfangen. Aber schon nach ein paar Monaten kamen wir hierher in die Rhön. Wir hielten das Ganze nicht mehr aus, die Trennung, die zerrissene Familie. Wir wollten wenigstens in Franks Nähe sein.“
„Wir wollten wissen, wann bei ihm die Sonne scheint und wann es regnet. Wir wollten die gleiche Luft atmen“, sagte nun die Frau.
Ich schaute die beiden an, wie sie so dasaßen, der Mann vor dem halbleeren Bierglas und die Frau, die hilflos mit dem Löffel in ihrer gläsernen Teetasse rührte. Ich überlegte, was ich jetzt sagen sollte, aber mir fiel nichts Passendes ein, außer: „Diese Teilung ist ein Fluch“ zu sagen, worauf die beiden nickten.
Wieder schwiegen wir.
„Fahren Sie ab und zu hinüber in die DDR?”, fragte mich die Frau und ihre Stimme klang dabei seltsam zerbrechlich.
Ich nickte.
„Könnten Sie sich vorstellen, auf einer Ihrer Reisen einmal unseren Sohn zu besuchen?”
Während sie das sagte, fing ich den Blick ihres Mannes auf. Es war ein missbilligender Blick.
„Warum nicht”, sagte ich vorsichtig. Die Frau holte ein Stück Papier aus der Tasche und begann, ihre Anschrift und die ihres Sohnes aufzuschreiben. Dann schob sie den Zettel zu mir rüber.
Ich studierte die Adressen. Der Wohnort des Sohnes sagte mir nichts. Mit dem Zettel in ihre Richtung weisend fragte ich: „Würde er denn überhaupt einen Fremden empfangen?“
Sofort war ich unzufrieden mit mir, denn schon diese Rückfrage vermittelte Hoffnung. So, als sei ich bereits einverstanden damit, den Sohn zu besuchen.
„Ja, ich denke schon, aber wir wollen Sie zu nichts drängen.“ Ich sah, wie sie ihrem Mann, der noch immer unglücklich wirkte, einen schnellen Blick zuwarf. Dann reichte sie mir einen weiteren Zettel und bat mich, auch meine Adresse zu notieren. „Wir wollen nur wissen, wie es ihm geht“, sagte beschwichtigend jetzt der Mann, wohl, um mir die Befürchtung zu nehmen, ich solle Kurierdienste übernehmen. Ich nickte, schrieb meine Adresse auf und machte danach der Bedienung ein Zeichen, dass ich zahlen wolle.
„Ich hoffe, wir haben Sie nicht belästigt?”
Ich schüttelte heftig den Kopf, vielleicht zu heftig.
„Nein, nein, ganz und gar nicht. Es tut mir aufrichtig leid, was Ihrer Familie geschehen ist. Ich melde mich, wenn ich das nächste Mal nach drüben fahre.“
Ich stand auf, wir gaben uns die Hände, dann verließ ich die Gaststube und ging hinaus auf die Straße. Ich wollte jetzt unbedingt noch ein paar Schritte gehen.
Ich wollte an die frische Luft.
Beim Wirt bezahlte ich am nächsten Morgen die Rechnung für die Übernachtung. Ich steckte gerade das Rückgeld ein, als der Wirt sagte, ich sei wohl von dem Ehepaar, das am Abend bei mir mit am Tisch gesessen hatte, angesprochen worden. Ich schaute auf und nickte. „Sie haben gefragt, ob Sie in der Angelegenheit mit ihrem Sohn helfen können?”
Ich war etwas überrascht und nickte wieder. „Ja, das haben sie.”
„Sie fragen fast jeden“, sagte jetzt der Wirt, während er die Quittung für die Übernachtung in einen Umschlag steckte. „Sie kommen nicht darüber hinweg.“
„Bekommen sie Hilfe?“
Der Wirt schaute amüsiert. „Von wem? Vom westdeutschen Staat? Nein. Es gibt einfach zu viele solcher Schicksale.” Ich schwieg.
„Nehmen Sie sich in Acht”, sagte der Wirt nun. „Die da drüben haben wenig Sympathien für Fluchthelfer.” Ich lachte etwas unbeholfen, weil ich mich fragte, was die Bemerkung jetzt eigentlich sollte, und verabschiedete mich.
Ich war kein Fluchthelfer. Alles andere als das. Allerdings hatte ich mit Frieder tatsächlich einmal über Fluchthilfe gesprochen. Das war bei einem meiner ersten Besuche. Wir saßen in Frieders Wohnung in Camburg und tranken DDR-Bier. Frieder hatte „Ur-Krostitzer Pils“ auf den Tisch gestellt, extra für mich, wie er sagte. „Sternburg Export kriegst du immer”, sagte Frieder wie zu sich selbst und wog dabei eine der Flaschen Ur-Krostitzer in der Hand. „Das hier aber nicht.” Ich trank - und lobte das Bier, auch wenn ich fand, dass mich sein Geschmack jetzt nicht gerade umwarf. Für Frieder aber war es etwas ganz Besonderes. „Wenn du Bier kaufst, dann musst du immer auf die Farbe der Flaschen achten”, sagte Frieder. „Kaufe nie grün, immer braun.” Ich verstand nicht. „Braunes Glas lässt weniger Licht durch”, dozierte Frieder aus dem DDR-Einmaleins. „Grüne Flaschen aber schon. Das Bier wird schneller flockig - und schlecht.” „Aha”, sagte nun ich und nickte wie ein gelehriger Schüler.
Nachdem wir schon ein paar Flaschen geleert hatten, sagte Frieder: „Robert, was wäre eigentlich, wenn du den Behörden hier sagen würdest, dass du deinen Pass verloren hättest? Du bekommst einen provisorischen Ausweis, und ich reise in der Zwischenzeit einfach mit deinem Pass aus.”
„Dann müsstest du aber auch mit meinem Auto rausfahren und mit meinem Führerschein. Und wirklich ähnlich sehen wir uns ja nicht.“
„Das Bild müsste man fälschen, das kriegen wir schon hin“, erwiderte Frieder. Ich merkte, wie er langsam Gefallen fand an dem Gedankenspiel. „Aber warum mit dem Auto?“
„Weil hier“, jetzt holte ich meinen Pass heraus und zeigte ihm den Einreisestempel, „ein kleines Auto eingestempelt ist. Das heißt, dass ich auf der Straße gekommen bin, und nicht etwa auf der Schiene. Ich, also du, kann jetzt nicht einfach mit dem Zug wieder rausfahren aus eurer schönen DDR.“
„Dein Auto könnte kaputt sein“, sagte Frieder. „Also meins.” Dabei grinste er. „Eure Luxuskarossen sind doch sowieso nicht geeignet für unsere sozialistischen Straßen.“ Frieder amüsierte sich. Und ich musste daran denken, dass ich bei der Fahrt über schier endlose Straßen mit Kopfsteinpflaster in der Tat überlegt hatte, wie lange mein Renault das aushalten würde.
„Und du glaubst, du könntest dich einfach so in den Zug setzen und an der Grenze sagen, dass der Renault seinen Geist aufgegeben hat, du ihn irgendwo abgestellt hast und deshalb mit der Bahn fährst.” Dabei zog ich die Augenbrauen hoch und lächelte.
„Wahrscheinlich nicht“, räumte Frieder ein. „O.k., dann fahre ich eben mit deinem Renault raus. Du kannst ja so lange meinen Trabi nehmen.” Frieder begann herzlich zu lachen.
„Du meinst, so lange sie mich hierbehalten.” Ich lachte nun auch. „Ich verstehe schon: Im Grunde willst du, dass wir tauschen. Ich bin du und lebe ab sofort in Camburg. Und du bist ich und lebst in Würzburg.“
So ging unser Gespräch an diesem Abend noch eine Weile hin und her, im wesentlichen unernst, aber auch wieder nicht so ganz.
„Werden sie uns hier irgendwann mal rauslassen?“, fragte Frieder dann ziemlich plötzlich.
Ich schaute Frieder an und schwieg. Auch, weil ich, der so viel jüngere von uns beiden, von dieser Frage überrascht war. Frieder wirkte auf einmal hilflos, beinahe wie ein Kind. Was sollte ich auf diese Frage antworten? „Ich weiß es nicht“, sagte ich nach einer Pause. Dann, wohl um die Stille und die Traurigkeit des Moments abzuschütteln, stand Frieder auf und holte zwei weitere Flaschen Ur-Krostitzer vom Balkon. „Ist ja auch nicht so wichtig“, sagte er, als er die Flaschen öffnete. „Ich will ja auch gar nicht weg. Bei euch Kapitalisten mit dem ständigen Konkurrenzkampf würde es mir ohnehin nicht gefallen.“ Frieder hatte jetzt wieder jenen Gefühlszustand erreicht, der ihm sein Leben in der DDR erträglich machte. Ein Zustand, der aus einer Mischung aus Realismus, Resignation, Zynismus und Ironie bestand. Ein Cocktail, den ich aus dem Westen nicht kannte.
Читать дальше