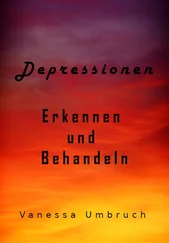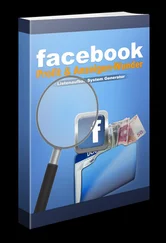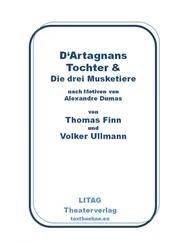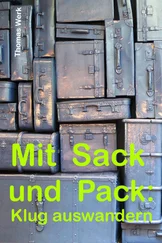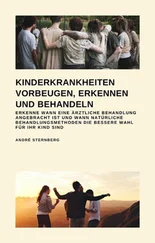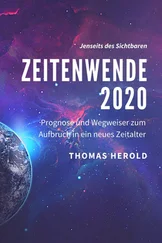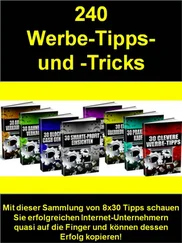„Reaktanz ist der Beweis dafür, dass wir zur Freiheit geboren sind.“
Fakt ist für mich: Je mehr ich mich mit ihr befasse, desto mehr staune ich darüber, was die Reaktanz für eine starke und unterstützende Kraft ist. Wie eine Art emotionales Trüffelschwein, das ja auch „blind“ schon über der Oberfläche die Trüffel schnüffeln kann, erspürt sie treffsicher, wenn das innere Gleichgewicht, die Balance und die Harmonie in einer Angelegenheit, in einer Beziehung oder in Gruppen bedroht sind. Dieses angeborene „steinzeitliche“ Frühwarnsystem kann dabei helfen, das innere und äußere Gleichgewicht zu wahren oder wiederherzustellen. Mit der Reaktanz als Gerechtigkeitssensor lässt sich ein inneres Gespür für das richtige Maß und für die Wahrung der Freiheit finden. Wer reaktantes Verhalten als hilfreichen Impuls begreift und Methoden zum Vermindern hat, kann knifflige Situationen, den Umgang miteinander, das Betriebsklima in der Tiefe verbessern.
Früher konnte ich Menschen, die sich reaktant verhielten, nicht besonders leiden. Sie störten mich richtig. Verwundert dachte ich: „Der/die war doch bisher ganz vernünftig. Und jetzt schießt er/sie auf einmal so quer! Wenn der oder die doch bloß nicht in der Gruppe wäre!“
Das vorhin geschilderte gelassene Bis-fünf-Zählen ist heute mein erster Schritt. Es lohnt sich auch zu beobachten, ob diese Person die Balance selbst wiederherstellt oder ob sie’s noch eins weitergibt. Und hin- und dahinterzuhören, mit welchen Argumenten sie es tut. Denn die Reaktanz berät mich immer treffsicher dort, wo ein emotionaler Reibungspunkt von mir oder anderen übersehen wurde. Reaktantes Verhalten zeigt stets an, wo in einem Gespräch oder in einer Gruppe unbewusst eine emotionale Hürde entstanden ist, durch die das Gleichgewicht zu kippen droht. Und da der Blindwiderstand so gesetzmäßig auftritt, ist er auch so überraschend leicht kalkulierbar.
Wer Reaktanz bei sich selbst und anderen zu erkennen weiß, kann sie umnutzen lernen, um so das Gleichgewicht sofort auf produktive und entstressende Weise wiederherzustellen.
Wer Reaktanz bei sich selbst und anderen zu erkennen weiß, kann sie umnutzen lernen, um so das Gleichgewicht sofort auf produktive und entstressende Weise wiederherzustellen.
Das wurde im Laufe der Jahre immer mehr zu meiner Leidenschaft: die Klugheit und Kreativität von Einzelnen und von Gruppen aktivieren und Haupt-Reaktanz-Auslösern methodisch begegnen – mit entstressenden Spielregeln, mit fein geschliffenen Code-Sätzen und mit handfesten Tools.
Und je besser ich lernte, den Blindwiderstand umzunutzen, desto mehr erwies sich die Reaktanz als ein segensreiches Instrument. Was mir daran besonders gefällt: Ein kluger Umgang mit Reaktanz kann dabei helfen, mehr Fairness, mehr Gerechtigkeit und mehr Friedfertigkeit in Gruppen und überhaupt in alle Begegnungen von Menschen zu bringen. Und das gehört für mich zu den Zielen. Denn gerade in dieser aktuellen Zeit passieren so viele reaktant machende Dinge: Verunsicherung wegen des Klimas, der Technologisierung, den vielen Fremden, die nicht mehr in Terror und Armut leben wollen. Wann, wenn nicht jetzt, wäre es wünschenswert, die Gesellschaft positiv zu verändern? An die Stelle von instinktivem „Dagegensein“ könnte eine hilfreichere und friedfertigere, eine wertschätzendere und kompetenzsteigernde Umgangs-Kultur etabliert werden, die zugleich Grenzen konsequenter klärt und umsetzt.
Wie ich dazu kam und wie die Entdeckungsphasen verliefen, welche unterstützenden Sätze, Tools und Methoden beim Weiterentwickeln halfen, das möchte ich im Folgenden an vielen Beispielen von prägenden Erlebnissen und verändernden Erfahrungen anbieten.
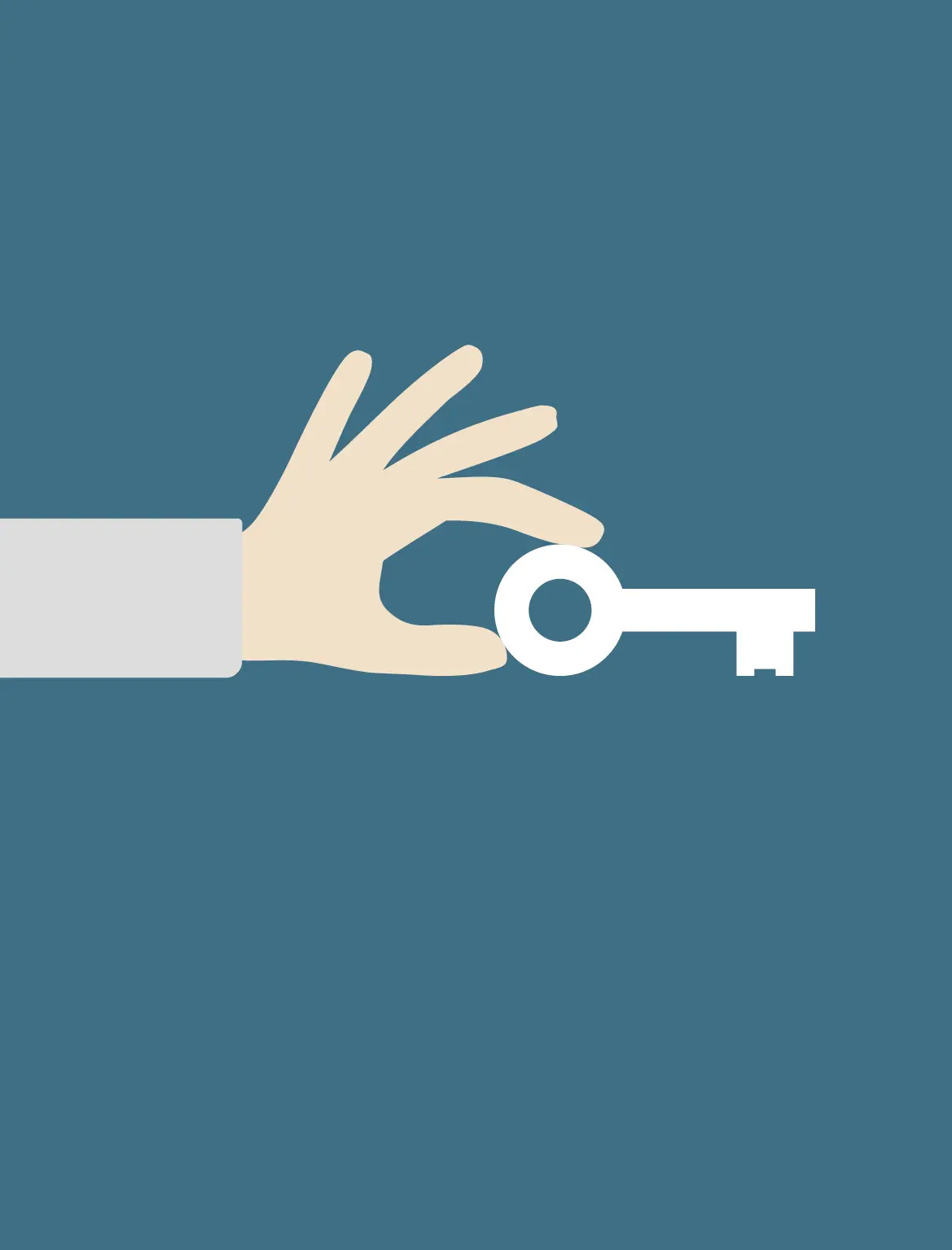
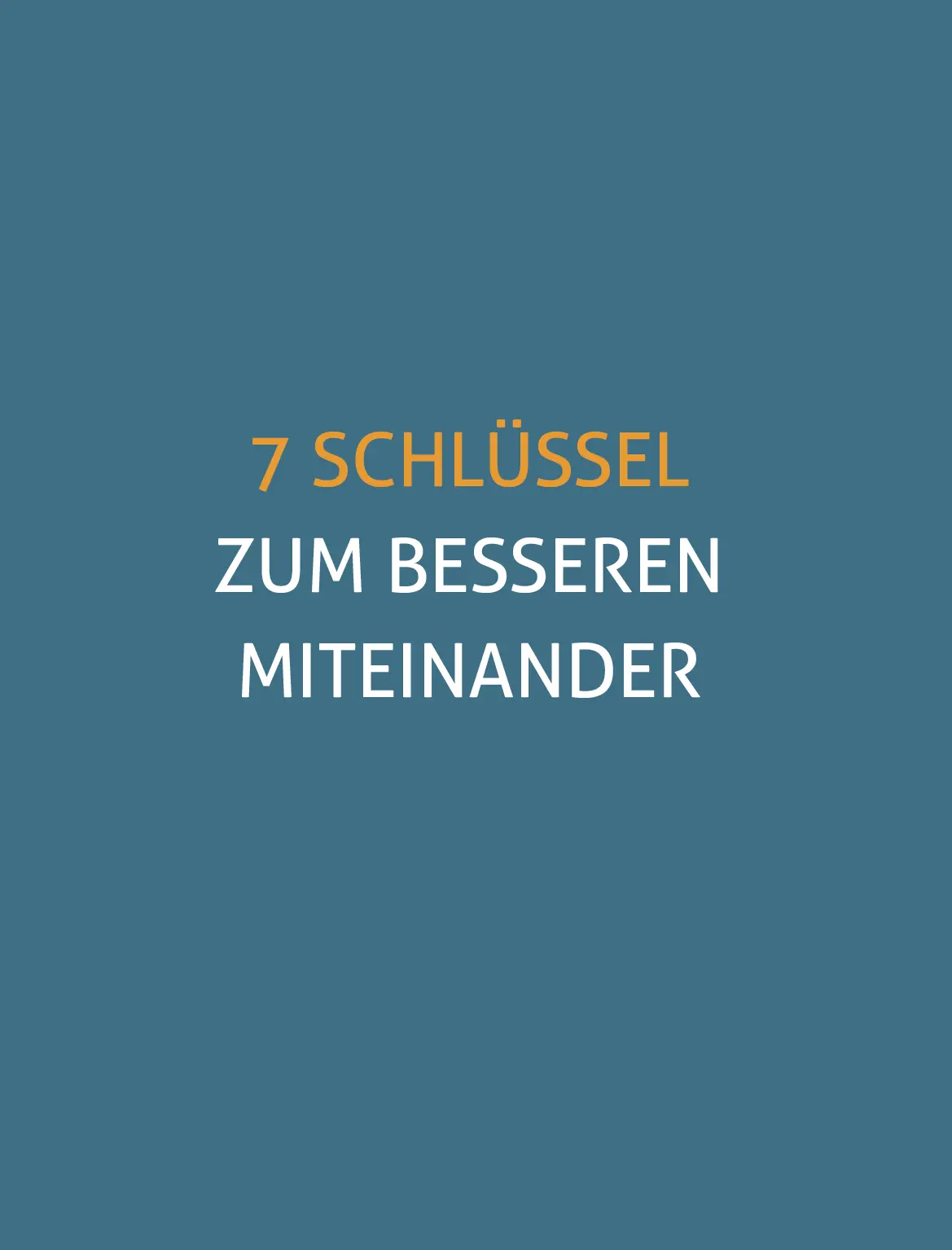
Live aus Dublin ohne Ahnung oder:
Wie alles anfing
Mein Start als Radiomoderatorin mit 21 Jahren ergab sich durch Zufall. Aus dem Stand – ohne ein einziges Wort der Instruktion und außerdem noch komplett ohne Internet – war der Auftrag, eine erste Live-Reportage über Reisemöglichkeiten in Irland für das WDR-Morgenmagazin auf WDR 2 zu machen. Das war 1968 praktisch der einzige Sender in NRW.
Unvorstellbar heutzutage: Radio war damals viel wichtiger als Fernsehen. Denn Fernsehen – das waren ja erst mal nur zwei Programme und später die Dritten, die fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden. Und die beiden Haupt-Programme sendeten bis in den Nachmittag hinein das Testbild. Und ab ca. 23:30 Uhr auch wieder.
Die Live-Sendung „Morgenmagazin“ war mit über 7 Millionen Hörer-inne-n die meistgehörte Sendung in NRW. Na toll. Wegen des enormen Lampenfiebers sind bei mir nur noch schemenhafte Erinnerungen an diese Live-Reportage aus Dublin und das Bild eines gruselig-chaotisch beschriebenen Spickzettels vorhanden. Irgendwie brachte ich es dann doch hinter mich, auch wenn ich Blut und Wasser schwitzte und das Gefühl hatte, nur Unsinn geredet zu haben.
Im Nachhinein empfinde ich viel Dankbarkeit für die Chancen, die sich daraus für mein weiteres Leben ergeben haben. Aber an sich war es rückblickend und mit meinem heutigen Kenntnisstand unverantwortlich, so untrainiert und reaktant bis unter die Haarwurzeln auf die Menschheit losgelassen zu werden.
Da die Redaktion den Auftritt offenbar weniger schrecklich fand als ich selbst, gehörte ich nach drei Monaten und zwei Probesendungen ab August 1968 zum Team der ersten Moderatorinnen des WDR-Morgenmagazins. Das war damals nämlich die einzige Sendung in der Abteilung Politik, bei der Frauen geduldet waren – allerdings nur in Form der Doppel-Moderation mit Männern. Unverhohlen und natürlich „enorm beflügelnd“  redeten die männlichen Kollegen ungeniert darüber, dass Frauen für solche Aufgaben eigentlich nicht geeignet seien. Minister und andere wichtige Persönlichkeiten wurden deshalb vor allem von Männern interviewt. Frauen bekamen jemand richtig prominenten meistens nur dann ab, wenn mehrere davon in einer Sendung vorkamen.
redeten die männlichen Kollegen ungeniert darüber, dass Frauen für solche Aufgaben eigentlich nicht geeignet seien. Minister und andere wichtige Persönlichkeiten wurden deshalb vor allem von Männern interviewt. Frauen bekamen jemand richtig prominenten meistens nur dann ab, wenn mehrere davon in einer Sendung vorkamen.
Und dass sich die Frauen damals vernetzt hätten? Um Gottes Willen. Erst seit 1968 durften Frauen selbstständig ein Bankkonto eröffnen, ihre Arbeitsverträge mussten sie bis 1977 noch von ihren Männern unterschreiben lassen. Wegen der realen Abhängigkeit von den Männern herrschte die berüchtigte Stutenbissigkeit. Erst ab 1974 durften Frauen die WDR-Hörfunk-Nachrichten vorlesen – nachdem das ZDF mit Wibke Bruhns in der „heute“-Sendung ab 1971 in Vorlage getreten war. Und erst ab 1986 (!), als der Chef des Mittags-Magazins in Rente ging, durfte auch diese Sendung von einer Frau moderiert werden.
Tja, meine Voraussetzungen für den Moderations-Job waren also: keine. Ich befand mich noch mitten im Studium. Na ja, vielleicht gab es doch etwas: ein ganz eloquentes Mundwerk und ein bisschen Mutterwitz: „Kann gut Witze erzählen und Dialekte nachmachen“, hieß es.
Ich ahnte damals zwar noch nicht, wie wenig Ahnung ich hatte. Aber ich war mir in einem ganz sicher: Das, was ich da ablieferte, war auf keinen Fall gut genug. Doch es war mir rätselhaft, wie es besser gehen könnte. Zu der Zeit war Radio im Wesentlichen perfekt vorgelesene Zeitung: durchgeschliffen formuliert, bloß keine Versprecher, an den richtigen Stellen atmen, mit wohlklingender Stimme reden. Als erlernbar galt der Moderationsberuf nicht. Okay, für Sprecher-innen gab es Stimm- und Sprecherziehung. Aber für das Journalistische? Nein, nein. Da hieß es: „Man hat es, oder man hat es nicht“.
Читать дальше
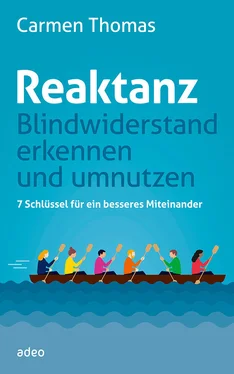
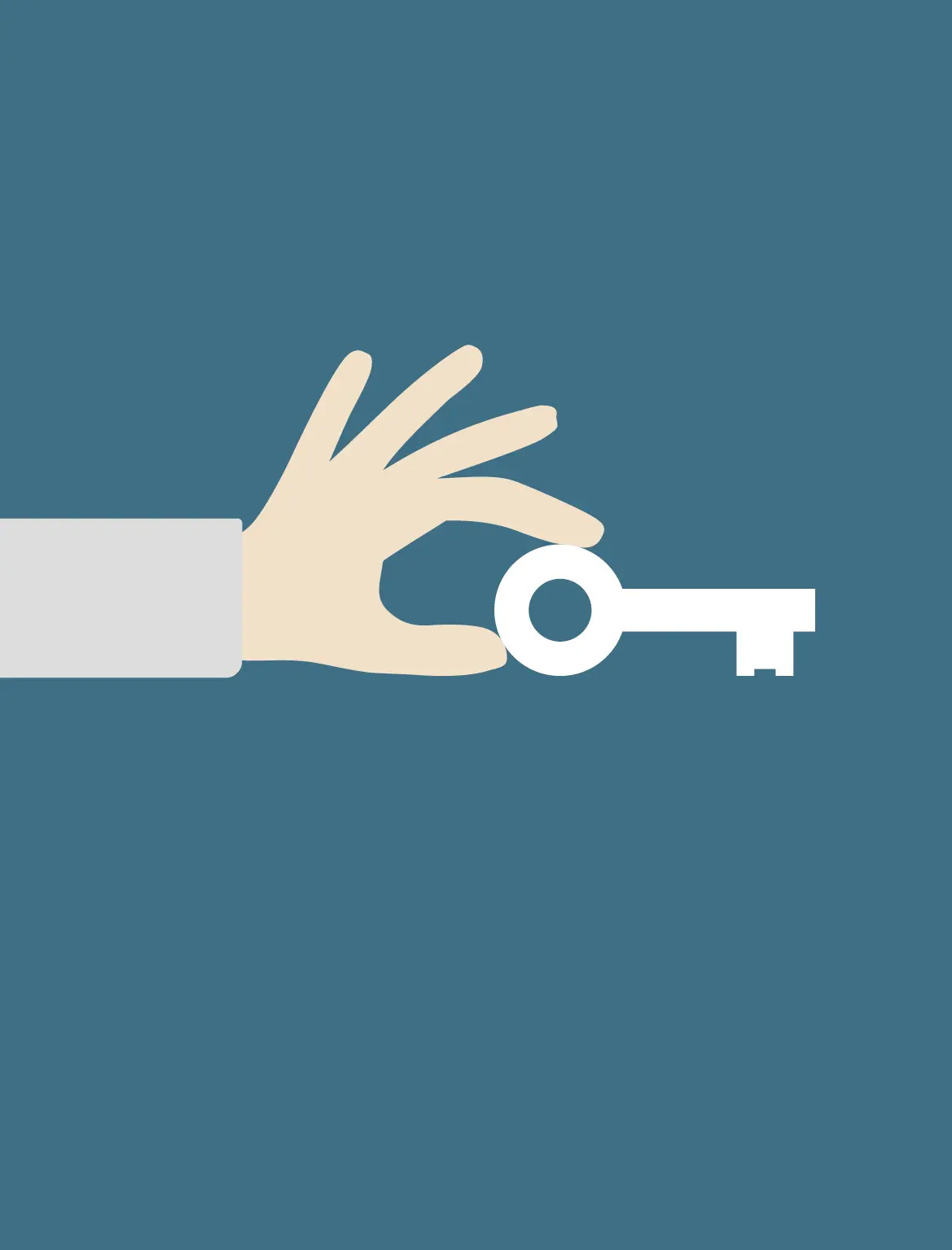
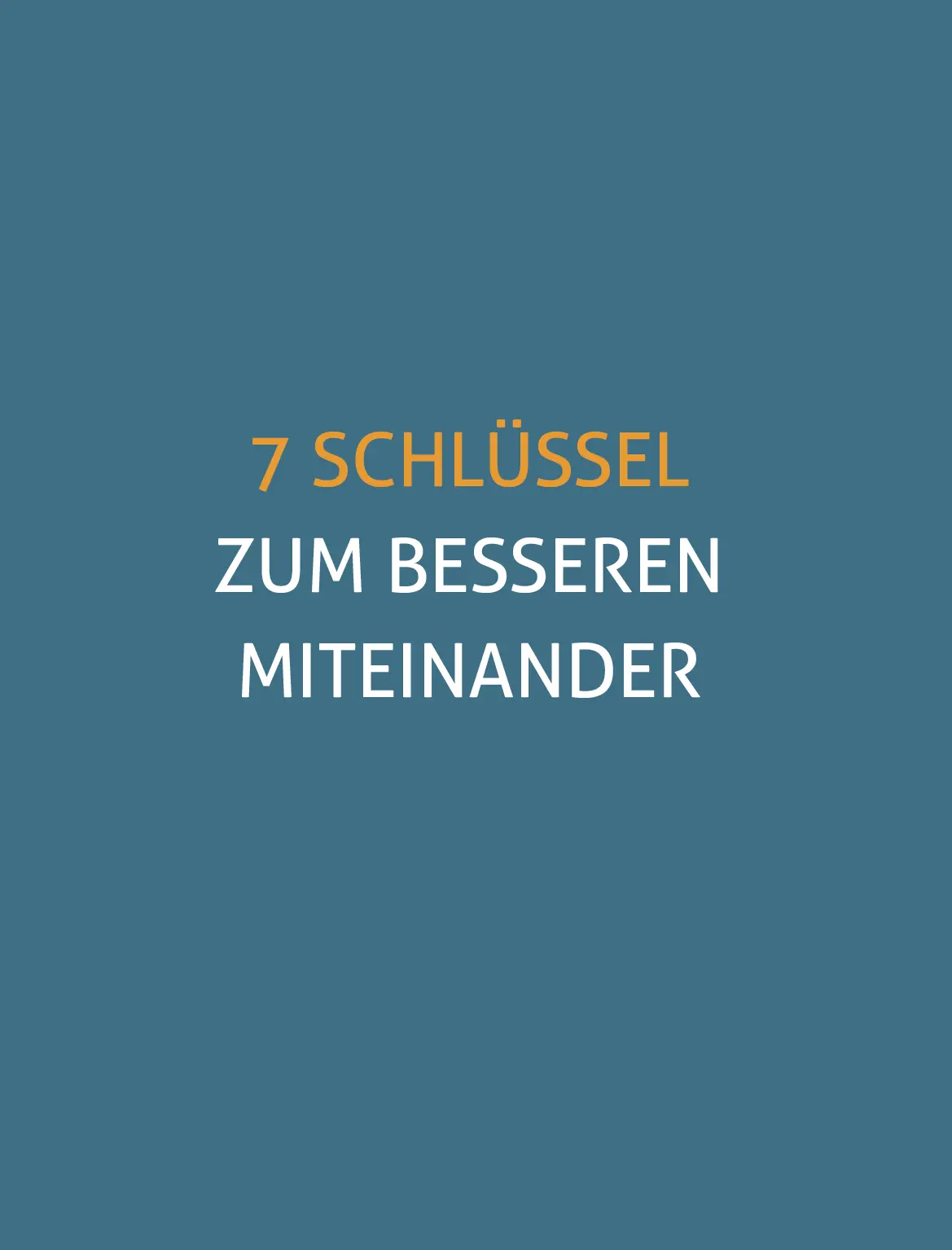
 redeten die männlichen Kollegen ungeniert darüber, dass Frauen für solche Aufgaben eigentlich nicht geeignet seien. Minister und andere wichtige Persönlichkeiten wurden deshalb vor allem von Männern interviewt. Frauen bekamen jemand richtig prominenten meistens nur dann ab, wenn mehrere davon in einer Sendung vorkamen.
redeten die männlichen Kollegen ungeniert darüber, dass Frauen für solche Aufgaben eigentlich nicht geeignet seien. Minister und andere wichtige Persönlichkeiten wurden deshalb vor allem von Männern interviewt. Frauen bekamen jemand richtig prominenten meistens nur dann ab, wenn mehrere davon in einer Sendung vorkamen.