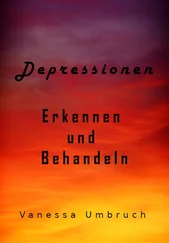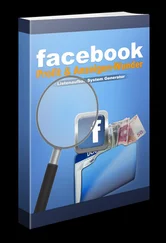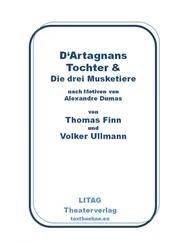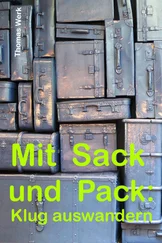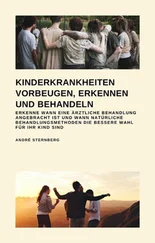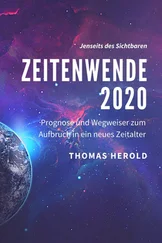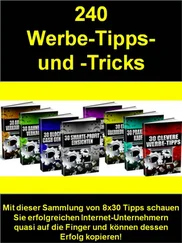Der Psychiater und Begründer der Logotherapie, Viktor E. Frankl, nutzte bei seinen Patienten etwas, das er „paradoxe Intervention“ nannte. Und das ist im Grunde umgenutzte Reaktanz: Wer Schlafstörungen hat, so Frankl, solle sich mit aller Kraft vornehmen, unbedingt wach zu bleiben – und schläft dann unweigerlich ein. Wer bei Auftritten in der Öffentlichkeit errötet, versuche beim nächsten Mal mit aller Kraft, rot anzulaufen – und dann geht es nicht.
Und hier noch eine schmutzige Erfolgs-Geschichte unter dem Motto „Reaktanz künstlich erzeugen, um damit auszubeuten“: Der Finanzbetrüger Bernie Madoff nutzte ab den 1960er-Jahren in den USA über lange Zeit den Reaktanz-Trick: Er verbreitete überall, er könne leider keine anlagewilligen Kunden mehr annehmen – egal, wie viel Geld sie anböten. Mit dieser angeblichen Verknappung löste er einen regelrechten Run auf seine Firma aus. Und dann veruntreute er die ihm anvertrauten Gelder in Milliardenhöhe. Er schreckte auch nicht davor zurück, gemeinnützige Organisation und Stiftungen zu schröpfen.
Grüße aus dem Neanderthal
Mich hat die Einsicht fasziniert, dass die Reaktanz als Blindwiderstand ganz unbewusst aufkommt. Denn klar: Wem etwas gegen den Strich geht, das er oder sie begründetermaßen als scheußlich oder schlecht empfindet, der oder die stellt sich meist offen dagegen und rebelliert. So erleben die meisten Menschen den normalen erkennbaren inneren Widerstand.
Bei der Reaktanz dagegen spricht interessanterweise als Erstes der Körper unwillkürlich mit. Es ist eine deutlich spürbare, aber verdeckte Sprache, die offenbar aus einer chemischen Reaktion des Körpers stammt: Der berühmte „dicke Hals“ schwillt an, der Bauch wird hart, oder es entsteht Druck irgendwo anders im Körper. Die Stellen sind individuell verschieden. Aber – und das ist der Unterschied – der Grund dafür ist nicht sofort transparent. Er ist „blind“. Ein Mensch versteht sich dann plötzlich selbst nicht mehr: „Ich bin dagegen, ich weiß aber gar nicht, warum.“ Dieser innere Blindwiderstand kann komplizierenderweise sogar dafür sorgen, dass ein Mensch nicht mehr seiner eigenen Meinung ist und anders empfindet als sonst, ohne das recht einordnen zu können.
Bei der Reaktanz spricht als erstes der Körper unwillkürlich mit: Der berühmte „dicke Hals“ schwillt an, der Bauch wird hart, oder es entsteht Druck irgendwo anders im Körper.
Es passiert ständig und unterschwellig überall. Sowohl im Umgang mit sich selbst als auch im Verhalten mit anderen: in der Familie, im Job, in Gruppen, in der Freizeit, im Internet. Shitstorms mit komplett unbekannten Menschen können Beispiele für Widerstand und für Blindwiderstand sein. Den „Shittys“ ist ja oft selbst nicht wirklich klar, weshalb sie sich gerade diesen Menschen zum Anscheißen herauspicken. Sie durchschauen nicht genau, was die Wurzeln ihrer Wut auf einen komplett fremden Menschen in Wirklichkeit sind.
Ich nenne diesen körperlich spürbaren Impuls gern spaßeshalber „Grüße aus dem Neanderthal“. Denn die instinkthafte Reaktanz gab es ja schon in der Steinzeit. Da war sie für die frühen Menschen unter Umständen überlebenswichtig. Unbekanntes verursacht zuverlässig bis heute diese blockierende Fremdel-Angst oder einen merkwürdigen, sachlich eigentlich unbegründeten Ekel. Und das war ja immer schon gut so. Schließlich mussten die Urvorfahren erst mal schmerzlich lernen: „Alles ist essbar. Aber manches nur einmal.“ Deshalb konnte sich instinktive, scheinbar grundlose Spontan-Abwehr als lebensrettend erweisen.
Und im nächsten Schritt provozierte das „neanderthalerische Keulen-Gen“ den Impuls, auf das Undurchschaubare, Fremde, Verunsichernde, ja Einschüchternde sicherheitshalber erst mal draufzuhauen. Auch diese Reaktion ist eigentlich bis heute ganz ursprünglich, von der Reaktanz getriggert, in den meisten Menschen erhalten geblieben – nur die Form der Keulen hat sich geändert  .
.
Das ist täglich erlebbar. Hier ein paar bekannte Situationen als Beispiel:
Bei Unbekanntem: Jemand bietet Ihnen gebratene Seidenraupenlarven zum Probieren an, mit der Versicherung, dass die leckerer und gesünder als Krabben seien. Jetzt greift die Neanderthal-Reaktanz. Motto: „Wat der Buur net kennt, freet he nich“.
Bei emotional Bevormundendem: Jemand stellt voller Begeisterung ein neues Projekt in der Firma oder einen tollen Urlaubsplan in der Familie vor. Zwei typische Basis-Reaktionen – je nach Beziehung und Hierarchie – laufen so ab: Entweder erklingt spontanes Maulen: „Och nööö!“, „Kenn ich schon“ (einer der beliebtesten Totschläger) oder „Find’ ich langweilig“...
Oder die ersten paar Kollegen beziehungsweise Familienmitglieder reagieren noch wunschgemäß offen auf die Ideen. Und dann greift das bislang ungeschriebene Reaktanz-Gesetz: „Ab dem/der Fünften kippt’s“: Es ist fest damit zu rechnen, dass spätestens ab der fünften Meinungsäußerung das gesetzmäßig reaktante Dagegenhalten eintritt. Je nach Charakter von Nr. 5 oder sogar 6 kann es auch mal bis zum siebten oder achten Rundenmitglied dauern, bis es passiert. Aber dann widerspricht unvermeidlich jemand dem allgemeinen Tenor – oft ohne selbst zu wissen, weshalb, und manchmal sogar gegen die eigentliche persönliche Überzeugung. Das geschieht bei zu glamourösen Schilderungen, bei allzu großer Einigkeit oder bei dem Gefühl, nicht auf der „Schleimspur von Nettigkeit“ der Vorherredenden ausglitschen zu wollen. Ist das emotionale Gleichgewicht gestört, dann will die Balance einfach wiederhergestellt werden.
Es funktioniert tatsächlich so gesetzmäßig wie bei (Hufeisen-)Magneten in der Physik: Wenn ein Pol des Magneten abgetrennt wird, organisiert sich wie durch Zauberhand sofort der entgegengesetzte am abgeschnittene Ende neu. In meinen Coachings und Trainings demonstriere ich das gern an einem Beispiel.
Emotionale Bevormundung
Ich unterbreche ganz nebenbei den Ablauf und hole ein neutrales Gläschen mit handelsüblichen Pfefferminzbonbons hervor. Mit großer Geste gehe ich jetzt von links nach rechts an den ersten fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorbei und sage mit übertrieben begeistertem Tonfall: „Ich habe hier suuuperleckere Pfefferminze. Wirklich ganz außergewöhnlich lecker. Bestimmt haben Sie noch nie so wohlschmeckendes Pfefferminz gegessen.“ Manchmal unterschreite ich dann auch noch die körperliche Individualdistanz und drängele: „Hier, probieren Sie mal!“
Und dann fange ich die Runde noch mal von vorn an und frage provokant: „Und? Wie schmeckt es?“
Erfahrungsgemäß antwortet die erste Person meist mit schal-höflichem Unterton: „Gut.“
„Na ja, halt wie Pfefferminz“, sagt die zweite Person schon einen Hauch gereizter.
„Normal“, echot die Dritte noch einen Hauch abweisender.
„Schmeckt wie TicTac“, sagt die Vierte dann schon leicht patzig.
Und voll aufgestauter Reaktanz flötet die Fünfte jetzt entweder übertreibend: „Hmmmmm, himmmmlisch!“ Oder sie bricht – durch die unehrliche Höflichkeitswelle getriggert – in offene Aggression aus: „Total langweilig!“ Oder sagt angewidert: „Die schmecken irgendwie komisch!“
Die Reaktanz sorgt dafür, dass jede Art der Bevormundung, jede Aufdringlichkeit, jede Unterdrückung zur entgegengesetzten Instabilität führt. Also: Zu viel Schwärmen lässt mechanisch in Abwehr kippen. Zu viel Maulen ins Zustimmende. Besonders faszinierend ist, dass es tatsächlich in beide Richtungen funktioniert: Wenn ich die Bonbons mit den Worten präsentiere: „Bitte probieren Sie mal, die schmecken doch irgendwie komisch?“, führt das gesetzmäßig dazu, dass das Gegenteil der emotionalen Bevormundung eintritt und die Nächsten die Bonbons plötzlich besonders lecker finden.
Читать дальше
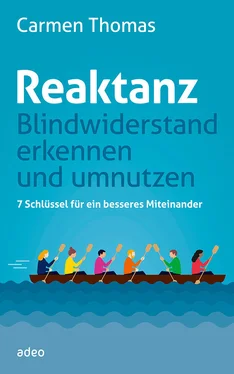
 .
.