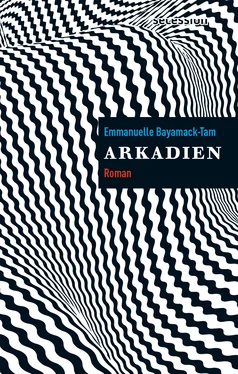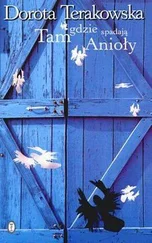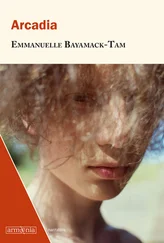»Die Zahlen sind richtig schlecht. Ich weiß nicht, wie es mit uns weitergehen soll, wenn es so weitergeht.«
Diese merkwürdige Doppelung fällt ihm nicht auf, dem Publikum wohl auch nicht, das ihm wie üblich mal mehr, mal weniger Aufmerksamkeit schenkt. Ich bin die einzige, die sich Sorgen macht. Meine Großmutter kratzt sich Schorf von der sonnengebräunten Wade, Victor poliert seinen Knauf, Dadah neigt schon den greisen Kopf und Daniel starrt Löcher in die Luft. Daniel? Aber ja, er ist auch da, mit seinem Rattanstock bewaffnet und bereit, sämtliche Ratten der Welt zu Brei zu schlagen. Nur dass es im Liberty House keine Ratten gibt und dass unser Daniel nichts mit Daniel aus dem Lesebuch zu tun hat, samt Bauernhof, Mauleselin, Gänsen und der kleinen Valérie. Nein, es handelt sich um Victors Patensohn, einen mürrischen jungen Schlaks. Mir war nie recht klar, worin Victors Patenschaft besteht, vermutlich eher aus erotischen Praktiken denn rein erbaulichen Absichten. Jedenfalls hängt sich Daniel mit einer geradezu lasziven, betont auffälligen Ermattung an die Fersen seines Patenonkels, als wäre er gerade erst dem Brautbett entstiegen. Das kommt mir für Arkady eher kränkend vor, wobei es ihm gar nicht in den Sinn käme, ausschließliche Liebe zu verlangen. Und damit komme ich wieder auf die Liebe zu sprechen, mein eigentliches Thema, besser gesagt, das von Arkady an diesem Dezembermorgen. Noch redet er über die Jahresbilanz, man merkt ihm aber an, dass er dazu keine Lust hat und so schnell wie möglich zur Sache kommen möchte. Jetzt ist es soweit: Sein Blick bohrt sich in meinen, doch kaum nehme ich dies erfreut zur Kenntnis, funkelt er mit seinem hellen Auge Dadah an, bevor er Rehlein, Gladys, Epifanio, Daniel, Kinbote, Coco, Jewel, Salo und alle anderen ins Visier nimmt, all seine Schäfchen, die sich in wolliger Trägheit aneinanderkuscheln.
»Omnia vincit amor!«
Keiner von uns kann Latein, mit Vergils Losung sind wir allerdings vertraut, weil Arkady sie sich zwischen seine beiden Schulterblätter hat tätowieren lassen und sie alle naselang wiederholt. Liebe besiegt alles, klar, doch Arkady will sie offenbar zum Kriegsgerät machen, zu einer Waffe, die zwar nicht tödlich, aber wirksam ist, um die Gesellschaft für unsere fortschrittlichen Ansichten zu gewinnen.
Im Liberty House schwimmen wir in Liebe – in der Liebe, die Arkady uns schenkt und die wir erwidern, aber auch in der Liebe, die wir einander entgegenbringen, selbst wenn das Gemeinschaftsleben unweigerlich zu Irritationen führt. Wir … Ich behaupte, dass ich dieses Pronomen verwenden kann, ohne dass es lächerlich wird, ohne dass es auf ein blutleeres, verkümmertes Gefüge wie die Paarbeziehung oder die Familie verweist. Ich behaupte sogar, dass mein Start ins Leben mich zur Spezialistin für das Wir macht, im Gegensatz zu den meisten Menschen, die davon keinen Schimmer haben und ein Leben lang nicht auf die Idee kommen, dass man etwas anderes sein kann als sein eigenes Ich. Ich war von Kindesbeinen an wir , das macht die Sache leichter. Nicht nur, dass ich Haus und Tisch mit mindestens dreißig Leuten jeden Alters und jeder Herkunft geteilt habe, ich musste auch auf eine besondere Nähe zu meinen Eltern und meiner Großmutter verzichten, die sich alle sehr bald auf neue Bindungen einließen und von der unverhofften Deregulierung ihres Sexlebens entzückt waren. Außerdem musste ich mich mit dem Gedanken anfreunden, dass Arkady allen gehörte. Darum kann ich wir sagen, ohne dass es anmaßend oder unpassend wäre. Darum bin ich auch nicht weiter erstaunt über Arkadys neue Predigt. Im Grunde regt er doch nur an, dass wir alles, was wir intra muros ausprobieren, auch außerhalb unserer Gemeinschaft zur Anwendung bringen, nämlich Selbstlosigkeit, schranken- und bedingungslose Lust und eine vollkommen freie, vollkommen wilde Liebe. Nach dieser gedanklichen Eskapade konzentriere ich mich wieder auf den Redner – den Mann meines Lebens, obwohl er das nicht wahrhaben will und diese Wendung keinerlei Sinn für ihn ergibt. Arkady ist beim Lauf der Welt angelangt, tatsächlich läuft die Welt verkehrt, weil sie nicht begreift, dass es reichen würde zu lieben, etwas Aufmerksamkeit und Wohlwollen aufzubringen, die unwiderstehliche Kraft des Begehrens so weit wie möglich zu teilen und zu verbreiten, um der Barbarei ein für alle Mal den Garaus zu machen.
»Wenn ich an diese vielen unglücklichen Menschen denke, die sich gegenseitig umbringen …«
Der Blick verliert sich in der Ferne, die Stimme wird unstet, die Aussage vage. Wir werden nicht erfahren, ob er an die jüngsten Attentate denkt oder an den Krieg in Syrien, auch wenn er aus diesem Land stammt. Vielleicht ist er dort nur geboren, da er praktisch nie darüber spricht und von seiner Herkunft und Lebensgeschichte ohnehin kaum etwas preisgibt, als hätte diese erst mit Victor und dem Liberty House begonnen. Davor nichts oder nur sehr wenig: Er ist in Syrien geboren, hat im Libanon gelebt, in der Schweiz, in Polen – also nirgends, beziehungsweise in Ländern, die keinem etwas sagen. So oder so ist die Liebe seine Heimat, das Liberty House, wir. Darum pocht mein Herz so heftig, wenn ich ihn ansehe und ihm zuhöre, im Einklang mit seinen Gefühlen, seiner Empörung, seinem Mitleid, seiner unermesslichen Trauer über die törichten Gesetze, die das Leben bestimmen. Ich bin in ihm, wie er in mir, was für alle Mitglieder unserer kleinen freiheitlichen Bruderschaft gilt. Liebe besiegt alles, wer wüsste das besser als ich, nachdem ich erleben durfte, wie er den Wahn meiner Eltern besiegt hat, ihre Soziopathie, ihre krankhafte Unentschlossenheit, ihre suizidalen Anwandlungen, ihre depressiven Anfälle, ihre vielfältigen Phobien, ihre Unfähigkeit, sei es, ein Kind aufzuziehen, sei es, für sich irgendeine Art von Zukunft zu entwerfen. Ich habe gesehen, wie sie, von Arkady geliebt und angeleitet, ihre zusammengeknüllten Seelchen so weit entfalteten, dass sie zu umgänglichen Erwachsenen wurden – auch wenn sie noch längst nicht reif genug sind, aber was soll’s, ich habe mich daran gewöhnt und bin reif genug für drei.
Auch wenn wir vor neuen Technologien geschützt sind, heißt das nicht, dass uns keine Nachrichten erreichen: Ihre Wellen branden gegen die Feldsteinmauern, die das Anwesen einfrieden. Victor lässt sich täglich eine eklektische Auswahl von Printmedien zustellen und verbringt den Vormittag mit der Lektüre von Le Monde, La Croix und Le Figaro – ja, auf diese drei beschränkt sich sein Eklektizismus, die auch uns, sobald Monsieur Mirror sie gewissenhaft durchgelesen und ihre Seiten zerknittert und beschmutzt hat, zur Verfügung stehen. Nicht dass er besonders schmutzig wäre oder seine Hände nie abwischt, aber er sondert ständig eine Art fettigen Dunst ab. Allein deswegen begnüge ich mich oft mit den Kommentaren der anderen, um mich über das Tagesgeschehen zu informieren. Außerdem habe ich in der Schule leicht Zugang zum Internet und mache davon ausgiebig Gebrauch. Schließlich bin ich gegen rein gar nichts hypersensibel und selbst wenn, würde ich es um nichts in der Welt meinen Glaubensgenossen verraten, erst recht nicht meinen Eltern; ich bin nicht gerade froh darüber, in einer weißen Zone zu leben, und ich gäbe alles für ein iPhone. Andererseits bietet das Leben im Liberty House so viel, dass ich bestimmt nicht weinen werde, nur weil man mir den Zugang zu sozialen Netzwerken erschwert. Ich habe meine eigenen Netzwerke. Sie schlängeln sich unter den Buchen und Eschen, sie kreuzen die Pfade der Stare und Eichhörnchen, sie führen an Wiesen und Hochwäldern entlang, an Herbstzeitlosen, die in aller Unschuld ihre giftigen Staubblätter öffnen, an Brombeersträuchern, die ebenfalls in aller Unschuld mit ihren schwarzen Ranken Fallen stellen. Ich bin glücklich. Ich brauche weder Periscope noch WhatsApp oder Snapchat.
Читать дальше