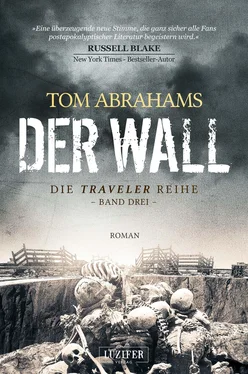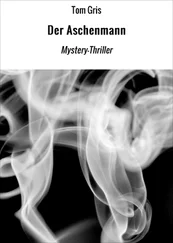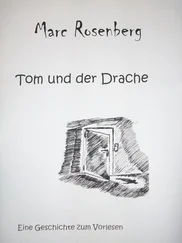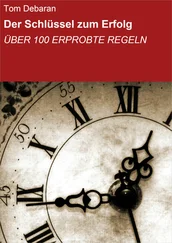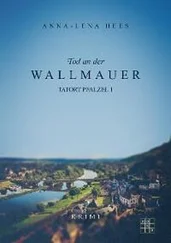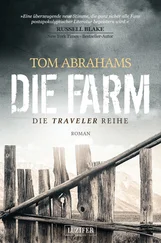Die anderen an dem Tisch waren eine Mischung aus Arbeitern, urbanen Farmern und Geschäftsleuten. Sie vereinten daher eine Vielzahl von Fähigkeiten und Kenntnissen, die die Revolutionäre benötigen würden, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, wenn die Zeit reif war. Die Zeit reifte allerdings gerade schneller, als Ana Montes lieb war.
Ana sah auf die Karte von Texas. Sie war mit sich kreuzenden blauen und roten Linien überzogen. Pfeile kennzeichneten die Richtung von geplanten Vorstößen. Große und kleine Kreise zeigten die zahlenmäßige Stärke der Revolutionäre an den verschiedenen Orten an. Unmittelbar vor Ana, in einem Gebiet in der Nähe von Amarillo, war der Palo Duro Canyon mit fluoreszierendem Gelb hervorgehoben worden.
Das alles wurde ihr viel zu viel. Sie hatte sich der Bewegung ursprünglich mit der Überzeugung angeschlossen, dass der Aufstand gegen das Kartell ein nebulöser Wunschtraum war, der wahrscheinlich niemals Wirklichkeit werden würde. Sie hatte damals eingewilligt, Dinge zu tun, von denen sie nie gedacht hätte, dass sie diese tatsächlich einmal würde tun müssen. Doch jetzt hatte sie die brutale Realität der bevorstehenden Aktionen vor Augen. Ihr Puls beschleunigte sich, ihre Knie fühlten sich wie aus Gummi an, und Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn und ihrer Oberlippe.
»Alles okay bei dir, Ana?«, fragte Nancy Wake und unterbrach damit Sids Ausführungen. »Du siehst gar nicht gut aus.«
Ana lehnte sich an den Tisch, stützte sich mit den Ellenbogen ab und nickte. Sie spürte, wie sich alle Blicke erneut auf sie richteten. »Mir geht es gut«, sagte sie. »Ich …«
Nancys Augen wurden schmal. »Was ist los?«
Ana atmete tief ein und aus und wischte sich mit dem Handrücken über die Oberlippe. »Ich … das ist doch reiner Selbstmord, oder nicht? Ich verstehe nicht, wie wir sie schlagen könnten. Es sind einfach zu viele, und sie haben viel zu viele Waffen.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte Sid und legte den Kopf schief. Einige murmelten besorgt. Sie teilten Anas Zweifel offenbar. Sid hob energisch die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen.
»Ich fürchte, sie werden uns abschlachten«, gab sie zu. »Ich möchte nicht sterben oder als Sklave enden.«
Sid lachte herablassend. »Sklaven sind wir doch schon längst, Ana. Das Kartell bestimmt bereits die meisten Aspekte unseres Lebens. Wir haben uns diese Menschen schließlich nicht als unsere Herrscher ausgesucht.«
»Sie haben uns unsere Freiheit genommen«, ergänzte Nancy. »Sie haben uns belogen. Wir haben geglaubt, sie würden für Sicherheit und die notwendigen Strukturen sorgen, die wir zum Überleben brauchen, doch dann haben sie uns unsere Rechte genommen, eins nach dem anderen. Sie herrschen nun über uns, als wären wir ihre Knechte. Ich kann so nicht mehr leben. Lieber sterbe ich im Kampf!«
Viele der Umstehenden nickten zustimmend. Einige bezweifelten sogar Anas Loyalität und stellten die Frage, ob man ihr überhaupt noch vertrauen könnte. Sid brachte sie alle erneut zum Schweigen.
»Du kanntest die Gefahren, als ich dich für unsere Sache gewonnen habe«, sagte er. »Du wusstest, dass das Endspiel irgendwann kommen würde. Du hast deiner Aufgabe zugestimmt … deiner für uns überlebenswichtigen Aufgabe. Nichts davon kam überraschend.«
»Ja, du hast recht.« Sie blickte auf die Karte hinab und verfolgte ausdruckslos die farbigen Linien. »Ich bin auch nicht überrascht. Ich habe einfach nur Angst.« Sie blickte auf und Tränen rannen ihr über das Gesicht.
Als Ana sich bereit erklärt hatte mitzumachen, hatte sie noch keinen Grund gehabt, den Tod zu fürchten, denn da war sie noch keine Mutter gewesen. Doch jetzt hatte sie eine neun Monate alte Tochter. Was würde aus ihrem Kind werden, wenn sie starb? Wer würde sie großziehen? Was für eine Frau würde aus ihrer Tochter werden, falls sie überhaupt überlebte?
Nancy sprach leise. »Wir alle haben Angst, Ana, aber ich habe mehr Angst davor, was mit uns passieren wird, wenn wir nichts tun. Unsere Zukunft ist vielleicht ungewiss, wenn wir handeln, aber unsere Zukunft ist sehr düster, wenn wir es nicht tun.«
Ana schluckte und spürte einen dicken Knoten in ihrem Hals. Nancy hatte recht und auch Sid hatte recht. Sie mussten handeln. Sie mussten kämpfen. Sie mussten das Kartell besiegen.
25. Oktober 2037, 8:02 Uhr
Jahr fünf nach dem Ausbruch
Lubbock, Texas
General Roof saß auf der Bettkante und starrte aus dem großen Panoramafenster seines derzeitigen Zuhauses. Es zeigte nach Osten und jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, riss ihn das hellorange Licht, das sein Zimmer erfüllte, aus dem Schlaf.
Heute Morgen jedoch hatte er auf die Sonne gewartet, denn seit seinem Telefonat mit Pierce hatte er nicht mehr schlafen können. Der Spion hatte ihm wertvolle Informationen geliefert, die er seitdem immer wieder in seinem Kopf abspielte, als würde er Schafe zählen, die über einen Zaun springen. Es hätte ihm helfen sollen, sich zu entspannen und die dringend benötigte Ruhe zu finden.
Doch stattdessen musste er an den Mann denken, den Pierce getötet hatte. Es war ein bedauerlicher Fehler gewesen, der Pierces Untergang bedeuten würde. Der Anruf über Satellit war wahrscheinlich sein letztes Lebenszeichen gewesen. Die Dweller waren nicht dumm. Sie würden eins und eins zusammenzählen und Pierce anschließend auf die eine oder andere Weise ein ungemütliches Ende bereiten.
Roof rieb sich die Augen und setzte die Füße langsam auf den kalten Betonboden. Vorsichtig belastete er sein krankes Bein und spürte sofort den dumpfen, vertrauten Schmerz, der ihn so ungelenk hinken ließ. Aufmerksam verglich er seine beiden Beine. Das eine war muskulös und gesund. Es war behaart, so wie es das Bein eines Mannes sein sollte, und die Haut war von gleichmäßiger Farbe. Das andere war deutlich dünner und sah schon äußerlich krank aus. Unterhalb des Knies waren große rosafarbene Flecken, so leuchtend und unbehaart wie die Füße eines Neugeborenen. Die Flecken transplantierter Haut, die nun für immer sein Bein schmückten, sahen aus wie eine Ansammlung ehemaliger Sowjetstaaten.
Es verging kein Tag, an dem Roof nicht daran zurückdachte, wie sein Bein verstümmelt worden war. Wie in Technicolor hatte es sein Gedächtnis für immer gespeichert. Jener Tag hatte sich als der Tag herausgestellt, der sein Leben am nachhaltigsten bestimmen sollte. Einer seiner Kameraden hatte sich geopfert und sein eigenes Leben für ihn riskiert. Die Selbstlosigkeit dieses Handelns hätte Roof nach seiner Rückkehr aus Syrien eigentlich auf einen anderen Weg bringen müssen. Er hätte seine Schulden gegenüber dem Schicksal zurückzahlen und anderen dabei helfen sollen, zu überleben. Doch stattdessen hatte ihn das Schuldgefühl verzehrt. Er konnte es an keiner passenden Stelle in sein Leben einsortieren, dass ausgerechnet er die selbst gebaute Bombe und den Hinterhalt, in dem vier Männer getötet worden waren, überlebt hatte. Roof, der schon zuvor über weite Strecken seines Erwachsenenlebens Drogen und Alkohol konsumiert hatte, war daraufhin kopfüber in die Sucht getaucht. Immer wieder war er in Veteranen-Krankenhäusern und Obdachlosenunterkünften gewesen, und immer wieder war er aus ihnen geflohen.
Letzten Endes war er in Houston gelandet und hatte dort Hilfe in einem Heim gefunden, in dem sie Existenzen wie ihn wieder zu normalen Menschen machen wollten. Sie hatten ihm geholfen, von den Drogen und dem Alkohol loszukommen, ihm kaufmännische Fähigkeiten beigebracht und ihn mit neuem Selbstvertrauen auf den Weg geschickt.
Leider hatte sich herausgestellt, dass ein humpelnder, abstinenter Drogen- und Alkoholabhängiger nicht sonderlich weit oben auf der Wunschliste personalsuchender Arbeitgeber stand. Also hatte Roof dort gearbeitet, wo er Arbeit gefunden hatte, und war so irgendwann in die kriminelle Unterwelt von Bayou City abgerutscht. Er hatte mit Drogen und Frauen gehandelt und sich schnell einen Namen als skrupelloser Lieferant von illegalen Waren und minderjährigem Fleisch gemacht. Rasch war er in der Stadt, die als Highway für den illegalen Handel von Lateinamerika in die Vereinigten Staaten bekannt war, an die Spitze aufgestiegen.
Читать дальше