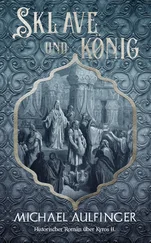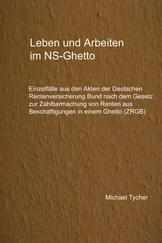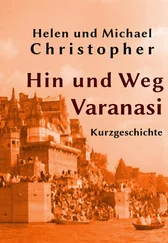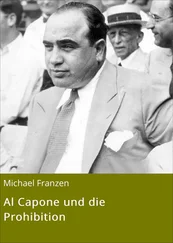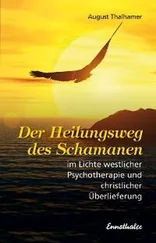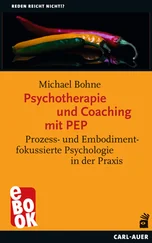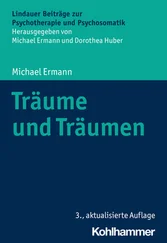• Psychische, körperliche und soziale Entwicklung
Prägende Beziehungen und Erfahrungen, Familienhintergrund, Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im körperlichen, geistigen, seelischen, sexuellen, schulischen und Beziehungsbereich, traumatische Erlebnisse, Krankheiten, Bewältigung von Entwicklungskonflikten
• Auswertung
Psychodynamische Hypothese, klinische und psychodynamische Diagnose, Behandlungsmotivation und Erwartungen, Indikation und Differenzialindikation, Zielsetzung und Prognose
Unabhängig davon, auf welcher der Untersuchungsmethoden der Schwerpunkt liegt, sollte eine psychotherapeutische Fachdiagnostik die nachfolgenden Punkte berücksichtigen. Diese liegen auch den Berichten zugrunde, die von Psychotherapeuten als Begründung für Kostenübernahmeanträge im Rahmen des Gutachterverfahrens verfasst werden.
• Beschreibung des Krankheitsbildes und der subjektiven Schilderung der Beschwerden aus der Sicht der Patienten,
• Erfassung der symptomauslösenden oder symptomverstärkenden Situation und des aktuellen Lebenshintergrundes, aktuelle Belastungen und Ressourcen,
• Angaben zur bisherigen Behandlung der Erkrankung und zum Verlauf,
• Lebensgeschichtlich relevante Beziehungen und Erfahrungen, psychische, körperliche und soziale Entwicklung,
• Psychopathologische und körperliche Befunde,
• Überlegungen zur Psychodynamik der Störung und zur Persönlichkeitsstruktur im Bezug zur Lebensgeschichte und zur Auslösesituation der Erkrankung,
• Klinische und psychodynamische Diagnosen einschließlich Angabe des Strukturniveaus,
• Behandlungsziele, Indikationsstellung mit Differenzialindikation sowie Indikationsbegründung,
• Prognose in Bezug auf die Zielsetzung.
5.2.3 Die Auswertung des psychodiagnostischen Interviews
Der Zweck der psychodynamischen Diagnostik ist die Klärung des Krankheitsbildes aus psychodynamischer und strukturdiagnostischer Perspektive. Dazu wird das Material unter drei Aspekten ausgewertet: der deskriptiven Klassifikation, der psychodynamischen Hypothese und dem der entwicklungspsychologischen Zuordnung. Zusammen ergeben sie eine unverzichtbare Basis, auf der ein patientenspezifischer Behandlungsplan entworfen werden kann.
Wenn man das Interview halbstrukturiert im Sinne des oben angegebenen Schemas führt, wird man anders als bei einer systematischen Exploration vorgehen. Man wird Grundkonflikte, strukturelle Defizite, Ressourcen und Fähigkeiten nicht direkt erfragen, sondern aus dem Interview erschließen. Man wird diese identifizieren, indem man sich das Interview unter gezielten Fragen vergegenwärtigt und diese aus der Erinnerung und seinen Aufzeichnungen heraus beantwortet. Was kann der Patient nicht? Was fehlt ihm? Welche Muster, an denen er scheitert, kehren immer wieder? Dabei handelt es sich um eine sehr subjektive Auswertung. Sie entspricht aber der Praxis und berücksichtigt den subjektiven Faktor als ein konstruktives Element in einer psychodynamischen Behandlung, sofern der Untersucher sich der Subjektivität bewusst ist.
Die deskriptive Klassifikation
Die deskriptive Charakterisierung eines Syndroms ist in der Medizin selbstverständlich und gilt auch für die Psychotherapie und Psychosomatik. Im deutschsprachigen Bereich verwendet die deskriptive Diagnostik psychischer Störungen das internationale Klassifikationssystem ICD (  Kap. 5.3.1). Gegenwärtig gilt die 10. Revision (ICD-10) 149, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die ICD-11 wurde im Juni 2018 veröffentlicht und soll 2022 in Kraft treten 150.
Kap. 5.3.1). Gegenwärtig gilt die 10. Revision (ICD-10) 149, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die ICD-11 wurde im Juni 2018 veröffentlicht und soll 2022 in Kraft treten 150.
In der traditionellen psychoanalytischen Neurosenlehre wurden die deskriptiv-phänomenale und die psychodynamische Ebene der Diagnostik miteinander vermischt. Der Grund war die damals vorherrschende Auffassung, dass hinter einzelnen Krankheitsbildern stets die gleichen psychodynamischen Muster stünden. Man sprach deshalb von Angstneurose, Hysterie usw. und fasste dabei Syndrom und Psychodynamik wie selbstverständlich zusammen. So galt z. B. eine Zwangsneurose grundsätzlich als Folge der Fixierung anal-aggressiver Konflikte. Die Bedeutung des Strukturniveaus war damals noch nicht bekannt, eine Klärung war daher nicht Bestandteil des klinischen Denkens.
Diese Auffassung gilt seit Langem als überholt. Wir wissen, dass Syndrome wie z. B. depressive Störungen vor sehr unterschiedlichen psychodynamischen Hintergründen und auf verschiedenen Strukturniveaus vorkommen, sodass die Phänomenologie zunächst unabhängig von Dynamik und Struktur beschrieben werden muss.
Der Begriff »Neurose « der traditionellen Neurosenlehre wurde international durch »Störung« ersetzt, um theoretische (vor allem psychodynamische) Implikationen zu umgehen. Damit wurde die Orientierung an psychodynamischen ätiologischen Konzepten eingeschränkt und mehr und mehr zu Gunsten biologisch-deskriptiver Konzepte aufgegeben. 151In diesen kommt die individuelle Dimension neurotischer Erkrankungen nicht zum Ausdruck. Der »alte« Neurosebegriff zentrierte auf die traditionelle Konfliktpathologie und ist als solcher mit der Erweiterung des Behandlungsspektrums auf die Entwicklungspathologie nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Unter deskriptiven Gesichtspunkten ist bei den psychogenen Störungen zwischen Störungen psychischer bzw. psychosomatischer Funktionen (sog. Symptomneurosen), Persönlichkeitsstörungen und komorbiden Störungen zu unterscheiden.
• Bei Störungen psychischer bzw. psychosomatischer Funktionen handelt es sich um mehr oder weniger umschriebene klinische Syndrome, die durch ein einziges oder einen Komplex von Symptomen gekennzeichnet sind. Daher spricht man auch von Symptomneurosen, obwohl diese Störungen auch reaktiv oder posttraumatisch sein können. Mit »Symptom« sind dabei Funktionsstörungen im affektiven Bereich (z. B. Ängste), im Handlungsbereich (z. B. Zwänge), im körperlichen Bereich (z. B. Herzrasen) oder im Bereich des Verhaltens (Verhaltensstörungen) gemeint.
– Von psychischen Störungen 152spricht man bei vorherrschend seelischen Beschwerden (  Kap. 9),
Kap. 9),
– von somatoformen Störungen bei überwiegend körperlicher Symptomatik (  Kap. 10),
Kap. 10),
– von Verhaltensstörungen, wenn Störungen des Verhaltens im Vordergrund stehen (  Kap. 11).
Kap. 11).
• Persönlichkeitsstörungen (»Charakterneurosen«) sind durch wenig flexible neurotische Persönlichkeitszüge (z. B. Verletzlichkeit, Misstrauen), Einstellungen (z. B. eine Helferideologie) und Verhaltensmuster (z. B. Beziehungsabbrüche) geprägt, die die Beziehungen, die soziale Lebensbewältigung und den Lebensgenuss beeinträchtigen (  Kap. 8). Sie spielen in der Psychotherapie und Psychosomatik eine immer größere Rolle.
Kap. 8). Sie spielen in der Psychotherapie und Psychosomatik eine immer größere Rolle.
• Komorbide Störungen treten bei Persönlichkeitsstörungen unter besonderen Belastungen auf, die mit zusätzlichen Symptombildungen verbunden sind. Auf diese Weise entstehen vielfältige und einprägsame Krankheitsbilder. Sie kommen durch eine Komorbidität von Persönlichkeitsstörungen und Symptomneurosen zustande. Für diese Störungen gibt es noch keine einheitliche Bezeichnung.
Die psychodynamische Hypothese
Читать дальше
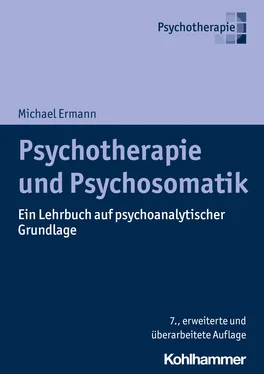
 Kap. 5.3.1). Gegenwärtig gilt die 10. Revision (ICD-10) 149, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die ICD-11 wurde im Juni 2018 veröffentlicht und soll 2022 in Kraft treten 150.
Kap. 5.3.1). Gegenwärtig gilt die 10. Revision (ICD-10) 149, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die ICD-11 wurde im Juni 2018 veröffentlicht und soll 2022 in Kraft treten 150.