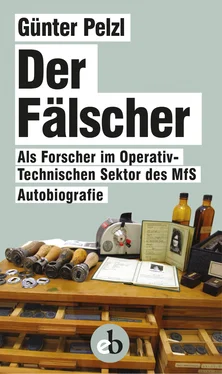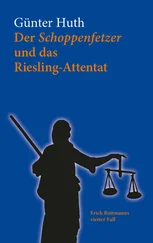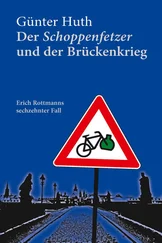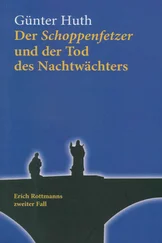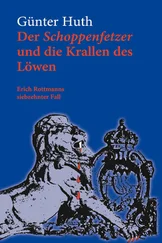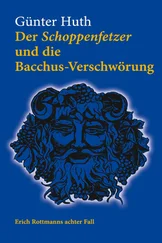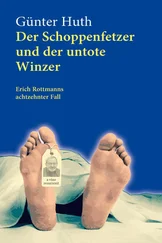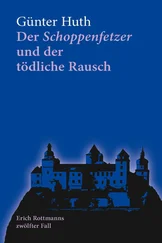Den 13. August 1961 erlebte ich im Spreewald. Wir waren auf einer Klassenfahrt und erkundeten diese schöne Landschaft durch Wanderungen von einem Ort zum anderen. Am 13. August waren wir gerade in Byhleguhre angekommen. Dieser Name ist so seltsam, dass ich ihn bis heute nicht vergessen habe. Von der brisanten politischen Situation bekamen wir nur wenig mit. In unserem Alter hatten wir andere Sorgen als eine Mauer, die irgendwo gebaut wurde. Unser geplanter Ausflug nach Berlin allerdings fiel ins Wasser. Das gefiel uns gar nicht, aber es war nicht zu ändern.
Unter den Bekannten meiner Eltern war auch eine Familie aus dem Dorf, deren Sohn Chemie studierte. Er war zwar ein paar Jahre älter als ich, aber er weihte mich so in diese tolle Wissenschaft ein, dass ich nicht mehr von ihr loskam. Von ihm bekam ich die passenden Chemikalien und von meinen Eltern zu Weihnachten ein lustig bebildertes Experimentierbuch: Streifzüge durch die anorganische Chemie.
Meine beiden Freunde, Wolfgang und Günter, waren auch interessiert. Neben ersten kleinen Stänkereien und Farbenspielen stießen wir bald auf einen berühmten Mönch namens Berthold Schwarz. Sein gleichnamiges Pulver hatte es uns angetan, und die Bestandteile waren nicht schwer zu beschaffen. Alle Bauern, die schlachteten, hatten auch Pökelsalz – da hatten wir schon mal das Kaliumnitrat. Das Schwefeln der Kartoffeln bei der Herstellung der Thüringer Klöße ist zwar heute außer Mode, aber damals kannte das jede Hausfrau. Die Fäden, die in geschmolzenen Schwefel eingetaucht worden waren, zündete man an. Sie brannten mit kleinen blauen Flämmchen und wurden in die Töpfe mit den rohen Kartoffeln gehängt, die man mit dem Deckel verschloss. Das entstehende Schwefeldioxid löste sich im Kartoffelwasser und verhinderte, dass das Gereibe schnell braun oder blau wurde. Die Schwefelfäden gab es in der Drogerie Tonndorf in Jena oder im Küchenschrank. Über die Verbreitung von Holzkohle in Thüringen angesichts der Bratwürste zu reden, ist überflüssig. Das Mischungsverhältnis der Komponenten musste man durch Experimentieren herausfinden. Eine kleine Schwierigkeit ergab sich aber doch. Es wurde Holzkohlepulver gebraucht. Mit dem Hammer ging das nicht, aber mit einer Kaffeemühle, und zwar mit einer, die von Hand gedreht werden musste und dabei zwischen den Knien gehalten wurde. Obwohl wir immer versuchten, die Kaffeemühlen danach zu säubern, gab es doch mehrfach beim sonntäglichen Kaffeetrinken Kopfschütteln und Schimpfen über die Qualität des angeblich zu scharf gerösteten Bohnenkaffees aus dem Osten.
Es dauerte nicht lange, und unsere ersten Raketen wurden erprobt. Sie flogen zum Glück nicht, sondern hopsten nur von einer Furche in eine andere. Der höllische Gestank, den sie verbreiteten, zwang uns, die Erprobung auf einem abgelegenen Acker durchzuführen. Irgendwie musste das bei Sputnik 1 anders funktioniert haben.
Wir erweiterten unser Wissen und begannen, mit Schießbaumwolle zu experimentieren. Dazu brauchte man keine Kaffeemühle, und wenn ein Paket Watte im elterlichen Haushalt mal fehlte, fiel das in der Regel nicht auf. Woher ich die rauchende Salpetersäure hatte, weiß ich heute nicht mehr, aber ich hatte sie.
Im Schuppen von Opa Kuttein nitrierten wir die Watte und versuchten, den entstehenden Gestank so gut wie möglich zu vertreiben. Anschließend wurde das pappige Produkt mit viel Wasser gewaschen. Nun ging es ans Trocknen. Da bot sich die Backröhre des Küchenofens förmlich an. Inzwischen hatten wir es uns am Küchentisch bequem gemacht und die Skatkarten ausgepackt. Aus dem Radio jaulte der Song »Wimoweh« von The Tokens, und passend dazu gab es einen dumpfen Knall. Der Löwe, der bei den Tokens im Lied noch geschlafen hatte, wäre sofort aufgesprungen. Die Klappe der Backröhre flog auf, und weißer, beißender Qualm kam heraus, doch der Herd hatte es überlebt. Wir hatten gerade noch Zeit, die Ausgangslage wiederherzustellen und uns zu verkrümeln, bevor die Eltern von Wolfgang nach Hause kamen.
Mein Bedarf an dieser Art von Chemie war für eine Weile gedeckt. Immerhin gingen aus unserem Experimentier-Trio zwei Chemiker hervor. Der andere, Günter, ging später an die Grenze, wo auch sein Vater gearbeitet hatte, der an den Folgen einer schweren Kriegsverletzung schon gestorben war.
Langsam deutete sich an, dass die unbeschwerte Kinderzeit ihrem Ende entgegenging. Der Umzug vom Dorf in die Stadt stand bevor. Mit dem Beginn der achten Klasse tauschte ich unfreiwillig das kleine Dorf Ammerbach gegen die damals für mich große Stadt Jena ein.
5. Kapitel
Verloren und gewonnen • Deutschland
einig Vaterland • Eine bürgerliche
Badewanne • Stehkragenproletarier
erziehen mich zu einem langsamen
Feinmechaniker • Deutsche in der
Résistance • Meine Lehrer • Hully-Gully, Schlips und Tanztee • Jenaer Bierbraukunst
Mit unserem Umzug in die Stadt verlor ich mit Bedauern meine ganze Habe, das waren alle Schätze, die man im Laufe einer Kindheit auf dem Dorf so anhäuft. Sehr gut fand ich dagegen, dass endlich mein dörflicher Spitzname aus meinem Leben verschwand, und er tauchte auch nie wieder auf. Vor allem die Erwachsenen hatten mich immer »Juppi« genannt. Das war eine blöde Verniedlichungsform von Jupp, und das war rheinländisch identisch mit Josef. Ich war also die verkleinerte Ausgabe meines Vaters. Das wollte ich aber nicht sein. Meine Spielkameraden hüteten sich, diesen Spitznamen in meiner Gegenwart zu gebrauchen. Ich hätte jedem sofort die Freundschaft gekündigt. Der Schmerz über die tatsächlichen Verluste wich aber bald, und der neue Schulalltag nahm mich mehr in Anspruch, als ich erwartet hatte.
Die Schule war 1953 gebaut worden und trug ab 1961 den Namen »Erweiterte Oberschule (EOS) ›Johannes R. Becher‹«. Natürlich errichtete man in Jena auch ein Johannes-R.-Becher-Denkmal. Das wurde unter der Beteiligung der gesamten Schule aufgestellt und eingeweiht. Sein vergleichsweise kleiner Bronzekopf stand gleich neben dem Pulverturm der alten Stadtmauer und dem kolossalen Stein für den Chemiker Johann Wolfgang Döbereiner. Das half dem Dichter Becher aber nicht bei der Bilderstürmerei 1989/90. Sein Kopf war weg, immerhin war Becher nebenberuflich auch noch Kommunist und DDR-Kulturminister, Döbereiner nicht.
Gleichermaßen wurde die Goetheallee wieder in Fürstengraben umbenannt, obwohl Goethe mit Döbereiner befreundet war. Goethe war ein großer Heide, wie die meisten Kommunisten auch. Andere Heiden, wie Karl Marx, fielen ebenso unter die modernen Bilderstürmer, obwohl Marx ursprünglich Jude war. Da half ihm auch nicht, dass er in Jena 1841 in absentia, also in Abwesenheit, promovierte. 1992 verschwand sein Denkmal im Keller der Universität. Besagter Becher hatte sich seine Abwicklung mit der Schaffung des Textes der DDR-Nationalhymne offensichtlich redlich verdient. Das kann man eigentlich nicht verstehen, lautet in dieser Hymne doch eine Textzeile: Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland …
Dass die Maas, die Memel, die Etsch und der Belt in seinem Liedtext fehlten, wurde ihm wohl zum Verhängnis. Wenn man schon von Deutschland singt, muss man auch wissen, wo seine Grenzen sind. Als der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 sein »Lied der Deutschen« dichtete, konnte er nicht wissen, dass sich sein erträumtes »Deutschland« durch die Schuld seiner Obrigkeiten in mehr als hundert Jahren soweit verkleinerte, dass man das Lied eigentlich heute nicht mehr mit ehrlichem Herzen singen kann, nachdem es schon, wie das Land selbst, offiziell auf eine Strophe geschrumpft ist.
Seit Herbst 2019 gibt es in Jena übrigens eine Kopie der Bronzebüste des einstigen Texters der DDR-Nationalhymne; sie wurde in Jena-Winzerla vor einem Plattenbau aufgestellt und ist für manch einen ein Stein des Anstoßes.
Читать дальше