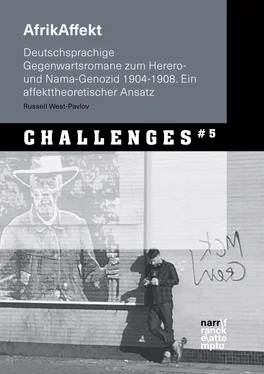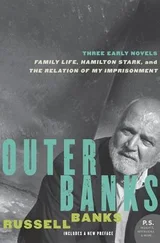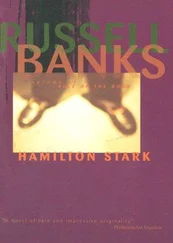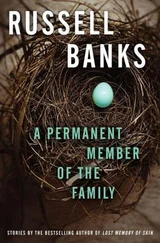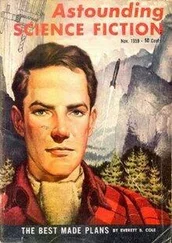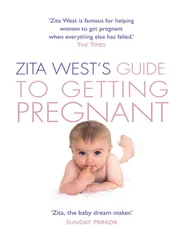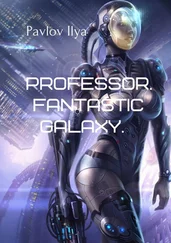Diese Epoche endete mit den New Yorker Al-Qaida-Anschlägen vom 11. September 2001 und dem bald darauf eingeleiteten Krieg im Irak. In diesem Augenblick, in dem eine sogenannte „Koalition der Willigen“ im „Krieg gegen den Terror“ mobilisiert wurde, lies sich nicht vorausahnen, dass dies der Ausbruch eines bis heute anhaltenden „globalen Bürgerkrieg[s]“ (Berardi 2016) sein sollte. Die Ausblendung des Genozids an den Herero bzw. Nama in Seyfrieds Roman kann in diesem Zusammenhang nicht nur als Symptom des historischen Unwissens über die Vergangenheit gelesen werden, sondern steht auch für das bewusste Ausblenden einer globalen Konfliktlage, deren Konturen mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan, mit der Etablierung des Guantanamo-Lagers im Januar 2002 und der gleichzeitigen Aufnahme der „Renditionsflüge“ (vgl. Bartelt / Muggenthaler 2006; Luftpost 2006) sowie dem späteren „Drohnenkrieg“ ab 2004 (Amnesty International 2018: 6–7, 51–61; siehe auch Chamayou 2015), beides unter wesentlicher Beteiligung Deutschlands, erst allmählich klar wurden. Die Kluft zwischen der „deutsche[n] Brille vom Krieg in Namibia [gemeint ist Deutsch-Südwestafrika]“ und der „andere[n] Seite der Medaille – also [der] Perspektive der Nama und Herero“ (Loimeier 2004), die dem Roman Seyfrieds strukturell zugrunde liegt, steht so stellvertretend für eine anhaltende Kurzsichtigkeit bezüglich der globalen Situation, in der der Krieg gegen den Terror hauptsächlich auf Kosten von Bevölkerungen im Globalen Süden geführt wird (vgl. z.B. Save the Children International 2019). Im Laufe der 2000er-Jahre wurde jedoch immer mehr mediale Aufmerksamkeit auf die anfangs unbeachteten Opfer des Kriegs gegen den Terror gelenkt. Ab 2001, mit dem Ausbruch des bis heute andauernden Bürgerkriegs in Syrien, der 2015 die sogenannte „Flüchtlingskrise“ in Europa und insbesondere in Deutschland auslöste, wurde endgültig klar, welche Konsequenzen die eng miteinander verbundenen Facetten des globalen Kriegs gegen den Terror für Europa hatten. Diese Erkenntnis wurde weiter gestärkt durch eine Reihe von ISIS-Terroranschlägen in Deutschland 2016 und 2017. Zudem wurden durch die ablehnenden Reaktionen mancher osteuropäischer Staaten gegenüber einer gemeinsamen EU-Politik nach 2015, die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und den Brexit-Volksentscheid 2016 sowie die Wahl Jair Bolsonaros zum brasilianischen Präsidenten 2018 unmissverständlich sichtbar, wie instabil das globale politische System geworden war. Allmählich ging dieses aufkommende Bewusstsein für die global vernetzten Dimensionen der Konflikte in die zunehmende Wahrnehmung der bereits seit Jahren von Wissenschaftler*innen angekündigten Klimakatastrophe über – einer Katastrophe, die nun nicht mehr ausschließlich als „eine ökologische Herausforderung für die Menschheit“ verstanden wird, sondern, in den Worten des deutschen Außenministers Heiko Maas (2019) vor der UN-Generalversammlung, „immer öfter [als] eine Frage von Krieg und Frieden“. Schrittweise wird sichtbar, dass die heutige Krise in einem historischen System von Kolonialismus und Imperialismus wurzelt, das nicht nur globale Ungleichheiten, sondern auch planetare Zerstörungen hervorgebracht hat (Brand / Wissen 2017). Die seit der Jahrhundertwende aufflammende globale Krise mit ihren mannigfaltigen Aspekten konnte in den 1990er-Jahren in ihren heutigen, erschreckenden Ausmaßen nicht vorhergesehen werden (vgl. Kennedy 1997). Die Unfähigkeit, in die Zukunft zu blicken und die erschreckenden globalen Entwicklungen der folgenden Jahrzehnte zu erahnen, ist eine tatsächliche Unfähigkeit. Rückblickend das volle Ausmaß der kolonialen Gewalt der deutschen Vergangenheit und deren langfristige Auswirkungen zur Kenntnis zu nehmen, jedoch eine gewollte. Seyfrieds Herero ist durch die Art und Weise, wie der Text die im Titel angekündigte Fokussierung der Erzählung doch verfehlt, ein negatives Bespiel für einen Historismus manqué , dessen Blindheit für die Gegenwart und unmittelbar bevorstehende Zukunft nun vollends offensichtlich wird. Der Roman kann daher als Ansporn fungieren an eine Lektüre der jüngsten literarischen Darstellungen des Deutsch-Namibischen Kriegs nicht nur historisch-kontextualisierend, sondern auch gegenwartsorientiert und daher mit einem geschärften Bewusstsein für lebendige Verbindungslinien heranzugehen.
In diesem Sinne untersucht die vorliegende Studie diejenigen literarischen Strategien, die die heutige Herero-Fiktion dazu befähigen, eine affektive Verbindung zu Ereignissen und Subjekten herzustellen, die sowohl zeitlich als auch geografisch weit von unserer Gegenwart entfernt sind. Um dieses Projekt voranzutreiben, wird eine Neuauflage des Jauß’schen Ansatzes der Rezeptionsästhetik unternommen. In Literaturgeschichte als Provokation (1970) nimmt Jauß die historischen „Erwartungshorizonte“ sukzessiver Momente der Textrezeption unter die Lupe, um deren „Wirkungsgeschichte“ aufzuzeigen. Der „Erwartungshorizont“, der heutzutage die Lektüre der hier untersuchten Herero-Fiktion steuert, wird durch zweierlei Faktoren bestimmt: einerseits die sich verringernde Entfernung zwischen Afrika und Europa im Zuge einer gewaltigen afrikanischen Migrationswelle, die künftig eher zu- als abnehmen wird (Smith 2019; UNDP 2019), andererseits die zunehmende Bedeutung Afrikas für Europa im Hinblick auf Rohstoffe (Dennin 2013). Angesichts einer gegenwärtigen Wiederkehr der vergessenen (wenn nicht ganz unterdrückten) Nähe zu Afrika bezüglich der Themen „Demografie“, „Sicherheitspolitik“, „Ressourcen“ und „Klimamigration“ (vgl. Auswärtiges Amt 2019; Smith 2019; UNDP 2019) ist eine wieder relevant gewordene „Poetik der Relation“ (Glissant 1990) gefragt. Eine solche „Poetik der Relation“ könnte eine kreative Plattform bieten, auf der affektive Verbindungen zu Afrika wiederaufgebaut werden können. Zweck dieses Wiederaufbaus von affektiven Verbindungslinien wäre die Stärkung von gemeinsamer Handlungsfähigkeit zusammen mit einem Afrika, das lange Zeit bewusst von Europas Außengrenzen ferngehalten wurde. Ein solcher Wunsch ist keine utopische Träumerei, sondern benennt eine notwendige geopolitische Trendwende, die sich beispielsweise in den jüngsten „Afrikaleitlinien“ der Bundesregierung abzeichnet: „Das Wohlergehen Europas ist mit dem unseres Nachbarn Afrika untrennbar verbunden“ (Auswärtiges Amt 2019: 2). Mit Blick auf solche geopolitischen Entwicklungen ist es wünschenswert, dass im Bereich des ästhetischen Schaffens eine „Ästhetik der Proximität“ (West-Pavlov 2018) neben einer nach wie vor politisch notwendigen Ästhetik der kritischen „Distanz“ (Felski 2015) in Erscheinung tritt. An dieser Stelle macht die sokratische Tradition des kritischen Fragens Platz für eine genauso wichtige Philosophie des Antwortens, die auf einer gegenseitigen Nähe und „Responsivität“ basiert (Waldenfels 1994).
Solch eine Ästhetik der Nähe ist von elementarer Wichtigkeit in einem Zeitalter, das von „bürgerlicher Kälte“ (Adorno 1971: 100–2) und einer „globalen Gleichgültigkeit“ (Neumann 2017) geprägt ist. Sowohl innerhalb der Grenzen Europas wie auch zwischen Europa und seinen nicht-europäischen Nachbarn herrschen wütende Diskriminierung bzw. Ausbeutung und eine erschreckende Gleichgültigkeit angesichts dieser Zustände.
Zunächst lässt sich in Deutschland zunehmend ein Eindruck der Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts feststellen. Diesbezüglich sagt die Meinungsforscherin Renate Köcher über die 30- bis 59-Jährigen: „Wenn die mittlere Generation das gesellschaftliche Klima beschreibt, dann hat man das Gefühl, sie fröstelt“ (Mair 2018). Und Köcher weiter:
Die mittlere Generation ist wie die gesamte Bevölkerung im Zwiespalt zwischen der wachsenden Zufriedenheit mit der materiellen Situation und dem Unbehagen über die Entwicklungen in Gesellschaft und Politik. […] Das gesellschaftliche Klima entwickelt sich nach dem Eindruck der mittleren Generation kritisch. Sie diagnostiziert vor allem […] zunehmende Vorbehalte gegenüber Ausländern; zunehmende Rücksichtslosigkeit und weniger Hilfsbereitschaft; weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft. (Köcher 2018: 1)
Читать дальше