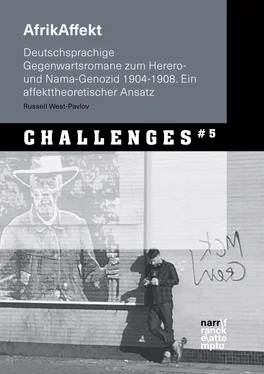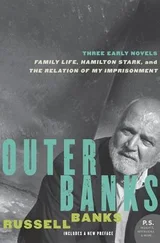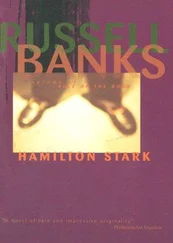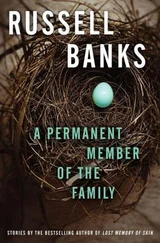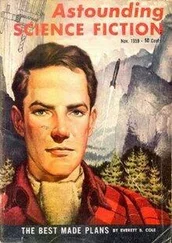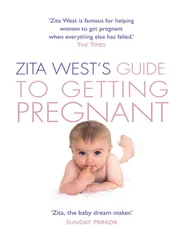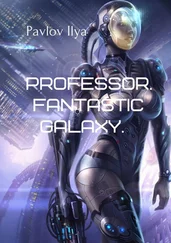Im Jahr 2003, kurz bevor sich der Beginn des Deutsch-Namibischen Kriegs zum hundertsten Mal jährte, wurde Gerhard Seyfrieds knapp betitelter Roman Herero mit großer medialer Wirkung veröffentlicht. Auf die gebundene Ausgabe im Frankfurter Eichborn Verlag folgte 2004 eine Taschenbuchausgabe im Berliner Aufbau Verlag, was darauf hindeutet, dass der Roman ein Verkaufserfolg war. Der Roman präsentiert sich als penibel recherchierte und historisch genaue Wiedergabe des damaligen Geschehens (Seyfried 2003: 4; Thomma 2003) und evoziert somit zwangsläufig die ewige Frage des Verhältnisses von Fakt und Fiktion (vgl. Koschorke 2012; Roesch 2013). Herero löst jedoch seine Versprechungen in einem wichtigen Bereich nicht ein: Die titelgebenden Herero zeichnen sich durch Abwesenheit in weiten Teilen der Handlung aus. Diese auffällige Diskrepanz bietet einen fruchtbaren Einstieg in die Materie der theoretischen und methodologischen Fundierung der vorliegenden Studie.
2.1 Seyfrieds Herero und die Unsichtbarkeit der Herero
Seyfrieds Herero beeindruckt durch den Umfang von 600 Seiten und die Fülle an Material, die es erlaubt, den Deutsch-Namibischen Krieg in seiner Anfangsphase als quasi-welthistorisches Ereignis zu präsentieren. Der versprochene historische Wahrheitsgehalt wird durch verschiedene narrative Methoden unterstützt: Der Roman ist mit Landkarten (Seyfried 2003: Buchdeckel innen), Fotografien (ebd.: 119, 269, 334, 360, 361, 406, 431, 432, 468; allerdings nicht in der Taschenbuchausgabe von 2004), Skizzen (ebd.: 50, 154, 156, 198, 233, 330, 336, 350, 380, 382, 455, 494, 506, die ebenfalls in der Taschenbuchausgabe fehlen), Glossaren (ebd.: 594–601) und Quellenverzeichnissen (ebd.: 602–5) ausgestattet; der Text ist voll von Bezügen zu wahren Begebenheiten, geschichtlich belegbaren Orts- und Personennamen sowie technischen Beschreibungen: „Fast nichts an meinen Schilderungen ist fiktiv“, so Seyfried in einem Interview. „Es stimmt alles so weit wie möglich. Ich habe all die Jahre recherchiert und gut 250 Bücher durchgeackert. Die Figuren sind nahezu alle historisch“ (Thomma 2003).
Angesichts des Anspruchs auf Historientreue und insbesondere des programmatisch anmutenden Titels ist es umso bemerkenswerter, dass die vermeintlich im Vordergrund stehenden Herero selten vorkommen. Ein Abschnitt des Romans Seyfrieds (2003: 200–1) mit dem Titel „Brandungsneger“ steht in außerordentlich scharfem Kontrast zum Beginn von Uwe Timms Morenga (2000 [1978]: 9 / 2020 [1978]: 9), in dem Gottschalk auf dem Rücken eines Eingeborenen durch die Brandung zum Strand getragen wird, und zu einer analogen Textstelle in Paluchs / Habecks Der Schrei der Hyänen (2004: 18). Da, wo Timm und Paluch / Habeck die affektive Reaktion Gottschalks bzw. Arabellas auf den intimen Kontakt zwischen den Körpern schildern (ausführlicher wird hierauf in den Unterkapiteln 5.3, 5.5.2 und 8.3 eingegangen), fällt bei Seyfried die völlige Abwesenheit der afrikanischen Träger ins Auge. Ausführlich geschildert wird jedoch die Neugier des Protagonisten Seelig, ob die „Brandungsneger“, die an Bord des Schiffs kommen sollen, tatsächlich sehr schwarzhäutig seien („Bloß braun wäre enttäuschend, aber so richtig schwarz, das muss seltsam aussehen“; ebd.: 201). Die afrikanischen Arbeiter erscheinen allerdings gar nicht. Sie kommen nicht einmal in Sichtnähe, geschweige denn in intimen körperlichen Kontakt mit den Deutschen. Gottschalks erste Auseinandersetzung mit einem solchen Körperkontakt („Er ekelte sich“; Timm 2000 [1978]: 9 / 2020 [1978]: 9) bahnt den Weg für eine Entwicklung hin zur Vertrautheit mit dem „Geruch nach Erde, Sonne und Wind“ seiner Nama-Geliebten Katharina (ebd.: 254 / 265); ähnlich funktioniert Arabellas Entdeckung, „daß sich die Haut anfühlte, als wäre sie weiß“ (Paluch / Habeck 2004: 18), als leise Andeutung auf die spätere Beziehung zum aufständischen Assa. Im Gegensatz dazu steht Seyfrieds imaginäre Beschreibung der nicht vorhandenen Eingeborenen als geradezu paradigmatisch für die weitgehende Unsichtbarkeit der Afrikaner in einem Roman, der dennoch ihren kollektiven Namen trägt. Da wo Timm und Paluch / Habeck einen viszeralen Affekt beschreiben, der Teil eines Transformationsprozesses ist, der nicht nur andere Menschen, sondern auch das Land und die Umwelt miteinschließt, „schaut“ die Seyfried’sche Figur „gierig hinüber“ (2003: 201) zu einer entfernten, menschenleeren Küste, die somit lediglich als „durchaus paradiesisch[er]“ Gegenstand der kolonialen Raffgier erscheint (ebd.: 201).
Gerade in diesem Widerspruch zwischen der Verwendung des Kollektivnamens und der Abwesenheit der Herero spiegelt sich die grundlegende Ambivalenz in Seyfrieds Roman in Bezug auf die Darstellung der Afrikaner. Einerseits wird durch die häufige Verwendung der erlebten Rede ein unmittelbarer Zugang zum Bewusstsein der wenigen beschriebenen Herero-Figuren suggeriert. Ein solcher Zugang wird sehr früh im Roman anhand der Perspektive der Fokalisierungsfigur Petrus gezeigt, die stellvertretend für einen bestimmten Blickwinkel steht:
Petrus […] läuft auf dem heißen Sand durch den lichten Busch, vermeidet, ohne recht achtzugeben, die scharfkantigen Steine und die nadelspitzen Dornen und denkt dabei an Osona und das große Palaver. Wichtig ist die Häuptlingsnachfolge, das hat man auch überall den Deutschmännern erzählt, aber beim Palaver in der Oganda Osona wird es um etwas viel, viel Wichtigeres gehen. Um was es da geht, das hat den Deutji keiner gesagt, das sollen sie nicht wissen. Nur die schwarzen Menschen wissen, daß es um die große Angst und um die große Wut geht und um die gelben Dinger [d.h. um die Weißen]. Es geht um die Otjirumbu [d.h. um die gelben Dinger, die Weißen]. (Seyfried 2003: 21)
Die erlebte Rede, die eine auktoriale narrative Perspektive mit einer Figurenperspektive verschmelzen lässt (Fludernik 1993), erzeugt ein Gefühl der unvermittelten Nähe zur Erlebniswelt der Figuren. In dieser Textstelle bietet die erlebte Rede einen Zugang zur Welt der Herero, den die zeitgenössischen Deutschen nicht besitzen. Dementsprechend sagt der Autor in einem Interview, „Es geht mir um die Nähe zu dieser Zeit, auch in der Sprache und im Stil“ (Thomma 2003). Und somit liegt Loimeier (2004: 40) zum Teil falsch, wenn er behauptet, dass „die Leser […] nur durch die deutsche Brille vom Krieg in Namibia [erfahren]. Die andere Seite der Medaille – also die Perspektive der Nama und Herero – bleibt vollkommen ausgeblendet.“ Wird doch immer wieder eine, wenn auch künstliche afrikanische Sicht der Dinge in die Erzählung eingebaut.
Loimeiers Einschätzung ist aber zum Teil auch richtig. Denn andererseits wird durch die erlebte Rede bzw. die eigenen Aussagen der Herero-Figuren eine unüberwindbare Fremdheit generiert. Wie durch die soeben zitierte Stelle ersichtlich wird, stört der Einschub von nicht unmittelbar verständlichen Begriffen aus der Herero-Sprache oder die Verwendung ungewöhnlicher semantischer und syntaktischer Strukturen (z.B. „Deutji“, kindisch klingende Verdopplungen usw.) die angeblich mehr oder weniger direkte Vermittlung der Figurengedanken. Somit bleiben sie dem bzw. der Leser*in in dem Moment, in welchem er oder sie der afrikanischen Subjektivität am nächsten kommt.
Diesbezüglich merkt Habeck (2004) an:
[D]ie Schilderung erfolgt nicht mit dem Blick des Weißen (was wohl so sein muss), sondern bestätigt exakt die Erwartungshaltung, mit der man auf Safari geht, um eine seltene Spezies zu besichtigen. Seyfrieds Versuch, den schwarzen Blick zu kopieren, reproduziert das Klischee des Naturmenschen, also den einfachen Gegensatz von Zivilisation und Wildnis.
Vor allem mit Bezug nicht nur auf die Geschichtlichkeit der Ereignisse, sondern vielmehr auf das Geschichtsbewusstsein der fiktiven Herero wird eine unmessbare Ferne herbeigeführt. Seit der Niederlage am Waterberg ist laut einer der Figuren „der Mond einmal rund geworden und wieder ganz mager und noch einmal rund, und bald wird er wieder mager sein“ (Seyfried 2003: 574). Das Zeitbewusstsein der Herero-Figuren bleibt, so der Text, in einer zyklischen, d.h. nicht-linearen und daher vermeintlich primitiven Logik der natürlichen Welt verhaftet (vgl. Fabian 1983: 30; Ricoeur, Hg. 1975). Nur mit großer Mühe kann die Zeit bemessen werden: Die Figur Petrus „zählt so an die vierzig Sommer“ (Seyfried 2003: 21). Seyfrieds Herero-Figuren verharren in einem nicht ganz zeitlosen, doch nur partiell geschichtlich strukturierten Raum (vgl. Hermes 2009: 232–3). Daher die Ambivalenz der Darstellung: Der Roman gibt vor, den Herero-„Aufstand“ bis in die kleinsten geschichtstreuen Details dazustellen und lässt eine Art experientielle Nähe zu den Gegnern zu, schließt sie aber zugleich aus der Geschichtlichkeit der Geschichte aus. Das „afrikanische“ Afrika ist, wie bei Hegel (1961: 163), „kein geschichtlicher Weltteil, er hat keine Bewegung oder Entwicklung aufzuweisen.“ Die Geschichte Südwestafrikas wird „hier bloß an der Schwelle der Weltgeschichte vorgeführt“ (ebd.: 163) und bleibt letztendlich eine europäische Geschichte. Dem Afrikaner dagegen wird eine Teilhabe an jener Geschichte nicht gewährt; sein Wesen ist das eines „Geschichtslose[n] und Unaufgeschlossene[n], das noch ganz im natürlichen Geiste befangen ist“ (ebd.: 163). Die Herero werden somit in eine unüberbrückbare geschichtsphilosophische Ferne verbannt, die die Illusion der Erfahrungsnähe untergräbt. Die Erfahrungsnähe dient schließlich nur der epistemologischen Autorität der Erzählung, die es erlaubt, die Herero als historische Objekte (etwa nach dem Muster der „Geschichte und Gebräuche“, denen das Interesse Ettmanns gilt [Seyfried 2003: 37]) aus unmittelbarer Nähe zu kennen. Sie selbst treten nicht als historisch bewusste Subjekte auf und bleiben dem deutschen Publikum mentalitätstechnisch und geschichtsbegrifflich anhaltend fern. Es ist kein Zufall, dass es am Ende der Erzählung heißt: „Petrus blieb verschollen“ (ebd.: 592).
Читать дальше