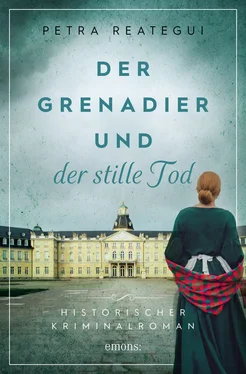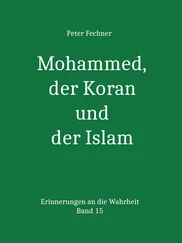Der Mann griff in den Korb und holte eine der Knollen heraus, drehte sie in der Hand, roch daran. »Ich hab so was noch nie gegessen.« Er blinzelte ihr frech zu. »Willst du mich nicht mal bekochen?«
Madeleine erschrak. Die Maïre hatte recht, in der Stadt musste man höllisch aufpassen. Sie wand sich verlegen. »Bei uns dürfen nur Männer Trifulles kochen, ein alter Brauch bei den Waldensern«, behauptete sie und staunte, wie leicht ihr eine solch idiotische Lüge über die Lippen gekommen war, ihre Stimme hatte nicht einmal gezittert.
Tut mir leid, Buondìou, verzeih, eine Notlüge, es ging nicht anders, und sie schickte einen entschuldigenden Blick in den Himmel. Der Wachthabende grinste und steckte die Knolle ein.
»Na gut, dann werd ich sie mir halt selber kochen.«
»In Salzwasser«, rief Madeleine noch und machte sich schleunigst aus dem Staub.
Sie bemerkte den Straßenfeger erst im letzten Moment. Seit jenem Tag, als er ihr geholfen hatte, den Korb zu packen, war er ihr nicht mehr über den Weg gelaufen.
Sie hatte sich noch bedanken wollen, damals, wollte ihm ein paar Nüsse schenken, auch Maronen. Aber da war er, als sie sich umdrehte, schon fort gewesen. Vergeblich hatte sie hinter ihm hergerufen. Die Oberhäusserin gackerte anzüglich. »Na, da haschte dir abba en schöne Verehrer ang’lacht«, höhnte sie. Madeleine lief rot an. Dumme Ziege! Sie kannte diesen Menschen doch gar nicht, hatte ihn noch nie zuvor gesehen, was sollte diese Bemerkung?
Sie wollte eine patzige Antwort geben, aber auf Deutsch fehlten ihr die Worte, was sie nur umso wütender machte. Nie würde sie hierhergehören, nie. Immer blieb sie ausgeschlossen. Verstand nichts und wusste sich nicht auszudrücken. Und wer war schuld daran? Die Maïre und die Nonno, alle diese Alten in Palmbach, die sich weigerten, die neue Sprache zu lernen. Und Pfarrer Doll, der mitmachte und auf Französisch predigte, nur um es sich mit seinen Schäfchen nicht zu verscherzen. Madeleine ballte die Hand zur Faust und wollte gehen, als die Buttermeierin sie am Arm fasste.
»Hör nicht auf die alte Scharteke, Madeleine, die ist nur neidisch, dass sie nimmer so jung und hübsch ist wie du. Und wunder dich net wegen dem Ignatz, der isch halt so, der hilft, wo er kann. Unter uns g’sagt, auch wenn er net redet, ischer doch tausend Mal besser wie der Soldat, der dir da in letzter Zeit schöne Augen macht.«
Sie hatte nicht gewusst, wo sie hingucken sollte, ihr Gesicht begann zu glühen, sie verabschiedete sich schleunigst.
Wenn die Buttermeierin wüsste, was im Hardtwald passiert war.
Vielleicht war ja gar nichts passiert. Aber wenn doch?
Madeleine verlangsamte ihren Schritt. Nein, sie wollte diesen Ignatz nicht überholen, sie müsste ihn dann grüßen, und womöglich würde er sich dann noch einbilden, sie wolle etwas von ihm.
Im gleichmäßigen Rhythmus kehrte er sorgfältig den Dreck vor sich her, säuberte die Gosse, fegte an den Hauswänden entlang, sogar in den Eingängen, was doch eigentlich die Bewohner selbst tun sollten. »Der hilft, wo er kann.« Mit dem Schäufele las der Straßenfeger die Pferdeäpfel auf und warf sie in den dafür vorgesehenen Kasten. Ein Kind, vielleicht acht oder zehn Jahre alt, half ihm. Bestimmt sein kleiner Bruder oder ein Nachbarsbub.
»Da ist sie ja, meine Schöne. Seit Tagen steh ich schon hier und warte, aber jetzt hab ich dich. Jetzt entkommst du mir nimmer.«
Hände umfassten von hinten ihre Taille, krochen unter ihr Schultertuch, suchten den Weg zu ihrer Brust. Kalte Lippen küssten ihren Nacken.
In der ersten Überraschung war sie versucht, sich den Caresses, den Liebkosungen und schmeichelnden Worten des Grenadiers hinzugeben. Dann aber schämte sie sich. Was fiel diesem Sobringer ein? Mitten auf der Straße, gerade jetzt, wo alles zur Arbeit ging! Die Leute schauten schon. Selbst der Junge vom Straßenkehrer. Er hatte nur ein gesundes Auge, das linke war verwachsen. Aber er guckte.
Empört wehrte sie die Umarmung des Soldaten ab. Doch der ließ sie nicht los, drängte sie in ein Seitensträßchen und dort in eine offen stehende Toreinfahrt.
»Ich hab so Sehnsucht nach meiner Schönen gehabt«, hauchte er ihr ins Ohr und presste sie mitsamt ihrem Korb gegen die Hauswand. Sie fühlte sich hin- und hergerissen. Sì, sì, klopfte ihr Herz. Sein Uniformrock roch frisch nach Seifenlauge. Als er sie auf den Mund küssen wollte, kratzten Bartstoppeln über ihre Wange. Sie drehte den Kopf zur Seite.
»Bitte nicht, nicht hier, das geht doch nicht.«
»Was hast du denn? Neulich warst du nicht so zimperlich.«
Er hielt sie fest, presste sich gegen sie, wieder suchten seine Lippen ihren Hals, den Mund. Im Haus klapperte etwas, drinnen in der Parterrewohnung rief eine Frau nach einem Fränzle. Madeleine geriet in Panik.
»Hör auf, lass mich los!«
»Wieso denn, meine Schöne? Das letzte Mal hast du’s doch auch gewollt. Warum zierst du dich jetzt?«
Vergiss nicht, wer wir sind und von woher wir kommen, hörte sie im Kopf die energische Stimme der Nonno, sah die Maïre nicken.
»Versteh doch, meine Leute, ich bin doch keine von euch, ich bin Waldenserin.«
»Mir doch wurscht, was du bist, Waldenserin, Hugenottin, lutherisch, jüdisch, katholisch. Du brichst mir das Herz, wenn du mich zurückweist. Willst du, dass ich an gebrochenem Herzen sterbe? Willst du das?«
Wieder versuchte der Grenadier, sie zu küssen, wieder wich sie ihm aus. Irgendwo schlug eine Tür.
»Ich darf keinen heiraten, der nicht Waldenser ist«, stieß sie hervor.
»Heiraten?«
Er ließ sie los. »Wer redet denn von Heiraten? Da haben wir uns mal ein bissel vergnügt, und du redest von Heiraten. Seid ihr denn alle gleich, ihr Weiber?« Sobringer war laut geworden, seine Augen funkelten böse.
»Aber was, wenn was passiert ist?«, stotterte Madeleine.
»Was soll das heißen: ›wenn was passiert ist‹?« Jetzt brüllte er. »Erst den kleinen Finger nehmen und dann die ganze Hand wollen. Genau wie dieses Aas von Catharina, du bist genauso eine Hure wie sie …«
»Catharina? Catharina Würbsin?« Madeleine schrie auf, schlug aber sofort die Hand vor den Mund. »Aber was ist, wenn ich schwanger bin?«, flüsterte sie.
Sobringers Hand klatschte hart auf ihre Wange.
Laut kläffend kam ein Hund aus dem Hof gesaust, gleich dahinter ein Mann mit einer Forke.
»Haut bloß ab, in meim Haus wird net g’schtritte. Raus mit euch, raus!«
Madeleine stolperte, die Finger in die Trageriemen der Kiepe verhakt, aus dem Durchgang. Die Häuser der Gasse verschwammen, die Gärten gegenüber, Bäume, Sträucher, Zäune, Ställe, Misthaufen, ein paar pickende Hühner. Alles wurde unwirklich, das dämmrige Morgenlicht, der schwarze Köter, der zähnefletschend das Hoftor bewachte, der Grenadier Sobringer in seinem schönen blauen Rock. Er stapfte davon und schaute sich nicht mehr um. Tränen liefen Madeleine übers Gesicht, in den Ohren ein Brausen. Das Einzige, an was sie denken konnte, war: der Honig. Hoffentlich ist dem Honig nichts passiert, ich muss zum Markt damit. Hoffentlich ist der Krug nicht kaputt, der Deckel nicht verrutscht, hoffentlich …
Und die Trifulles! Sie wollte doch zum Tulpenwirt und ihm die Grumbiire geben. Und zur Medicinalratswitwe, für die sie, als die Maïre und die Nonno außer Haus waren, Zuckernüsse gebrannt hatte. Zum Dank für das Kleid. Aber Madeleine rührte sich nicht von der Stelle.
»Warum heulsch du denn?« Der Bub des Straßenfegers zupfte sie am Ärmel, verschreckt zuckte sie zusammen. Ignatz mit seiner Karre stand hinter ihm, mitten auf dem Weg, und schaute dem Grenadier nach. Seltsame Laute kamen aus seinem Mund. Als knurrte und grunzte ein Tier. Dazwischen Keuchen, leise Schreie. Unwillkürlich trat Madeleine einen Schritt zurück. Doch schon verstummte der Straßenfeger und blickte zu ihr.
Читать дальше