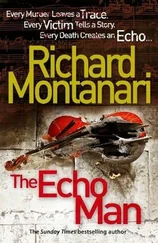Das Spiegelei wird nun auf einer frisch abgeschnittenen Scheibe Kneippbrot angerichtet, auf dem ich schon vorher zwei Scheiben Käse vom Typ Gouda ausgelegt habe. Das heiße Ei schmilzt in die Oberfläche des Käses ein, wird damit eins, gewissermaßen, ich salze und hebe Messer und Gabel.
Gleichzeitig draußen im Garten: Ein Grauspatz tschilpt in der Kiefernhecke.
Das ist Glück.
Später laufe ich im Zimmer hin und her und spiele ein wenig mit einem Gedanken. Im erwähnten Selbsthilfebuch wird dem Leser geraten, den Tag mit einem Projekt zu füllen, einer konkreten Handlung, die zunächst wenig verlockend wirkt. Es kann etwas so Alltägliches sein wie in einem Zimmer aufzuräumen, das man einige Wochen oder Monate lang seinem eigenen Schicksal überlassen hat. Oder den Anruf beim Finanzamt zu tätigen, den man auf- und auf- und aufgeschoben hat. Wenn man etliche Bücher dieser Art gelesen hat, weiß man so nach und nach, worum es geht. Im Kleinen anfangen. Sich winzige Siege erkämpfen, um dann zu expandieren. Sich in ein neues Selbstgefühl hineinarbeiten. Na gut. Es ist leicht und verlockend, sich über solche Literatur lustig zu machen, aber meine Erfahrung besagt, dass viele dieser Autoren doch allerlei zu bieten haben. Deshalb überlege ich mir nun ein Projekt. Irgendetwas, vielleicht eine kleine Übung, mit der ich den Tag füllen kann. Der Schimmelpilz ist zu umfassend. Ich werde fachkundige Hilfe brauchen, das steht fest, auch jetzt bei Tageslicht. Außerdem werde ich dem Protokoll folgen, wenn es darum geht, die Angelegenheit der Hausbesitzerin gegenüber zur Sprache zu bringen. Es wird am letzten Sonntag im Monat geschehen, es liegt also noch ein Stück in der Zukunft. Bis dahin muss ich mich mit der Lage abfinden, selbst wenn damit ein gewisses Risiko für Gesundheit und Wohlbefinden verbunden ist. Ein wichtiges Projekt von nun an wird sein, der Versuchung zu widerstehen, mich aufs Sofa zu legen, wenn die Nacht hereinkriecht. Aber zuerst der heutige Tag. Das ist ja eigentlich ziemlich einleuchtend. Gestern Vormittag musste ich mich gewaltig zusammennehmen und etliche alberne Rituale durchführen, um mich am Küchenfenster der Vermieterin vorbeizutrauen. Jetzt sage ich mir halblaut, dass es so wirklich nicht weitergehen kann. Sich nach Belieben zwischen Wohnung und Außenwelt hin- und herbewegen zu können, gehört zur eigentlichen Grundlage für ein selbstständiges Dasein an einer privaten Adresse. Nein, mein Guter, so kann das nicht weitergehen. Das musst du in den Griff bekommen, und zwar sofort. Ein Beispiel wie aus dem Selbsthilfebuch entsprungen. Ich sehe die Kapitelüberschrift vor mir: »Der schwierige Weg zum Briefkasten«. Und muss gleichzeitig ein bisschen lachen. Es ist wichtig, das hier mit einem gewissen Humor auszuführen.
Den Briefkasten mit einem Menschen zu teilen, der für den Moment noch wildfremd ist, ist auch etwas, woran ich mich gewöhnen muss, denke ich, während ich mir die Schnürsenkel zubinde. So weit ich sie aufgrund von Sprache und Aussehen beurteilen kann, haben wir es hier mit einer typischen Aftenposten -Abonnentin zu tun. Was also, wenn mein tägliches Exemplar von Dagsavisen anfängt, den Weg in den einzigen Briefkasten an dieser Adresse zu finden? Naja. Man soll die Probleme nehmen, wie sie kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist einer der Chefredakteure von Aftenposten ein ehemaliger Maoist. Einer von denen, die 1974 gegen Norwegens demokratisch gewählte Regierung zu den Waffen greifen wollten. Das verdient ein feines kleines Lachen.
Ich gehe mit raschen Schritten die Treppe hoch, ich biege um die Hausecke, ich zögere nicht, mein Plan ist es, diese Tour in einem einzigen Zug hinzulegen. Als ob das passierte, während sich das Ei unten in der Sockeletage im Fett der Pfanne spiegelt. Ich laufe fast, es ist die erste Trainingsrunde des Tages. Aber soll ich mein Gesicht dem Küchenfenster und dem Raum dahinter zuwenden, oder soll ich es lassen? Ist es nicht unhöflich, einfach so vorüberzurennen? Ist es nicht noch unhöflicher, zu ihr hineinzuschauen? Was, wenn sie sich in einer Situation oder Position befindet, die mich als Mieter nichts angeht? Ein wenig entmutigt bleibe ich bei der Mülltonne stehen. Die ich dann öffne, und nun gebe ich vor, eine Tüte voll Abfall hineinfallen zu lassen. Es ist ein schöner Tag, das steht immerhin fest. Sonne und blauer Himmel. Ein wenig Wind. Die Baumkronen wiegen sich. Hinten beim Tor ahne ich durch die farbenfrohen Zweige der Berberitze den grünen Briefkasten. Das ist das Ziel. Es ist absolut in Reichweite. Ich lasse die Mülltonne los und segele, den Blick auf den Briefkasten gerichtet, durch den Garten hinter dem Haus, es ist fast wie im Traum. Und wie erwartet: leer. Geleert. Es wird noch einige Tage dauern, bis Dagsavisen eintrudelt, sie haben etwas von einer Woche angedeutet.
Das Wichtigste war ja eigentlich der Weg, denke ich, das ist ein bisschen altklug, aber jetzt habe ich es wenigstens hinter mir. Ich freue mich auf einen Tee. Vielleicht eine gute Radiosendung.
Aber das Schicksal will es anders. Auf halber Strecke zur Tür muss ich feststellen, dass diese aufgleitet und dass Annelore Frimann-Clausen auf die Treppe tritt, gewandet in die sportliche Allwetterjacke, die mir gleich bei meinem Eintreffen aufgefallen ist. Vernünftige Spazierschuhe trägt sie außerdem.
»Die Post kommt selten vor eins«, kann sie mitteilen. Sie sagt es halb über ihre Schulter, während sie die Tür hinter sich abschließt. »Aber du, eine Kleinigkeit noch …«
Jetzt kommt es, denke ich. Denn wenn jemand einen Satz auf diese Weise anfängt, dann geht es nur höchst selten um Kleinigkeiten. Ich würde am liebsten eine Verabredung vorschützen, aber dann reiße ich mich zusammen. Hätte ich dreißig Sekunden mit dem Verlassen der Wohnung gewartet, hätte diese Begegnung nicht stattgefunden. Und da gehe ich doch davon aus, dass sie vom Schicksal so bestimmt worden ist. Dass es so sein soll.
Sie macht sich an ihrer Handtasche zu schaffen und zieht einen kleinen Schlüssel hervor. »Der ist für die Sigurdsbude. Du kannst ja bei Gelegenheit mal einen Blick reinwerfen, es eilt nicht. Aber irgendwann vor Weihnachten hätte ich sie gern geleert.«
Sie erklärt, dass sie mich für diese Arbeit natürlich bezahlen wird. Dass aller Inhalt, abgesehen von Werkzeug und Hobelbank, weggeworfen werden soll.
Ich nehme den Schlüssel ein wenig widerwillig entgegen. Waren das nicht Befehle und Informationen, die sie bei einer schmackhaften Mahlzeit am letzten Sonntag im Monat vortragen wollte? Hat sie das schon vergessen? Wäre es richtig von mir, das jetzt sofort zu erwähnen, oder wird von mir erwartet, dass ich bis zum erwähnten Sonntagsessen in Schweigen verharre?
Sie muss mein Zögern gesehen haben, denn nun fügt sie rasch hinzu: »Ja, ich kann natürlich andere darum bitten. Du darfst das wirklich nicht missverstehen. So bin ich absolut nicht. Aber den Schlüssel brauchst du doch trotzdem. So. Das war schon alles. Und jetzt muss ich laufen, damit ich den Bus noch erwische.«
»So«, denke ich. »So bin ich nicht.«
Sehe, wie sie über den Bürgersteig eilt. Sie winkt.
Ich winke zurück.
Plötzlich erfüllt mich wieder diese unerwartete Freude. Hier stehe ich in einem Garten in Grefsen und winke und winke. Mit einem blanken Schlüssel in der Hand.
Das Leben ist wunderlich und unvorhersagbar.
»So bin ich nicht«?
In einer gewissen Zeit nach dem Tod meiner Mutter hatte ich mein Leben aus dem Griff verloren. Damit Ordnung und Fleiß wieder hergestellt werden konnten, mussten vorübergehend andere das Steuer übernehmen. Das kommt in den besten Familien vor. Das Dasein wächst einem über den Kopf. Man endet im Chaos.
Es ist dieser Zustand böser Anarchie, an den ich jetzt denke, als ich die Tür der Sigurdsbude öffne. Hinter mir: der herbstliche Garten mit dem melancholischen Zwitschern von Meise und Zeisig und dem Gurgeln in den Dachrinnen des Hauses. Vorn: ein Raum, der stark an meinen eigenen Kleiderschrank in der erwähnten Periode erinnert. Eine massive Wand aus Gegenständen. Eine Art Installation einer gequälten Yoko Ono. In dem kompakten Chaos kann ich ganze Möbel, Teile von Möbeln und Möbeltrümmer sehen, Ordner und Papiere, Stapel von Zeitungen und Zeitschriften, Pappkartons und Schuhkartons, Vorhänge und Teppiche, alte Farbeimer, geöffnete Zementsäcke. Bücher. Spielzeug. Werkzeug. Das alles und unendlich viel mehr. Wie gesagt: eine Wand. Wo die Hohlräume, die entstanden sind, wenn größere Gegenstände aufeinandergestapelt wurden, nach und nach von anderen und kleineren gefüllt worden sind. Im Winkelraum zwischen einer zerbrochenen Lampe und dem Türrahmen: kleine Medizinflaschen, hineingeschoben, bis kein Platz mehr war. Zwischen den Fächern eines zerbrochenen Regals: Konservendosen voller Schrauben, Nägel und Maschinenteile, mit peinlicher Genauigkeit nach Höhe und Breite gestapelt. Und überall, in allen kleineren Ritzen und Hohlräumen: Papierservietten in allen Regenbogenfarben, zusammengefaltet und hineingeschoben, ein Flickenteppich des Wahnsinns aus diesem und jenem und dem Teufel und seiner Großmutter, so etwas habe ich noch nie gesehen, aber das habe ich eben doch. In meinem eigenen Schlafzimmer, in der guten alten Blockwohnung, in der Mutter und ich in Alltag und Kampf zusammengelebt haben.
Читать дальше