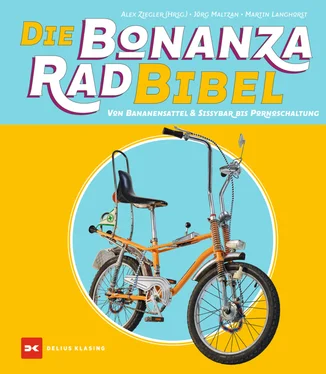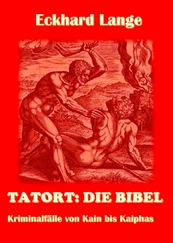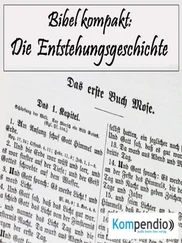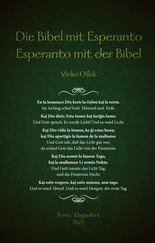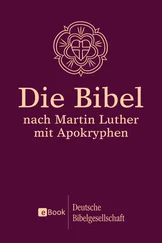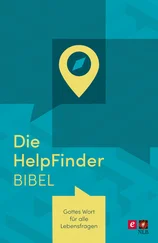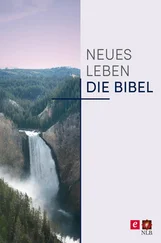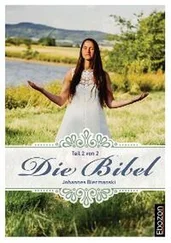Aus Hohn wird Begeisterung
Nur die neuen Bosse ganz oben bleiben skeptisch. Nach dem Tod des Chefs übernehmen die beiden Schwinn-Söhne die Firmenleitung. Sie sehen wenig bis keine Chancen für das neue Fritz-Projekt, geben aber trotzdem grünes Licht. Dem Unternehmen geht es gut, es ist gesund und stark genug, eine Fehlentwicklung im Segment der Kinderräder zu verkraften. Also macht sich Fritz auf die Suche nach einem treffenden Namen. Angeblich sollen ihn die hohen Lenkerenden an einen Stachelrochen (Sting-ray) erinnert haben. Wahrscheinlicher steckt hier - anders als beim Penguin - eine kühle Marketingüberlegung dahinter. Die enge Anlehnung der Fritz-Erfindung an getunte Motorräder schreit eigentlich nach einer Namensgebung aus der Chopper-Szene. Das Problem daran: Die gepimpten Motorräder sind verstärkt in Banden und Gangs beliebt, die häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder sich illegal im Land aufhalten. Mit diesen negativen Assoziationen will Schwinn nichts zu tun haben.
Viel braver, aber dennoch faszinierend erscheint den Verantwortlichen wohl eher ein Name aus der Autowelt. Hier kommt für Schwinns High-Riser der Sportwagen von General Motors (GM) ins Spiel. Der heißt seit 1953 Corvette und trägt seit Herbst 1962 den Zusatz Sting Ray. Ein passender Name auch für das neue Fahrrad, befindet Schwinn. Wenig später werden Schwinns Stingray und GMs Corvette Sting Ray gemeinsam auf Werbemotiven abgedruckt. Außerdem erhält das Rad den Claim: »The bike with the sports car st. Die Kampagne nimmt Fahrt auf; ein Erfolg scheint programmiert. Nur der neue Firmenboss Frank V. Schwinn bleibt noch zurückhaltend. Fritz bietet seinem zaudernden Chef eine Wette an: »Frank, wir werden bis zum Jahresende 25.000 Stück davon verkaufen.«

Spätestens Mitte der 60er-Jahre setzt in den USA ein wahrer High-Riser-Hype ein. Ob Fachhandel, Kaufhäuser wie Sears oder Versandunternehmen – sie alle bringen die neuen Jugendfahrräder unter fantasievollen Namen ins Programm.
Im Mai 1963 laufen die ersten J-38, so der interne Werkscode, in Chicago vom Band. Einen Monat später taucht das Stingray in den Showrooms auf. Und steht nie lange. Im Gegenteil: Das Käuferinteresse ist so groß, dass viele Räder vorbestellt werden - zumindest in Kalifornien. In den anderen US-Staaten tun sich die Händler anfangs schwer. Sie ordern meist nur ein Ausstellungsmodell. Doch noch während des Sommers erfasst quasi die gesamte USA ein verblüffender Stingray-Boom. Bis zum Jahresende verkauft Schwinn 45.000 Stück. Deutlich mehr hätten noch abgesetzt werden können, wäre Schwinn nicht der Nachschub an Hinterrädern ausgegangen. Fritz schmunzelt; die Wette gegen seinen Chef hat er gewonnen.
High-Riser werden zur Massenware
Der plötzliche Erfolg macht natürlich schnell die Runde in der Industrie. Zügig tauchen Nachahmer auf: Ob Sears, Montgomery Ward oder JC Penney - alle großen US-Versandhäuser und Handelsketten nehmen schnell eigene High-Riser mit Namen wie Spyder oder Swinger ins Verkaufsprogramm. Ein sehr frühes Modell ist auch das Roadmaster Renegade, das von der AMF Corporation in Olney, Illinois, hergestellt wird. Irrtümlich wurde als Marktstart lange 1962 genannt, was das AMF neben dem Huffy Penguin zum ersten Serien-High-Riser gemacht hätte. Tatsächlich jedoch kommt das Roadmaster Renegade erst 1964 in die Geschäfte. Zu den großen Marken, die früh auf High-Riser setzen, gehört Ross Bicycles. Das Ross Polobike gibt es schon Ende 1963. Danach ist das Ross Baracuda eines der ersten Modelle mit einem langen Schalthebel auf dem Oberrohr. Außerdem hat es eine imitierte Telegabel verbaut, wie sie später in Deutschland an den meisten Bonanzarädern zu finden ist.
Nach und nach steigt die Zahl der High-Riser-Anbieter immer weiter. Ausstattungen und Details variieren dabei so stark wie die fantasievollen Namen. Zu ihnen gehören das Murray Firecat, Columbia Mach 5, Sears Gremlin, Royal Sport Jet Star, Western Flyer Wheelie Bike, Huffy Cheatersilk und Coast King, Grants Slingshot, Ross Apollo. Bei der Rahmenform zeigen sich die meisten US-Hersteller konservativ und bleiben beim geschwungenen Cantilever-Rahmen. Ausnahme: Murray. Das Eliminator, das 1967 auf den Markt kommt, ist gradliniger gestaltet und könnte ein Vorbild für die Bonanzaräder made in Germany sein.
Von Anfang bis Ende der 60er-Jahre sorgt der High-Riser-Hype maßgeblich dafür, dass sich die jährlichen Fahrradverkäufe in den USA von vier auf knapp acht Millionen Exemplare verdoppeln. Ein Erfolg, der selbst große Optimisten wie Al Fritz überrascht haben dürfte. Schwinn ist mit seinem Entwicklungschef Fritz zwar nicht die erste Firma, die einen High-Riser in Serie produziert, aber sie verhilft ihm zum landesweiten Durchbruch und erhebt das Stingray in den Rang einer Fahrradikone. Natürlich findet der Trend im Nachbarland Kanada Nachahmer. Ein besonders bemerkenswerter Entwurf ist das Wedge der Canadian Tyre Company. Es ähnelt ebenfalls stark den deutschen Bonanzarädern, die etwas später auf den Markt kommen. Gleiches gilt für ein weiteres Modell aus Kanada: Das Tribisa Coster sieht ebenfalls deutlich maskuliner aus als die Stingrays. Unter anderem deshalb, weil The Wedge und das Coster auf eine Mischbereifung mit einem 16-Zoll-Rad vorn und einem 20-Zoll-Rad hinten setzen - eine Auslegung, wie sie ab 1968 auch bei den Stingrays mit dem Krate sehr beliebt wird. Ein weiterer 16/20-Zoll-High-Riser ist das Columbia SSS von 1969. Es sieht dem Easy Rider aus Italien und auch einigen deutschen Derivaten mit ihrem extrem langen Telegabelimitat ziemlich ähnlich.
Die High-Riser erreichen in Amerika ihren größten Absatz im Jahr 1968. 4,8 Millionen Exemplare werden verkauft. Bis 1974 geht ihre Zahl auf immer noch erstaunliche drei Millionen Stück zurück - 2,4 Millionen davon stammen aus heimischer Produktion. Deutlich spürbar ist zu dieser Zeit ein Modeschwenk: High-Riser bleiben bei Kindern bis 14 Jahren ein echter Hit, ältere dagegen steigen zunehmend um auf schnellere Sporträder mit 24-Zoll oder 26-Zoll-Bereifung. Zu diesem Zeitpunkt ist das Stingray bereits seit mehr als zehn Jahren fest als unverwechselbarer Radtyp in der amerikanischen Popkultur verankert.
Handelskrieg: USA vs. Deutschland
Als die neue Fahrradmode Ende der 60er-Jahre die Alte Welt erreicht, sehen die USA plötzlich ihre Felle davonschwimmen. Nachahmer aus Europa kommen auf den Markt. Auch in den USA. Die amerikanische Fahrradindustrie fürchtet vor allem die Konkurrenz aus Deutschland. Darum ruft sie 1971 sogar die Tarif-Kommission an. Sie soll prüfen, ob Räder mit 20-Zoll-Bereifung, die hauptsächlich an Kinder verkauft werden, eine unzulässige Konkurrenz darstellen. Entwarnung: Obwohl die deutschen Räder unter dem Preis der amerikanischen Produkte liegen - dem sogenannten less than fair value -, sieht die Kommission durch die Deutschlandimporte keine unfaire Beeinträchtigung der amerikanischen Fahrradindustrie. Turbulenzen um die jugendliche Fahrradmode erzeugen aber nicht nur die Wettbewerbsbedingungen, sondern vielmehr Sicherheitsaspekte. Denn an den High-Risern wächst die Kritik durch fragwürdige Fahrdynamik, Stürze und gefährliche Anbauteile. Doch was als verrufen gilt, kriegt manchmal einen besonders begehrenswerten Charme - vielleicht auch ein Grund für die High-Riser-Crazyness, die Ende der 60er-Jahre in den USA auf ihren Höhepunkt zusteuert.

Anders als das erfolgreiche nur schwarz-weiß lieferbare Huffy Penguin setzt Schwinn schon beim allerersten Stingray auf mehr Vielfalt. Als es Mitte 1963 auf den Markt kommt, ist es in zwei Ausführungen erhältlich: Basismodell ist das J38. Es kostet 49,95 Dollar und hat keine Schutzbleche. Für sieben Dollar Aufschlag offeriert Schwinn das Deluxe Stingray (J39) mit Chromfedern, Weißwandreifen, bequemerem Bananensattel sowie einem extragroßen Katzenauge. Beide Modelle sind in den klingenden Farben Flamboyant Lime, Rot, Radiant Copperstone, Sky Blue oder Violet lieferbar.
Читать дальше