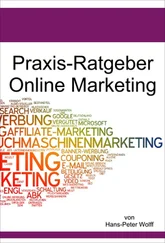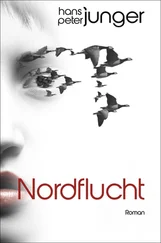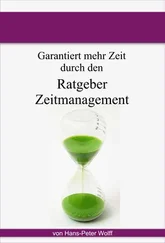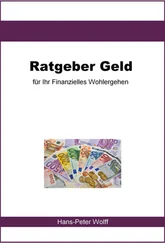Das Rollmaterial: von der Ausland- zur Inlandherstellung Das Rollmaterial: von der Ausland- zur Inlandherstellung Bis zum Ersten Weltkrieg steigt der Rollmaterialbestand in der Schweiz auf gegen 20000 Güterwagen 66 und 5000 Personenwagen 67 , 1905 gibt es 1331 Dampflokomotiven und bereits 29 elektrische Lokomotiven, ferner 151 Triebwagen 68 . In den ersten Jahrzehnten importieren die Schweizer Bahnen ihre Wagen und Lokomotiven hauptsächlich aus Deutschland, teilweise aus Frankreich, aus dem Elsass und aus entfernteren Gegenden. In der Schweiz selbst entwickelt sich zaghaft eine eigenständige Herstellung von Rollmaterial. Da gibt es die Werkstätten der grossen Privatbahnkonzerne in Yverdon, Olten, Zürich und Rorschach. Die grösste Privatbahnwerkstatt, Olten, beschäftigt in ihren besten Zeiten über 1000 Leute. Aber auch bestehende Industriebetriebe wie Escher Wyss in Zürich oder Rieter in Winterthur bieten sich für Rollmateriallieferungen an, und neue Firmen wie die «Schweizerische Industriegesellschaft» SIG werden gegründet.
Arbeiten für die Bahn: 110-Stunden-Wochen und monatlich anderthalb freie Tage Arbeiten für die Bahn: 110-Stunden-Wochen und monatlich anderthalb freie Tage Sowohl der Bau als auch der Betrieb von Eisenbahnen ist in den ersten 125 Jahren personalintensiv. Insgesamt arbeiten bis zu 60000 Menschen für den Bahnbetrieb und zeitweise über 40000 auf den Bahnbaustellen. Die Zahl der für den öffentlichen Verkehr Arbeitenden sollte sich danach noch verdreifachen.
Immer mehr Güterverkehr, immer schnellerer Personenverkehr Immer mehr Güterverkehr, immer schnellerer Personenverkehr Mit dem Bahnbau setzt das Industriezeitalter seine beiden wichtigsten Massstäbe durch: immer mehr, immer schneller. Fabriken waren zuvor lokale und mit dem Seetransport ihrer Güter auch schon globale Phänomene, nun aber werden Güter und Menschen flächendeckend auf dem Festland mobil: Je mobiler die Arbeitskräfte und je billiger der Gütertransport sind, desto höher kann der Profit sein – immer mehr Kapital verliert seine lokale Bindung.
Wasserwege und Strassen – die Eisenbahn im Rahmen des Gesamtverkehrs
Zeitabschnitt 1904–1963: Staatliche Bahnen für Industrie-Investitionen
Verstaatlichung, Politik und Gesetze in Kriegs- und Krisenzeiten
Verschuldung und Staatskapital für Modernisierungen
Bahnvollendungen, Infrastrukturausbau und Strassenbahn-Stilllegungen
Weltweit einzigartig: die hundertprozentige Elektrifizierung
Elektrifizierung auch der Eisenbahnsicherungstechnik
Die stärkste Lokomotive, die modernsten Wagen der Welt
Die Werktätigen im Krisen- und Kriegszustand
60 Jahre Personen- und Güterverkehr unter Bundesdominanz
Die Bahnen im Rahmen der gescheiterten Gesamtverkehrskoordination
Zeitabschnitt 1964–2023: Bahnen subventionieren die Bau- und Ausrüstungswirtschaft
Von der Expo 64 zur Bahnreform im globalen Spannungsfeld
Investitionen für eine Renaissance des Schienenverkehrs
Bahn 2000 und Alptransit: Baumilliarden für den Regional- und den Transitverkehr
Die SBB behalten ihre Kraftwerke
Teure Bahnsicherheit, unsichere Öffentlichkeit
Globalisierung der Rollmaterialindustrie, Vereinsaktivitäten für Nostalgiefahrzeuge
Kulturrevolution in den Chefetagen, Gürtel-enger-schnallen beim Personal
Zusammenschluss und Aufsplitterung des öffentlichen Verkehrs
Grenzenlose Mobilität auf Kosten der Umwelt und der Steuerzahler
Anhang
Beteiligte
Anmerkungen
Ausgewählte Quellen
Schweizer Bahnen – ein Mythos? Die vorliegende Geschichte zeigt in drei Teilen von je sechzig Jahren das Entstehen, die Höhepunkte und das Verharren des Mythos: die Finanzierung und den Bau der längsten Tunnel der Welt, die Planung der ersten Zahnradbahn, der höchsten Bergbahn und der höchsten Alpenquerung Europas, die Pionierwerke der frühen Elektrifizierung mit ihren leistungsfähigsten Kraftwerken, höchsten Staumauern und stärksten Lokomotiven der Welt. Und nun, gefördert durch die Umweltproblematik, sind die Schweizerinnen und Schweizer Weltmeister im Bahnfahren. Ein Mythos birgt auch die Gefahr, unfassbar mystisch zu werden, zur Mystifizierung zu verkommen, also zur Täuschung, zur Vorspiegelung und zur Irreführung. Solch glorifizierende Werke zur Geschichte der Schweizer Bahnen gibt es zuhauf. Um das Thema zu verankern, ist jeder Zeitabschnitt in neun Kapitel gegliedert: 1. Politik, 2. Finanzierung, 3. Bau, 4. Energie, 5. Sicherheit, 6. Rollmaterial, 7. Personal, 8. Betrieb und 9. Gesamtverkehr.

Die Rheinbrücke bei Etzwilen ermöglicht der Winterthurer Nationalbahn einen Anschluss nach Deutschland, nachdem die Zürcher Nordostbahn bereits Schienenverbindungen in Schaffhausen und Koblenz erstellt hat. Die teuren Brückenbauten sind ein Grund für den Konkurs der Bahn.
H. P. Bärtschi 1977
Zeitabschnitt 1844–1903: Privatbahnen für Privatbanken
Bundes- oder Privatbahnen? Alfred Escher setzt sich – vorerst – durch
Die Verkehrsgeschichte zwischen der Eröffnung der ersten Eisenbahn auf Schweizer Boden am 15. Juni 1844 und der Verstaatlichung der Hauptbahnen in den Jahren 1901 bis 1909 ist geprägt von der Expansion und den Krisen von fünf privaten Bahnkonzernen. Sie gruppieren sich um die alten Machtzentren Basel, Zürich, St. Gallen, Bern und Luzern.
Kleinere Bahngesellschaften saugen sie auf oder sie belassen sie als Nebenbahnen. Sie schaffen weitgehende regionale Transportmonopole und übertragen die Anstossfinanzierung und die Krisenfolgen der öffentlichen Hand.

Die Dampflok Limmat in voller Fahrt: Die Rekonstruktion zum 100. Geburtsjahr von 1947 dient der nationalen Eisenbahn-Identität.
Flughafenbahn-Einweihung, H. P. Bärtschi 1980.
Erste Eisenbahnprojekte scheitern am Kantönligeist
Schienenbahnen sind seit dem späten Mittelalter auch in der Schweiz bekannt. 1Um 1800 kommen in England, Frankreich und Russland «Dampfkraftwagen» auf. 1825 weiht George Stephenson mit seiner «Locomotion» zwischen Stockton und Darlington die erste öffentliche Dampfeisenbahn ein. 1829 führt die Liverpool and Manchester Railway nach der Ausschreibung eines Wettbewerbs ein Wettrennen bei Rainhill durch, das Stephenson mit seiner Dampflok «Rocket» gewinnt. 220 Jahre später sollte sein Sohn Robert Experte für den Bahnbau in der Schweiz sein. Bereits 1835 drängen Zürcher Unternehmer auf den Bau von Eisenbahnen. Am 11. März 1836 verlangt die kantonale Handelskammer den Zusammenschluss der projektierten Bahnen von Strassburg nach Basel und von Augsburg nach Lindau – natürlich über Zürich. Die Regierung soll mit öffentlichen Geldern eine der wichtigsten Erfindungen der neueren Zeit, die Eisenbahn, fördern, damit die Schweiz nicht zurückbleibe. Private Handelsleute rechnen sich mit ihren Eisenbahninvestitionen hohe Dividenden aus, appellieren aber an den Staat, dass «ohne die thätige Mitwirkung sämmtlicher Cantonsregierungen eine blosse Privatgesellschaft mit den sich entgegenstellenden Hindernissen nie ferotig werden könne». 3In Zürich sind die Liberal-Radikalen seit der Pariser Julirevolution von 1830 an der Macht. Sie vollenden die 1798 begonnene Privatisierung des Grundeigentums und fördern mit den Erlösen die Verkehrs- und Industriefinanzierung: Gemeinden, Kantone und Private verlieren die jährlichen Einnahmen aus Zehntenabgaben und Grundzinsen, erhalten aber die einmaligen Loskaufsummen von den Bauern. Vor allem Kleinbauern müssen sich privat verschulden und sich über Wasser halten mit Landverkäufen, mit Milchwirtschaft anstelle des Ackerbaus und als Rucksackbauern mit Fabrikarbeit. Im schweizerischen Vergleich setzen die Zürcher Liberalen mit dem Ablösungsgesetz von 1831 das kapitalistische Privateigentum besonders radikal durch. Die öffentliche Hand, bisher zu rund der Hälfte von Grundeigentumseinnahmen finanziert, führt neue Steuern ein, unter Schonung der Privatvermögen und der hohen Einkommen. Die neuen Finanzmittel ermöglichen den Ausbau eines Netzes von guten Fahrstrassen. Die allgemeine Schulpflicht kommt, Kantonsschule, Kantonsspital und die Universität werden neu eingerichtet. 4
Читать дальше