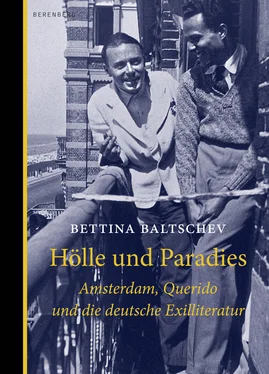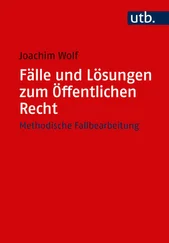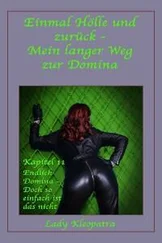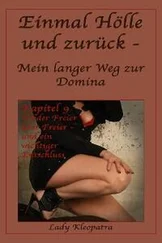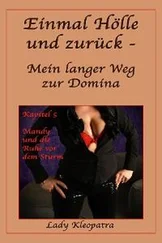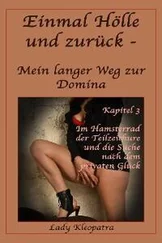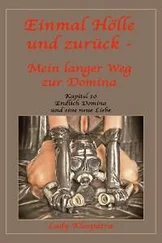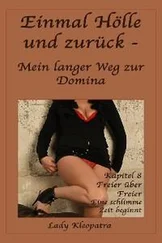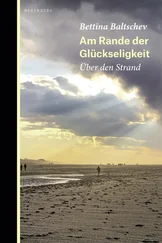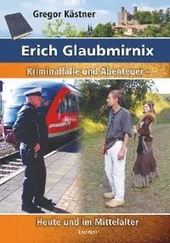Es klingt wie die Szene aus einem Roman, und tatsächlich: Wer die deutsche Exilliteratur, die in den 1930er Jahren im Querido Verlag erscheint, aufmerksam liest, dem begegnen immer wieder ähnliche Szenen – Menschen, die in Züge steigen, in Zügen sitzen, die an Bahnsteigen warten, winken, weinen. D-Zug dritter Klasse von Irmgard Keun ist das einzige Buch, das komplett in einem Eisenbahnabteil spielt, ansonsten ist es vor allem ein großes Kommen und Gehen, ein dauerndes Abschiednehmen und Wiedersehen, das die Exilschriftsteller zwangsweise selbst erlebt haben und das sie in ihren Büchern beschreiben. So erzählt in Kind aller Länder, einem Roman ebenfalls von Irmgard Keun, das zehnjährige Mädchen Kully von den Reisen mit ihrer Mutter quer durch Europa. Ständig fahren die beiden dem Vater nach oder dem Vater voraus, der als rastloser schreibender Emigrant unterwegs ist. Nach Brüssel verschlägt es sie, nach Paris, nach Italien und auch nach Amsterdam, wo – nicht ganz zufällig – der Verleger von Kullys Vater lebt, ein gewisser Herr Krabbe. »Alles ging sehr schnell, wir sind in einem Ruck nach Amsterdam gefahren, weil wir keine Zeit hatten und kein Geld, um die Reise zu unterbrechen. Abends kamen wir in Amsterdam an und wurden von Herrn Krabbe abgeholt. Mein Vater hat sich noch auf dem Bahnsteig alles Geld von ihm geben lassen, das er bei sich hatte.«
In Lion Feuchtwangers Roman Exil aus dem Jahr 1940 kreisen die Geschehnisse um die Pariser Nachrichten und das Schicksal des Journalisten Friedrich Benjamin. Auch er nimmt den Nachtzug von Paris nach Basel, um dort einen Informanten zu treffen: »Er zieht die Beine hoch. Da liegt er wie ein Embryo im Mutterschoß. ›Gute Nacht‹, wünscht er sich und schläft ein, jenes weise, resignierte, selbstkennerische, verschönende Lächeln um die Lippen. Der Zug schaukelt ihn, er schläft sanft und tief, ein wenig schnarcht er. So also fährt er dahin, durch die Nacht, der Südostgrenze zu, der vermeintlichen Sicherheit entgegen, in sein Schicksal.« Ein fatales Schicksal: Friedrich Benjamin wird in der Schweiz von Nazis entführt und nach Deutschland verschleppt, wo er in einem Konzentrationslager landet.
In der Wirklichkeit dagegen ergeben sich hoffnungsvolle Möglichkeiten. Fritz Landshoff durchschreitet die Bahnhofshalle der Centraal Station – wir unterstellen ihm, dass er keine Muße hat, den imposanten roten Backsteinbau näher zu betrachten – und hat nun die Wahl. Er kann in die Tram steigen, zum Spui fahren, dem quirligen kleinen Platz im Süden der Innenstadt, und die letzten Meter zum Verlaghaus an der Keizersgracht laufen. Oder er geht den ganzen Weg zu Fuß, nutzt die Chance, nach der langen nächtlichen Reise die Glieder zu strecken und sich der erwachenden Stadt hinzugeben. Weit ist es nicht, fünfzehn Minuten, höchstens zwanzig, wenn man sich Zeit lässt. Verglichen mit Berlin ist in dieser Stadt gar nichts weit, das wird Landshoff schnell merken. Auch dass die Luft hier anders ist, feuchter und kühler, besonders im April. Es lässt sich freier atmen, im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Nehmen wir also an, Fritz Landshoff entscheidet sich zu laufen, dann geht er zunächst den Damrak hinunter. Heute eine Meile mit Geschäften, die Touristen zum Verzehr von Burgern, Dönern und Patat – Pommes frites – oder zum Kauf von Amsterdam-Mützen und Schoko-Penissen überreden wollen, ist der Damrak in den 1930er Jahren noch der »rote Teppich« zur Stadt, mit teuren Hotels, Geschäften und der Amsterdamer Börse.
Doch Fritz Landshoff nimmt von all dem keine Notiz, denn Querido wartet. Beherzten Schrittes geht er weiter, über den Dam, ignoriert Het Paleis, den Palast, der einst als Rathaus gebaut wurde und nun vom Königshaus für repräsentative Zwecke genutzt wird, ebenso wie das Warenhaus Bijenkorf, das erste Haus am Platz für die wohlhabenden Bürger der Stadt. Lassen wir Fritz Landshoff nun rechts abbiegen, dann kommt er zur Singel, dem inneren und kürzesten Kanal im Halbrund des Grachtengürtels, der sich um den ältesten Teil der Stadt legt. Von der Singel über die Herengracht hinaus stadtauswärts und dann nach links sind es nur noch ein paar hundert Meter, auf denen Amsterdam allerdings seine ganze Postkartenschönheit entfaltet. In den Grachten spiegeln sich die prächtigen Bürgerhäuser mit ihren Giebeln und großen Fenstern, die Einblick gewähren in wohldekorierte Wohn- und Arbeitszimmer. Über das Wasser gleiten Boote. Auf den Straßen und über die steilen Brücken radeln die Leute zu ihren Werkstätten und Büros, so souverän und schnell, dass man als Fußgänger besser gleich Platz macht. Fritz Landshoff muss Amsterdam sehr aufgeräumt und übersichtlich vorkommen, fast idyllisch, und mit ein bisschen Phantasie kann man es sich heute noch gut vorstellen, denn die Kulisse ist immer noch dieselbe, nur die Autos sollte man sich wegdenken, die vielen Touristen, Reklame- und Straßenschilder. Doch nun steht unser Mann endlich vor der Keizersgracht 333. Die Glocken der nahen Westerkerk schlagen zehn Mal. Fritz Landshoff ist pünktlich.
2
Keizersgracht 333:
Der Ermöglicher

Das ehemalige Verlagshaus in der Keizersgracht 333
Im Vergleich mit anderen Grachtenhäusern in Amsterdam ist dieses hier ein eher unscheinbarer Bau, vier Etagen graubrauner Backstein, kein verspielter Giebel, kein Hinweis auf die Erbauer in Form eines Schiffs, eines Fischs oder eines Ährenkranzes über dem Eingang. Die mannshohen Fenster im Hochparterre geben den Blick frei auf einen tiefen Raum, in dessen Mitte ein großer Esstisch steht, darauf ein paar Zeitschriften, eine Sonnenbrille, ein Kaffeebecher, ein Strauß langstieliger weißer Rosen im Endstadium. Es ist ein privates Stillleben, und obwohl kein Mensch zu sehen ist, fühle ich mich ertappt und flüchte die Treppenstufen zurück auf die Straße. Denn eigentlich wollte ich nur bestätigt finden, was ich längst schon wusste: Bücher werden hier nicht mehr gemacht. Doch die Adresse ist so legendär, dass Fritz Landshoff sogar seine Memoiren nach ihr benennt: Amsterdam, Keizersgracht 333.
Im April 1933 wird der junge Verleger aus Berlin hier von dem Menschen erwartet, in dessen Auftrag Nico Rost ihn am Vortag aufgesucht hatte, von Emanuel Querido. Doch Querido empfängt ihn nicht allein, neben ihm steht Alice van Nahuys, seine engste Mitarbeiterin. Deren Kompetenzen gehen weit über die einer persönlichen Assistentin, Sekretärin oder Lektorin hinaus, weshalb ihr offizieller Titel auch directrice lautet, Direktorin. Überhaupt ist sie eine eindrucksvolle Erscheinung, wie Fritz Landshoff sich erinnert: »Sie war groß, elegant, gutaussehend, energisch, sehr belesen und beherrschte vier Sprachen fließend (Holländisch, Französisch, Englisch und Deutsch). Da Querido kaum fremde Sprachen verstand und sie gar nicht sprach, war seine ungefähr dreißig Jahre jüngere Mitarbeiterin unser Dolmetscher. Sie war unserer geplanten Verlagsgründung offenbar sehr geneigt.« Kein Wunder, schließlich verspricht ein neuer Verlag auch ihr neue Möglichkeiten, neue Begegnungen und frischen Wind in der täglichen Arbeit. Ganz so jung, wie Landshoff sie einschätzt, ist sie allerdings doch nicht mehr. Mit 39 Jahren ist sie sieben Jahre älter als Fritz Landshoff und 23 Jahre jünger als Emanuel Querido, der ihr seit der Gründung des niederländischen Verlages 1915 über die Jahre immer mehr Verantwortung übertragen hat.
Dennoch darf man sich nicht täuschen lassen, wenn Querido neben seiner directrice fast ein wenig unscheinbar wirkt. Am Ende wird er das letzte Wort behalten. Bis dahin überlässt er ihr jedoch gern die Konversation, denn, wie gesagt, Fremdsprachen sind seine Sache nicht. Auch »groß, elegant und gutaussehend« sind übrigens keine Attribute, die auf ihn zutreffen. Arie, Emanuel Queridos einziger Sohn, beschrieb das Äußere seines Vaters einmal so: »Sein Haar war dunkelblond, seine Augen hellblau und von einer außergewöhnlichen Klarheit; sein Gesicht war rund und hatte etwas Sanftes, beinahe Weibliches an sich, das durch sein weiches Haar noch unterstrichen wurde und dem auch sein kurzer Schnurrbart nur wenig Männliches hinzufügen konnte. Seine Erscheinung war stets sehr akkurat; er machte immer einen ›sauberen‹ Eindruck, stolz war er vor allem auf seine Hände, die sehr klein, aber muskulös waren, breit und kräftig, und die er immer sorgfältig pflegte. In seiner Kleidung kam die merkwürdige wankelmütige – oder ambivalente – Haltung zum Ausdruck, die er damals – und eigentlich sein ganzes Leben – einnahm.«
Читать дальше