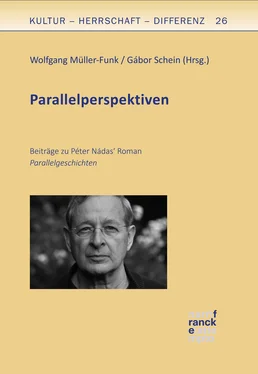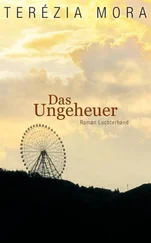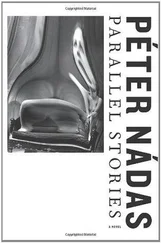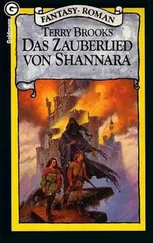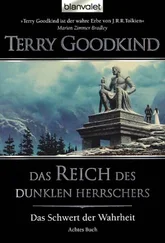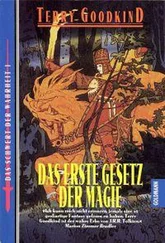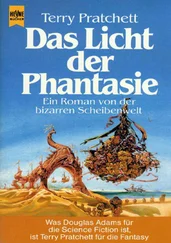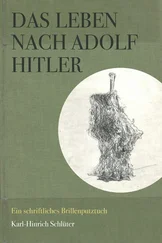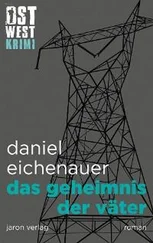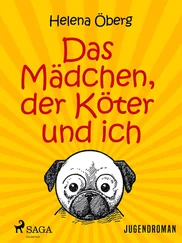Mit dem unauffälligen Haus an der Ringstraße, in dessen zweitem Stock der Architekt selbst eine Wohnung hatte, zog Samu Demén keine weiteren Bauaufträge an Land. Seine Ideen erwiesen sich als unvereinbar mit dem Zeitgeist.18 Der andere Architekt in den Parallelgeschichten ist Alajos Madzar, ein Schüler von Ludwig Mies van der Rohe, welcher im August 1930 die Leitung des Bauhauses in Dessau übernahm. Der von vielen Lehrlingen wie auch Kollegen mit ziemlicher Ablehnung empfangene neue Direktor wurde für einen Formalisten und Elitären gehalten, weil er schon damals angeblich keine billigen Volkshäuser plante, sondern eher Familienhäuser und Villen für reiche Kunden baute.19 Die Lage war tatsächlich viel komplizierter. Mies van der Rohe, der 1926 ein eindrucksvolles Denkmal für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht errichtet hatte, das dann von den Nazis abgerissen wurde, hatte zwei Jahre später die Aufgabe übernommen, mit einem aus sehr teuren Materialien aufgebauten Objekt an der Internationalen Ausstellung in Barcelona das „Weimarer Deutschland“ zu repräsentieren. Die innere Struktur dieses Gebäudes in Barcelona hat Mies van der Rohe zur selben Zeit auch in Brünn für ein bürgerliches Haus, das sogenannte Tugendhat-Haus, angewandt, wo er von der Strukturierung der inneren Räume bis zu den letzten Details der Möbelstücke eine suggestive Harmonie und Integrität mit höchster Materialqualität entworfen hat. Walter Gropius meinte dazu ironisch, dass das Tugendhat-Haus in Wirklichkeit ein „Sonntagshaus“ sei.20
Obwohl Mies van der Rohe seine Ideen später in Richtung einer umweltfreundlichen Architektur (Gericke-Haus, 1930; Hubbe-Haus, 1935) bzw. einer industriellen Massenarchitektur (Illinois Institute of Technoogy, 1939–1958) weiterbildete, blieb Alajos Madzar, der jüngere Architekt der Parallelgeschichten , bei einer funktionellen Exklusivität. Es fehlte bei ihm an jeglichen emanzipatorischen Ideen. Die innere Architektur, die den bürgerlichen Idealen von Madzar entspricht, muss davon ausgehen, dass diese funktionelle Exklusivität sogar noch in der wohlhabendsten Gegend auf der Pester Seite eine Weltfremdheit vertritt, die während der Therapie sowohl die Patienten als auch die Therapeutin aus den Gefügen der sozialgeschichtlichen Umgebung heraushebt. Auf die Baupläne in der zierlichen Pozsonyi-Straße, in der Frau Szemző der Arbeit in ihrer analytischen Praxis nachgeht, üben die vernünftig-funktionalen Bauhaus-Gesichtspunkte ohnehin schon eine eher formelle Wirkung aus. Es wird im Roman vom Erzähler gründlich erklärt, dass auch für das Gebäude, in dem Frau Szemző in dem sechsten Stock ihre Wohnung hatte, gar nicht „die an sich bescheidenen individuellen Bedürfnisse den Maßstab für die inneren Proporzionen […] geliefert hatten, […] sondern die Gewinnsucht anspruchsloser, kleinlicher Architekten und Ausstatter“.21 Als reichte nicht allein schon diese Erklärung der Weltfremdheit von Madzars Bauplänen aus, kann man auf derselben Seite eine längere theoretische Passage über das sich „unter den schweren Ruinen seines Zusammenbruchs windende, selbsterfüllt feudale Ungarn“ und seine verantwortungslose, gescheiterte Aristokratie lesen.
Alajos Madzar entdeckt in der Wohnung eine Menge von funktionalen Fehlern und sein Anliegen ist es, diese mit kleinen Kunstgriffen möglichst zu korrigieren. Seine bescheidene Auffassung seiner Arbeit stimmt mit den analytischen Idealen von Frau Szemző völlig überein. Ihre Gedanken werden im Roman durch den Wortschatz von Alajos Madzar wiedergegeben und damit entsteht eine Achse nicht nur zwischen den beiden Geistesverwandten22, sondern auch zwischen der Architektur und der Psychoanalyse, die im erzählerischen Duktus maßgebliche Perspektiven zur Therapie der geschichtlich-psychischen Beschaffenheit der menschlichen Natur vertreten:
Frau Szemző hingegen sah ihre Arbeit so, dass sie zwar die historischen Gegebenheiten nicht verändern konnte, aber zuweilen ein Kunstgriff genügte, die inneren Funktionsvoraussetzungen zu ändern, und dass solche Veränderungen dann stark auf die Umgebung zurückwirkten, zumindest im Prinzip.23
Im Hintergrund des architektonischen Selbstverständnisses von Madzar steckt aber auch ein anderes Problem, nämlich der unauflösbare Konflikt zwischen Technik und Handwerkertum, oder anders ausgedrückt, die historisch schwerbeladene Gegenseitigkeit von Psyche und Techne, die auf vielen Ebenen ein theoretisches und praktisches, zu schweren Entscheidungen führendes Kernproblem des Bauhauses war. Das Thema wird auch in der Essayistik von Péter Nádas oft diskutiert. Madzar besteht eindeutig auf dem Handwerklichen, der eigenen Verantwortung und letzten Endes auf der Psyche, die imstande sei, der Technik einen Rahmen vorzugeben:
Die meisten Gebäude in der Neuleopoldstadt hatten etwas Improvisation an sich, wie ein Echo der Baracken des Ersten Weltkriegs. Es fehlte die elementare Freude des individuellen, einfühlsamen Handwerks. Als sagte in einer Symbolsprache fast jedes Gebäudeteil, ja, es ist Friede, hinter uns liegt der verlorene Krieg, aber das Gewerbe hat sich noch nicht erholt, seine Modernisierung ist unterblieben, und so wird eben minderwertige Ware produziert.24
Die Einstellung der Analytikerin und des Architekten, die sogar kleine Korrekturen der historischen Voraussetzungen in Aussicht stellen, geht deutlich darüber hinaus, was Erna Lehr als die eigentliche Aufgabe bürgerlicher Bildung würdigt. Sie denkt an seinen Großvater, den Errichter des Hauses an der Einmündung der Großen Ringstraße und ein grausames Monster, und meint, die gutbürgerliche Erziehung bestünde darin, „alle Umstände und Situationen zu durchschauen, zu verstehen, zu akzeptieren und mit dem Wissen gewappnet dem Chaos zu widerstehen“25. Gemäßigter therapeutischer Optimismus und der Geist der Stoa würden hier durch die beiden Frauenfiguren aufeinander prallen, wenn sie in einer Szene zusammengebracht werden könnten.
Trotz des Unterschieds zwischen den beiden Auffassungen bedeutet „das Bürgerliche“ im Diskurs des Romans keinen sozialen Zustand und es ist auch nicht mit dem mittelständischen vornehmen Lebensstil und Lebensverständnis zu verwechseln. Das Lebensverständnis des vornehmen Mittelstandes zeichnete sich nach Gyula Kornis, einem der führenden ungarischen Soziologen vor dem zweiten Weltkrieg, durch einen bestimmten Grad der Bildung („man muss mindestens vier Klassen in der Mittelstufe absolvieren“) und die Kohärenz der traditionsbewussten, nationalistischen Weltanschauung aus, die das jüdische Element ebenso sehr ausschließt, wie sie auch dem deutschen Einfluss widersteht.26 Diese Auffassung wird im Roman von dem älteren Bellardi verkörpert, der sich in der gesellschaftlichen Komplexität mit Hilfe seiner auf die Ebene der körperlichen Triebe verschobenen Vorurteile zurechtfindet.
In den Szenen, die am Anfang der 60er-Jahre spielen, gehört auch die Last der verdrängten Erinnerungen zu den historischen Gegebenheiten. Die Häuser gewinnen einen unheimlichen, sogar gespenstischen Charakter. „Es gibt solche Nächte“, kommentiert der Erzähler die Szene, in der Gyöngyvér Mózes merkwürdiger Weise die Stimmen vom Einfall der Pfeilkreuzler ins Haus von Frau Szemző in der Nacht des zweiten Weihnachtstags hören kann, „in denen die Wände der Budapester Miethäuser die einmal in ihnen erstarrten Töne ausstrahlen“.27 Das ist die Nacht, in der die von Alajos Madzar entworfenen Möbelstücke, diese vernünftigen Liebesgeschenke, aus dem Fenster geworfen werden.
Diese Episode nennt Viktória Radics mit Recht „Schicksalsgrimasse“.28 Auch zum Haus, in dem die Klavierlehrerin von Kristóf wohnte, stellt der wiederkehrende Junge fest, dass es einmal ein „Sternhaus“ gewesen ist, d.h. dass hier jüdische Staatsbürger zwangsweise einziehen mussten und dann von hier aus verschleppt wurden. Kristóf wagte es als Kind nie, sich bei den Erwachsenen zu erkundigen, was das Wort „Sternhaus“ bedeutete. Er konnte aus ihrem Ton erahnen, dass dieses Wort zu dem nur knapp überlebten Entsetzen gehören mochte. Und nicht nur die Töne und die Wörter vertuschen etwas, das sowohl die Akzeptierbarkeit des Gegebenen als auch die Möglichkeit der kleinen Korrekturen untergräbt. Auch die gestaltenden Entscheidungen der Romanwelt führen den Leser immer wieder zu Schicksalsgrimassen. Ármin Gottlieb verkauft verlässliche, massive Balken für genau jenen Bahnbau, der auch seine eigene Deportation ermöglichen wird. Mária Szapáry muss mit dem Wrack ihrer wunderbaren Geliebten Jahr um Jahr zusammenleben, bis sie ihr und dann sich selbst mit dem Einverständnis von Frau Szemző am 15. März 1961 das Leben nimmt.
Читать дальше