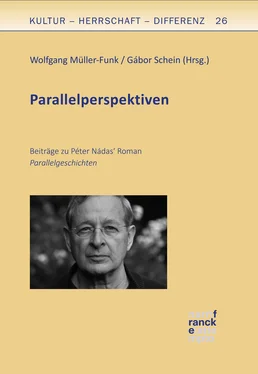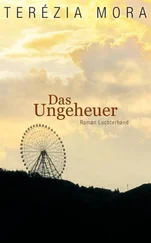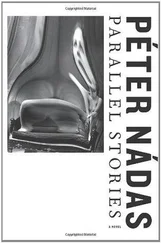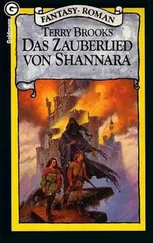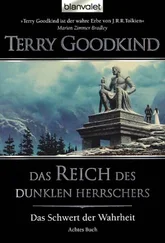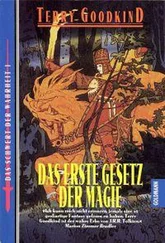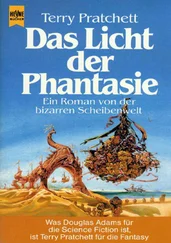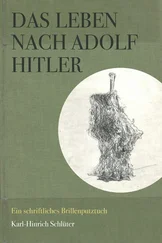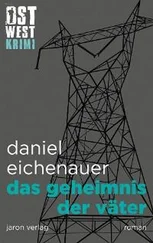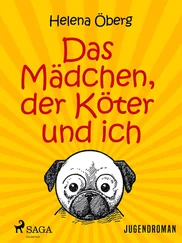Die großen Romane von Péter Nádas, sowohl das Buch der Erinnerungen und die Parallelgeschichten als auch Aufleuchtende Details , spielen in Großstädten – in Budapest und Berlin. Ihre Handlung und die Figuren sind nur im großstädtischen Milieu denkbar. Wenn Autoren Aspekte von real existierenden Städten in ihre Romane implementieren, wenn sie die Karte mit Straßennamen und mit in der Wirklichkeit auffindbaren Gebäuden beleben, gehen sie davon aus, dass die gebauten Elemente der Stadt „ein ganzes Repertoire von Bedeutungen für den Leser innerhalb einer bestimmten Kultur“ signalisieren.4 Eine Großstadt ist für ihre Bewohner und auch für ihre Besucher immer nur als eine gegenseitige, in räumlichen Formen erfahrbare Wirkungsgeschichte von lokal- und welthistorischen Bedeutungen, als Interaktion von Texten und Gebäuden, von alltäglicher Raumbenutzung und Politik wahrnehmbar, die sich nie als ein Ganzes äußert.
Die Komplexität der räumlichen Konfigurationen in den Parallelgeschichten ist also von den historischen Vergesellschaftungsformen des städtischen Raumes, die durch die Projektion sozialgeschichtlicher Prozesse entstehen, nicht unabhängig. Beim Konzept der Raumgebilde geht es Simmel, dessen Ansätze nicht nur für die Raumsoziologie, sondern auch bei der Untersuchung literarischer Raumformen unentbehrlich sind, nicht um die „Wirksamkeit einer besonderen Raumkonfiguration“, sondern umgekehrt, um die „Einwirkung, die die räumlichen Bestimmtheiten einer Gruppe durch ihre eigentlich soziologischen Gestaltungen und Energien erfahren“.5 In das Konzept des gesellschaftlichen Raumes müssen die gesellschaftlichen „Kräfte“ einbezogen werden, die das materiell-physische Substrat dieses Raumes und damit auch die Raumstrukturen „formen“ und „gestalten“.6 Dieses gesellschaftlich „produzierte“ Substrat besteht aus menschlichen, vielfach ortsgebundenen Artefakten, den materiellen Nutzungsstrukturen der gesellschaftlich angeeigneten und kulturell überformten Natur sowie den Menschen in ihrer körperlich-räumlichen Leiblichkeit.7 Die gesellschaftliche Praxis und die materielle Struktur der Raumbenutzung können aber nur unter dem Aspekt der klassenmäßigen, gender- und altersbezogenen Differenzierung und mit der Analyse der jeweiligen Machtverhältnisse betrachtet werden, die vielfach durch lokale Traditionen, geschichtliche Erfahrungen und Identitäten geprägt werden. Zwischen dem materiellen Substrat des gesellschaftlichen Raumes und der gesellschaftlichen Praxis seiner Produktion, Aneignung und Nutzung fungiert nach Dieter Läpple ein Regulationssystem, das „aus Eigentumsformen, Macht- und Kontrollbeziehungen, rechtlichen Regelungen, Planungsrichtlinien und Planungsfestlegungen, sozialen und ästhetischen Normen besteht“. Im Wesentlichen ist dieses System für die Kodifizierung und Regelung des Umgangs mit den raumstrukturierenden Artefakten (z. B. Arbeitsstätten, Behausungen, Verkehrswege, Kommunikationssysteme etc.) verantwortlich.8 Es muss aber auch berücksichtigt werden, dass die einzelnen Figuren immer schon zuvor strukturierte, oft auch mit einem symbolischen Wert ausgestattete Räume betreten.
Die Budapester Szenen der Parallelgeschichten umfassen den Zeitraum zwischen 1938 und 1961. Die Hauptfiguren dieser Szenen leben in ganz bestimmten Teilen der Pester Innenstadt. Aufgrund der raumbezogenen Passagen könnte man leicht die Karte des Romans entwerfen, wie man es im Fall der Dubliner Texte von Joyce gemacht hat. Die Szenen spielen auf der Margareteninsel, in Neu-Leopoldstadt, in der benachbarten Theresienstadt und in der etwas ferner liegenden Aréna-Straße, wo ganz viele Villen stehen.
Die beiden benachbarten Bezirke innerhalb der Ringstraße wurden erst in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aufgebaut. Charakteristische Bauformen sind die das Baugrundstück von drei Seiten umgebenden vierstöckigen Mietshäuser mit Laubengang, in denen zur Mittelklasse und zu den reicheren Schichten der Gesellschaft gehörende Familien lebten. Die Neu-Leopoldstadt ist dabei ein typischer Wohnort des jüdischen Bürgertums. Diese Mietshäuser haben in ihrem Äußeren vieles von der Repräsentativität der prunkvollen Fassaden der früheren, in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts erbauten städtischen Mietspaläste beibehalten. Sie verliehen den inneren Bezirken der Stadt einen einheitlichen historistischen und eklektischen Stil. Die Qualität des Baumaterials wurde während der 20er- und 30er-Jahre schlechter9, aber die Lebensbedingungen auch in den mittelbürgerlichen Wohnungen verbesserten sich durch den Einbau von Badezimmer und Wasser-Toilette.10
In beiden Bezirken lebten überwiegend Händler, Unternehmer und Intellektuelle, unter ihnen viele assimilierte, mehr oder weniger wohlhabende jüdische Familien. Die Beschäftigung einer Bediensteten gehörte zu den gesellschaftlichen Erwartungen an einen bürgerlichen Haushalt. Solche Dienstmädchen lebten in ganz kleinen Zimmern, hinter der Küche. Sie blieben räumlich abgesondert. Sie durften im Haus nur die Hintertreppe und einen kleineren Eingang benutzen, der zur Küche führte. Ihre billige Arbeit sicherte den bürgerlichen Familien ein langfristiges und steuerfreies Einkommen.
So sah etwa die Wohnung der Familie Lehr an der Grenze der Neu-Leopoldstadt und der Theresienstadt folgendermaßen aus: „Aus vier Zimmern der in der zweiten Stock gelegenen Wohnung sah man auf den bleifarben aufleuchtenden und sich wieder verdunkelnden Oktogonplatz hinaus, zwei weitere Zimmer sowie das nur aus der Küche zugängliche Dienstbotenzimmer gingen auf den zu jeder Jahreszeit dämmerigen Innenhof.“11
Obwohl diese Wohnungen viel zugunsten der äußeren Repräsentativität opferten, widmen die territorialisierten Beschreibungen von Péter Nádas den sogenannten „hinteren Regionen“12 besondere Aufmerksamkeit. Dieses Interesse entspricht seiner tiefen Überzeugung, dass das eigentliche Drama eines menschlichen Lebens viel mehr an dem verborgenen Umgang mit den Genitalien und an den Gewohnheiten beim Geschlechtsverkehr ablesbar ist, als an der zur Schau gestellten Soziabilität.13
Der Wohlstand der Pester Bürgerfamilien gab in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre immer mehr nach. Das Vermieten eines Zimmers an einen Untermieter wurde gängige Praxis. Das Zusammenleben der Generationen wurde in den 4-, 5- und 6-Zimmer-Wohnungen immer komplizierter. Die Regelung der Raumbenutzung, die Fremdheitserfahrungen mit der physischen Existenz, die Sicherung der eigenen Grenzen und die Irritationen der inneren Machtverhältnisse übten eine grundlegende Wirkung auf die Prozesse der Individuation aus. C. E. Clark hat anhand von Grundrissen in New York gebauter Häuser gezeigt, dass die Familie, die früher als eine organische Einheit funktionierte, sich zwischen 1840 und 1870 zu einem Zusammenleben von isolierten Figuren wandelte, d.h. zu einer Gemeinschaft, die die Individuation ihrer Mitglieder antrieb.14 Die bürgerlichen Familien in Pest erlangten im Laufe der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts eine ähnliche Gestalt.
Der Roman von Péter Nádas reflektiert in zwei Figuren auf die Probleme der bürgerlichen Architektur in Budapest. Obwohl die beiden Architekten Samu Demén und Alajos Madzar in verschiedenen Zeiten, unter unterschiedlichen sozialgeschichtlichen Umständen lebten, war ihre Einstellung in gleicher Weise kritisch gegenüber Geschmack und Repräsentationsbedürfnis der Baunehmer. Samu Deméns massives und großzügig gebautes Haus an der Einmündung der Großen Ringstraße war mit seiner puritanischen Fassade weniger auffällig als alle anderen Mietshäuser in der Umgebung. Trotz seiner Unausgewogenheit und seinem Eigensinn, mit dem er doch nicht entscheiden konnte, „ob er kämpfen, abseits stehen oder sich im Gegenteil jeder gewöhnlichen, dummen Norm anpassen sollte“, trugen die Gebäude von Samu Demén, der mit allen Schwierigkeiten der ersten Generation der jüdischen Assimilation in einem letzten Endes hoffnungsvollen liberalen Zeitalter tätig war, keine Spur der Radikalität. Er entwickelte andere Ideen davon, wie man in der scheinbar bürgerlichen Umgebung der Stadt bauen sollte, als das damals üblich war. Er nahm die Relationen der inneren und äußeren Bedürfnisse der Bewohner anders wahr als die konkurrierenden Architekten. Die Bequemlichkeit und großzügige Ausgestaltung der hinteren Bereiche15 und der von anderen Architekten für unwichtig gehaltenen Räume, etwa das Vor- und Badezimmer oder die Küche, lagen ihm am Herzen und nur daraus ergibt sich bei ihm die Proportion von Fassade und repräsentativen Räumen.16 Seine architektonischen Ideen enthielten im Sinne von Nádas ein Angebot zur Korrektur der bürgerlichen Entwicklung in Budapest, die nicht imstande war, die Strukturen der Ständegesellschaft und deren Verfestigung im Rahmen des Nationalstaates zu durchbrechen. Sie gab sich mit der äußerlichen Nachahmung der städtischen Prachtbauten der Aristokratie und der Übernahme ihrer gesellschaftlichen Normen zufrieden. Die aus dem Gemeinadel stammende liberale Reformintelligenz, deren Anstrengungen die assimilierten, ungarisch-national eingestellten jüdischen und deutschen Stadtbewohner mit allen Mitteln unterstützten, erwies sich als unfähig, den Kern eines für die Modernisierung des Landes eintretenden und für die Emanzipation der armen und völlig machtlosen Schichten engagierten Bürgertums zu bilden. Im Sinne von István Bibó war das der Grund für die Enge und letztendlich für das Versagen der bürgerlichen Entwicklung in Ungarn im 19. Jahrhundert. Es ist kein Zufall, dass Ágost Lippay-Lehr, der spätere Nachfahre des Architekten auch noch in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts mit der fixen Idee leben konnte, „dass in diesem Land ausschließlich Bedienstete und Gentry lebten, dazwischen niemand.“17
Читать дальше