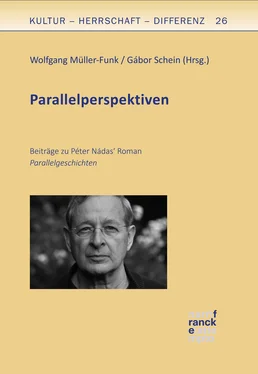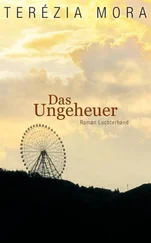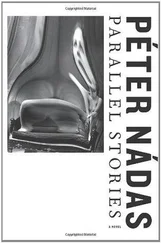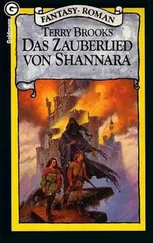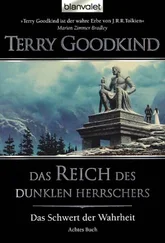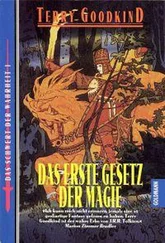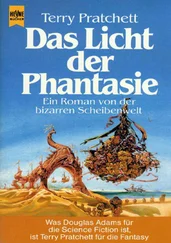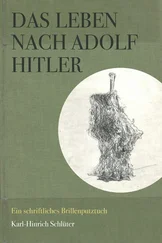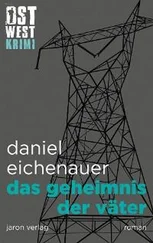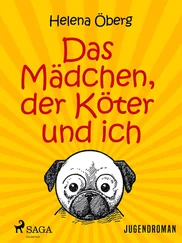Falls wir den Vorschlag, uns auf die Geschichte des Kurzen 20. Jahrhunderts zu konzentrieren, lediglich als romangestalterisches Prinzip ansehen, das die Interpretation des Romans anregen und nicht einschränken soll, lässt sich die Frage stellen: Was sagen Nádas’ Parallelgeschichten über ihre Entstehungszeit 1985–2005 aus? Was waren also die letzten fünf Jahre des ungarischen Staatssozialismus und die ersten fünfzehn der Nachwendezeit bis zum Eintritt Ungarns in die Europäische Union? Es war eine Neuorientierung, oder zumindest ein Versuch der Neuorientierung. Merkwürdigerweise arbeitet sich die Nádas’sche Neuorientierung am Verhältnis Ungarn-Deutschland ab. Alles andere – insbesondere die Sowjetunion – kommt lediglich am Rande vor. Interessant ist auch, dass 1989 zwar als Ausgangspunkt gesetzt wird, es aber doch um die Periode der 1930er- bis 1960er-Jahre geht, wenn Momente aus dieser Periode extensiv entfaltet werden. Alles andere ist Vorgriff und Nachhall. Dieser Vorgriff und dieser Nachhall erklären oder erhellen aber nichts. Sie blitzen irgendwo auf, wohl auch im Gedankenlabyrinth der handelnden Figuren, gehen aber in der Flut der Körperwahrnehmungen und Umweltbeschreibungen gleich wieder unter. Sie stehen als Chiffre für die zeitliche Anfangslosigkeit und Unabgeschlossenheit. Dafür also, dass die Geschichte nicht nur parallel, sondern auch offen ist.
Nádas erlebte 1985–2005 eine Umbruchzeit. Er hatte die Chance, das literarisch zu fassen, wofür er in der Periode des Staatssozialismus – seine Schriftstellerlaufbahn fing nämlich 1965 an – keine Möglichkeiten sah. Er hatte somit die Chance, seine unmittelbare Gegenwart literarisch zu beschreiben: die Wende von 1989 und was ihr vorausging. Doch anstatt dieser 30 Jahre ab 1960, wählte er die 30 Jahre zwischen 1930 und 1960. Dabei würden die ca. dreißig Jahre vor der Wende das erklären, was diese war, wohingegen die Periode 1930–1960 nicht „1989“, sondern die Zeit 1960–1990 erklärt. Offenbar geht es Nádas um die Generationen, und Generationen werden üblicherweise mit dreißig Jahren gemessen. All das sagt aber: Nádas gibt auf die Frage des Romans keine direkte, sondern eine indirekte Antwort.
Zentrale gestalterische Momente von Nádas sind erstens das zeitliche Zurückgreifen und zweitens die Konzentration auf Ungarn-Deutschland. Beides fordert den Leser heraus, lenkt von direkten Zusammenhängen ab und hebt die Problematik ins Allgemeine. Das ist die eine Seite. Andererseits aber: Einmal wird die direkte Vergangenheit ausgeblendet und eine indirekte und vergangene eingeblendet, noch dazu, indem diese in einer Überfülle von körperlichen oder topographischen Details aufgelöst wird. Das andere Mal wird mit der Betonung Deutschlands das Eigene abgeschwächt. Die Frage von 1989 muss sich aber jedes Land und jedes Individuum selbst stellen. So lautete eine der Fragen im Jahr 2005: Was heißt es, dass Ungarn der EU beitritt? Welche Geschichte endet damit? Wann erfolgte die Trennung des Kontinents, die mit der EU-Osterweiterung beendet werden sollte? Wie wir wissen, war dieser Beitritt begleitet von einer Nichtbereitschaft, für das Eigene einzustehen, mit einer Beschwörung des Ahistorischen in der Maske des Historischen.
Das Problem der ungarischen Literatur zwischen 1947 und 1989 und auch seither, falls man nämlich diese Periode aufarbeitet, ist ihr Umgang mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Musste es so sein, wie es war? Viel zu viele waren im Trüben fischende Trittbettfahrer des Staatssozialismus, sie dünkten sich kritisch, waren aber mit ihm verwachsen. War das nun Determination? Wenn man die kleinen Dinge, die einzelnen Determinationsreihen betrachtet: unbedingt. Wenn man sich aber nicht den Geschichten, sondern der Geschichte stellt, dann: nein. Die Grundprinzipien des Systems waren jedem bekannt, dafür hat dieses ohne Mühen und Mittel zu scheuen gesorgt. Je stärker man im System als Schriftsteller im Kulturbetrieb integriert war, desto genauer wusste man, was vor sich geht. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, wie man damit als Literat umgehen soll. Ausweichen kann man ihr nicht, ist sie doch die zentrale Frage. Beantworten kann man sie auch nicht, weil man dann auch vor 1989 die Antwort hätte geben können.
Péter Nádas kommt das große Verdienst zu, diese Problematik, die eine der zentralen unserer Region und unserer Gegenwart ist, angenommen und daraus einen großen Roman gemacht zu haben.
Ein gescheitertes Schiff?
Geschichtliche Kontexte der bürgerlichen Kultur in den Parallelgeschichten
Gábor Schein
Péter Nádas nannte sich in einem Interview, das er nach dem Erscheinen seines Memoirenromans Aufleuchtende Details gegeben hatte, die „bürgerliche Version der ungarischen Literatur“.1 Bürger und Bürgertum sind vieldiskutierte Begriffe des ungarischen historischen Bewusstseins und des erinnerungspolitischen Diskurses. Das Wort „polgár“ stammt im Ungarischen vom deutschen „Bürger“ und seine Bedeutung blieb in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch sehr nah an der Bedeutung des deutschen Wortes. Der „Bürger“ ist keine Klassenkategorie.2 Bürgerliche Berufsgruppen, wie Unternehmer, Intellektuelle und Beamte, lassen sich zwar klar unterscheiden, doch eine quantitative Beschreibung des gesellschaftlichen Phänomens „Bürger“ wäre dennoch nicht ausreichend. Die Definierbarkeit des „Bürgers“ bezieht sich in den deutschen und in den ost-mitteleuropäischen Gesellschaften vor dem Zweiten Weltkrieg nicht auf die gesellschaftliche Aktivität der Einzelfiguren, die in den verschiedenen Bereichen der politischen und kulturellen Öffentlichkeit ihre Wirkung ausübt. Sie bezieht sich vielmehr – und vor allem – auf Wohlstand, auf Privateigentum, auf eine bestimmte materielle Qualität des städtischen Lebens, die dem äußeren Rahmen der Individuation und des familiären Gefüges ziemlich große Standhaftigkeit verleiht, und sie bezieht sich nicht zuletzt auch auf eine Mentalität, in der auch die Loyalität gegenüber dem Staat und der Nation ganz wichtige Merkmale sind. Quantitative Charakteristika gehen also in qualitativen Bestimmtheiten der Mentalität auf.
Seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts trat in der ungarischen Geschichtswissenschaft die Erforschung der Vergangenheit von einzelnen Städten und ihres Bürgertums mehr und mehr in den Vordergrund. Die marxistische Theorie widmete der Geschichte der Städte früher nur wenig Aufmerksamkeit. Deshalb konnte sich eine soziologisch, später auch eine anthropologisch gefärbte Geschichtsschreibung zu diesen Themen relativ frei entwickeln.3 Es sind in den letzten 40 Jahren viele Städtebibliografien und mikrogeschichtliche Erzählungen entstanden. Es fehlen aber sowohl grundsätzliche analytische Forschungen, die die Ergebnisse dieser Fallstudien kontextualisieren, als auch Beschreibungen bürgerlicher Institutionen und deren konkreter Handlungsfelder in den größeren und kleineren Städten. Wir wissen auch sehr wenig über bestimmte bürgerliche Großgruppen bzw. über deren unterschiedliche Strategien zur Bewältigung von Krisen und über die Ausdifferenzierung unterschiedlicher Lebens-Milieus.
Im Vergleich zu den deutschen und den tschechischen Regionen Mitteleuropas war das ungarische Bürgertum zahlenmäßig viel kleiner. Es lebte im Land eher innerhalb von inselhaft verstreuten, sehr engen städtischen Räumen und die Repräsentanz von deutschen und jüdischen Familien, die sich zwischen 1867 und 1930 weitgehend magyarisiert hatten, war in ihnen sehr groß. Nach 1948 vollzog sich im Sinne der Ziele der Kommunistischen Partei eine weitgehende Angleichung der Wohnsituationen und eine Egalisierung und Verwischung von Schichtenstrukturen. Bürgerliche Ideale, die Sehnsucht nach Komfort, privater Häuslichkeit und Konsummöglichkeiten waren plötzlich Erscheinungsformen einer reaktionären Haltung. Haben wir aber eine längere Zeitphase vor Augen und verlängerte man die Problematik der bürgerlichen Ideale bis ins Heute, könnten wir nicht nur mit ihrer geschichtlichen Auflösung, sondern auch mit einer Standhaftigkeit und Kontinuität in der Dimension der familiären Modelle rechnen.
Читать дальше