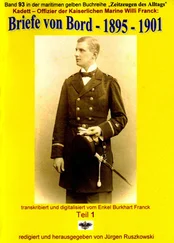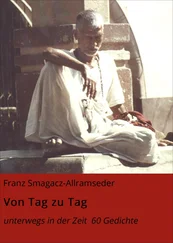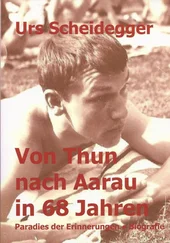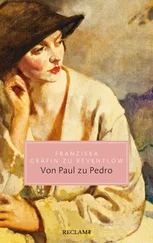Aber ich habe nicht nur das Haus als unser Haus bezeichnet, ich habe auch die Schreinerei im Hinterhof, in der Vater arbeitete, immer als unsere Schreinerei, die Straße, in der wir lebten, als unsere Straße und das Wohngebiet in Wilmersdorf als unser Viertel bezeichnet. Das war meine Welt, zu der auch mein Schulweg gehörte, der durch unseren Bezirk mit seinen prächtigen Kastanienbäumen und den gepflegten Mehrfamilienhäusern auf beiden Seiten der Straßen führte, vorbei an Frau Schönewecks Bäckerei, dem Gemüsegeschäft an der Ecke und der zerstörten Synagoge in der Prinzregentenstraße, die mit ihrem einst runden, überkuppelten Zentralbau eines der auffälligsten Gebäude in unserem Stadtteil gewesen war. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatte sie gebrannt, wie die Synagoge in der Franzensbader Straße und der jüdische Friedenstempel in der Markgraf-Albrecht-Straße auch. Ihre Überreste waren nicht beseitigt worden, die Fragmente der Grundmauern standen noch da wie ein drohender Fingerzeig, eine dunkle Prophezeiung, dass die inzwischen zum Alltag gehörenden Übergriffe auf Juden noch lange nicht enden sollten. An jedem Morgen, an dem ich die Ruine passierte, machte mich ihr Anblick traurig; sie verursachte eine seltsame Melancholie in mir, als spürte ich das Unrecht ihrer Zerstörung, das in den vom Brand geschwärzten Steinen einen stillen Ausdruck fand. Stets erinnerte ich mich daran, wie die Flammen aus dem Gebäude geschlagen waren und graue Rauchschwaden den Nachthimmel vernebelt hatten. Dann tat ich mich schwer, den Weg zur Schule fortzusetzen und mich nicht in meinen Gedanken zu verlieren. Ich versuchte, mir vorzustellen, was die Juden angesichts ihres zerstörten Bethauses fühlen mochten.
In Wilmersdorf lebten viele von ihnen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es damals hieß, unser Stadtteil habe den höchsten jüdischen Bevölkerungsanteil aller Berliner Bezirke. Es gab einen jüdischen Sportplatz in der Nähe des Bahnhofs Grunewald und einige jüdische Privatschulen, die jedoch wegen Überfüllung nicht alle Anmeldungen berücksichtigen konnten, weshalb auch in unserer Klasse ein jüdischer Junge saß.
Als David eines Tages nicht mehr zum Unterricht erschien, fragten wir unsere Lehrerin mit gebotener Zurückhaltung, warum er nicht mehr komme. Frau Friedrich antwortete, dass es jüdischen Kindern nun endlich nicht mehr erlaubt sei, die öffentlichen Schulen zu besuchen. Sie beugte sich verschwörerisch nach vorne. Der Jude sei von Beginn an unser geschichtlicher Feind gewesen, körperlich und geistig von Eigenschaften bestimmt, die uns völlig fremd seien. Die Trennung wäre ein weiterer und bedeutsamer Schritt, um die jüdische Rasse in letzter Konsequenz aus unserem Volkskörper auszuscheiden. Wie Kot, fügte sie grinsend hinzu. Das war im selben Jahr, in dem die Synagogen brannten, als das Leben Juden zunehmend schwieriger wurde und man immer mehr von ihnen zur polnischen Grenze brachte.
Ich begriff nicht, was sie angestellt haben sollten, dass wir sie derart verabscheuen mussten. Auch hatte ich bei David keine fremden Eigenschaften erkannt, er hatte einen völlig normalen Eindruck gemacht. Dennoch stellte ich Frau Friedrich keine weiteren Fragen, sondern schwieg, wie alle anderen auch.
»Ich hasse sie nicht, und du musst sie auch nicht hassen, aber du darfst niemandem erzählen oder durch Taten zeigen, dass wir sie nicht hassen«, erklärte Mutter mir, als ich sie einmal fragte, ob sie die Juden hasse und ob auch ich die Juden hassen müsse.
Mehr brauchte ich nicht zu wissen, um Erleichterung zu empfinden, weil ich nicht fähig war, David gering zu schätzen oder gar zu verabscheuen. Ich sah in ihm einen netten, wenn auch wortkargen Burschen, der sich von Anfang an alle Mühe gab, unsichtbar zu sein. Doch weil er jüdisch war, war er sichtbar. Von einigen Schülern wurde er gemieden, von anderen getreten und hin und wieder auch geschlagen. Und niemand stand ihm bei, auch ich nicht. Ich gehörte zu denen, die sich bereitwillig den Normen des Viertels und der Schule fügten. Und dazu passte es keinesfalls, sich für einen Juden einzusetzen, auch dann nicht, wenn ihm ein anderer Junge mit einem Messer einen Davidstern in die Brust ritzte.
An jenem Tag, kurz vor Weihnachten im Jahr 1937, war die Luft besonders frostig. Der in der Nacht gefallene Schnee glänzte auf den Bäumen und Dächern, und der undurchlässig graue Himmel versprach noch mehr Niederschlag, worüber ich mich freute. Mir gefiel es, wenn es schneite. Ich war vergnügt, wenn die Straßen aussahen, als wären sie mit Puderzucker bedeckt, meine Schritte frische Abdrücke im Schnee hinterließen und ich Eiszapfen von den Vordächern abbrechen und in den Mund stecken konnte, um die Kälte auf der Zunge zu spüren. Aber die größte Freude bereitete es mir, wenn der Schnee in dicken Flocken fiel und diese leise im Wind gegen die Fenster unseres Klassenzimmers stießen, als würden sie um Einlass bitten. Dann stellte ich mir vor, wie schön es jetzt sein müsse, in einem gemütlichen Raum am Feuer zu sitzen, das in einem Kamin flackerte, und von dort aus zu beobachten, wie die Welt draußen immer weißer wurde, bis das Weiß in den Augen brannte.
Als der Gong das Ende des Unterrichts verkündete, packten wir hastig unsere Schulsachen und eilten aus dem Gebäude, um vor dem schmiedeeisernen Tor der Schule eine Schneeballschlacht zu beginnen. Ein Haufen Schüler, die mit lautstarkem Gejohle einander jagten, sich mit Schneebällen bewarfen, jubelten, wenn sie trafen, und fluchten, wenn sie getroffen wurden. Manche zankten sich, nur um kurz darauf wieder zusammenzustehen und sich zu versöhnen. Die Luft war erfüllt von heiterem Lachen und Geschrei. Aber das Treiben dauerte nicht lange. Unsere Hosen, Jacken und Handschuhe waren bald schon nass. Schnell sehnten wir uns nach Wärme und fingen an, unsere vor Kälte schmerzenden Gesichter zu reiben. Vielleicht war ich nasser als die anderen und sehnte mich noch mehr als die anderen nach Wärme und war deshalb der Erste, der sich verabschiedete. Aber gerade, als ich mich auf den Heimweg machen wollte, sah ich in der Ferne eine Gestalt, die mit hängenden Schultern davonging. Es war David, ohne jeden Zweifel. Er hatte sich der Schneeballschlacht entzogen. Wieder einmal war er bemüht gewesen, jeder Aufmerksamkeit zu entgehen. Er wollte unauffällig verschwinden, doch zwei größere Gestalten verfolgten ihn. Mir wurde flau im Magen, als ich in ihnen die Oberschüler Erwin Kroschke und Franz Ziegler erkannte.
Erwin stammte aus einer wohlhabenden Metzgerfamilie, die etliche Geschäfte in mehreren Berliner Bezirken betrieb und einige Straßen von uns entfernt in einem imposanten Haus inmitten eines gepflegten Parks mit verschlungenen Wegen und einem großen Fischteich lebte. Wenn man den Gerüchten glauben durfte, zählten Erwins Eltern Mitglieder der obersten Parteiführung zu ihrer Kundschaft, und manch einer flüsterte, sie würden sogar die Reichskanzlei in der Wilhelmstraße mit Fleisch beliefern. Außerdem gab es unter den Kindern das Gerücht, dass der Metzgersohn nie ohne sein Schweizer Messer mit Griffschalen aus geschwärztem Eichenholz das Haus verließ. Er trüge es immer in seiner rechten Hosentasche, jederzeit bereit, anderen, vor allem jüngeren Kindern, furchtbare Angst einzujagen, indem er es vor ihnen aufklappte und mit der Klinge wild durch die Luft schnitt, als handelte es sich bei dem Messer um einen Degen. Erwin war zwei Jahre älter als ich, ein unberechenbarer Junge, dem ich möglichst aus dem Weg ging, wenn er durch die Straßen schlenderte, fortwährend auf der Suche nach einer Gelegenheit, seine Stärke und Unerbittlichkeit zu demonstrieren. Manchmal fand er sie, manchmal auch nicht.
An diesem Tag fand er sie. Ich beobachtete, wie er und Franz losliefen, bis sie David, der die Gefahr zu spät erkannt und deshalb auch zu spät zu fliehen begonnen hatte, in Höhe eines Pritschenwagens stellten. Sie blieben vor dem Jungen stehen und bauten sich bedrohlich vor ihm auf. Inzwischen hatten sich mehrere Klassenkameraden zu mir gesellt, und als auch sie begriffen, was sich in einiger Entfernung zutrug, rannten sie in der Erwartung los, dass Erwin ein Opfer gefunden hatte und zumindest heute alle anderen in Ruhe lassen würde. Niemand wollte ein mögliches Spektakel verpassen. Ohne zu überlegen, lief ich mit.
Читать дальше