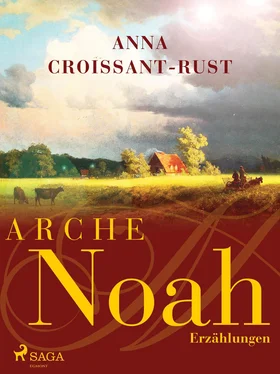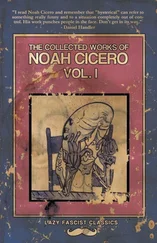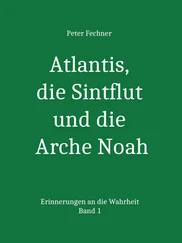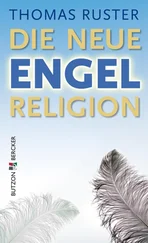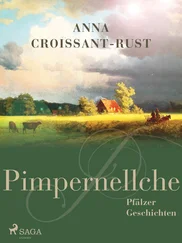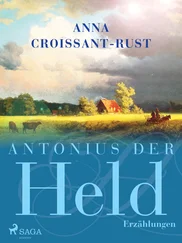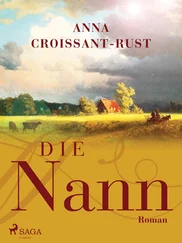„Pink! Pink!“ machen da unten die Maurer. Sie bereiten der Himmelskönigin den Weg, sie weissen und kalken die Wände, sie arbeiten am Tor; das Nönnlein hört sie lachen und schwätzen und singen. Ein paar junge Kerle sind darunter, Italiener, ein halbverwehter Tabakgeruch, eine verwischte Welle von Gelächter und derben Reden kommt herauf. Nun ist alles wieder still, sie sind fort. Sie sind fort und haben das Tor aufgelassen!
Einen Augenblick steht das Nönnlein mit brennroten Wangen, die Hand, eine derbe, breite Bauernhand, auf das rauhe Gewand gedrückt; mit runden, hastigen, bedrückten Kinderaugen sieht sie blitzschnell um sich, nach rechts und links, den langen Gang hinauf und hinunter — und schon fliegt sie über die Stiege, den zweiten Gang, die zweite Stiege, den untern Gang, die breite Treppe, das Tor, die Pforte. — Grosser Gott, sie sind offen! Nun noch der Hof, das äussere Tor, und hinunter, hinunter, fliegt das dunkle Nonnenkleid. Steine poltern unwirsch nach, Geröll schiesst in die Tiefe, das Nönnlein hört nichts; sie hat nur das Sausen und Brausen ihres erregten Blutes im Ohr; sie rennt, dass sie ordentlich dicke, glühende Backen kriegt, ihr ist, als sei die wilde Jagd hinter ihr her, sie wieder einzufangen. Immer schneller wird ihr Lauf, der Schleier weht wie eine Flagge des Aufruhrs hinter ihr drein, fängt sich an einem Rosenstrauch und wird weggezerrt, dass er in Fetzen geht. Die kleine Nonne sieht nicht Weg noch Steg und dennoch fliegt sie in ihrem Taumel sicher vorwärts, über Nebenpfade, die sie nie betreten, überquert Wiesen, um den Weg abzukürzen, findet schmale, schwindelnde Pfade an der Felswand hin.
Abhänge, Felder, Bäume, Gärten, Häuser, Scheunen, Hecken, alles rast an ihr vorbei. Menschen bleiben stehen, rufen, schreien, lachen hinterdrein. Hinunter, immerzu hinunter. Sie schiesst in die engen Gassen, wie ein Schemen drückt sie sich in der Sonne an der Mauer hin, klein, dunkel, verängstigt. Kaum findet sie noch Atem, in vollem Lauf über den Platz zu rennen; da ist schon die Brücke, der Fluss, den sie so oft von oben gesehen, die weisse, staubige Strasse, die im Bogen nach der Bahn zieht, die Schienen, Herrgott die Schienen! Ihr ist’s, als müsse sie in die Knie sinken, gerade da von dem Bahnhof, im Staub der Strasse, und müsse ihn küssen, diesen Staub, und dann fortstürzen über die Schienen weg, geradewegs in den Zug hinein, der Heimat zu!
Da gibt’s ihr einen Ruck, dass sie mitten im Staub der Landstrasse, wie erstarrt, stehen bleibt. Tut sich nicht die Erde vor ihr auf? Es würgt sie in der Kehle und nur ein heiseres, fast bellendes, kurzes Schluchzen kommt heraus. In ihren Ohren ist ein Klingen und Läuten, ein Poltern und Dröhnen, als brause der Zug schon heran; sie steht vor der Freiheit; einen finsteren, feuchten, endlos langen Gang hat sie durchkeucht, nun liegt weit und licht das ganze Land vor ihr. Soll sie wieder umkehren müssen, wieder diesen engen, dunklen Gang zurücktappen, immer weiter, immer weiter? Wie mechanisch streckt sie die leeren Hände aus — sie muss zurück, sie werden sie zurückschleppen, sie hat kein Geld!
Das ganze, kleine, rundliche Nönnlein zittert vom Kopf bis zu den Füssen; einen Augenblick macht sie eine Bewegung, als wolle sie den Weg wirklich nach oben nehmen; dann hebt sie mit einem Ruck das heilige Gewand, wie ein Pfeil ist sie in der Restauration neben dem Bahnhof verschwunden, hat auch gleich mit echtem Bauernspürsinn die Küche gefunden und steht dort, hochrot, von Schweiss überströmt, mit zur Bitte gefalteten Händen vor der Wirtin.
Die Wirtin ist keine Wirtin „wundermild“, keine jener runden, gutmütigen, behäbigen Tiroler Wirtinnen, deren Herz man erweichen kann; lang ist sie und hager, die Knöpfe ihres dunkelgrauen Kleides verschliessen einen strengen und kargen Busen. Sie trägt ein Netz auf dem Kopfe und ein schwarzes Samtband davor, die wenigen Haare sitzen wie numeriert, jede Falte ihrer Schürze sieht nach Eigensinn und Widerstand aus. Das Nönnlein erkennt mit Schrecken an den Runen, in die sie ihr Gesicht legt, dass sie genau weiss, was sie dem Ruf ihres Hauses, das ein „chrischdliches“, und überhaupt, was sie der heiligen katholischen Kirche schuldig ist. Nicht dass sie etwa schimpft oder überrascht tut, dass ihr das Nönnlein ins Haus geweht wurde, bewahre! Sie stemmt nur die knochigen Hände in die Seite, dass die Ellenbogen eckig, wie ornamental zu ihr gestimmte Henkel an beiden Seiten ihres schlanken Leibesgefässes abstehen, und betrachtet die Zitternde von oben bis unten, als hätte sie all ihr Lebtag noch keine Ordens „schwäschder“ gesehen. Dabei entfährt ihrem grossen schmallippigen Munde ein boshaftes, meckerndes Lachen, das der kleinen Schwester Eudoria, die demütig vor der Langen steht, durch Mark und Bein geht. Dann wirft die Lange einen schnellen Blick nach dem Nebenzimmer, das mit einer Glastüre nach dem Gang zu sieht, streckt bedeutungsvoll den Zeigefinger aus — das Nönnlein wird ganz klein, ganzblass und ganz schmal. Oh, das ist nicht mehr die Moidel aus dem Vintschgau, die vorhin das heilige Kleid so fest gepackt und geradewegs in die Wirtschaft hineingeschossen ist, es ist die Schwester Eudoxia aus dem Kloster Ladins. Drinnen sitzen zwei geistliche Herren, ein alter Kurat und ein junger. Nun ist alles verloren! Das Nönnlein knickt zusammen und sinkt auf den Küchenstuhl, die Hände vor dem Gesicht, durch die Finger rinnen langsam die Tränen.
„Gell, jetzt kannscht röhr’n?“ keift leise die Knochige, die noch immer einen Arm kriegerisch eingestemmt hat, und wirft rasche Blicke nach dem Nebenzimmer.
„Mach di’ schnell ausser oder —“
Das „Aussermachen“ ist die einzige Wohltat, die sie dem Nönnlein zu erweisen hat, und die kleine Nonne duckt sich auch gleich gehorsam.
Aber da hat der Alte drinnen das dunkle Schwesternhabit schon gesehen; mit einer sonderbaren fahrigen Hast kommt er herausgetappt, er hinkt ein bisschen und reibt sich die Knie wie einer, der vom langen Hocken steif geworden ist. Ein paarmal wendet er schnell den Kopf zurück, dann heisst er barsch die Wirtin gehen. Sie geht nicht ohne Protest und murmelt noch, als sie die Türe des Nebenzimmers öffnet, aus der die hohe leidenschaftliche Stimme des jungen Kuraten kommt, der mit einem Dritten in einen erregten Disput verwickelt ist.
Still und ergeben, mit gefalteten Händen, wie vor dem jüngsten Gericht, sitzt das Nönnlein vom Kloster Ladins da; sogar auf das Heulen hat die Arme vergessen, nur an der roten, glänzenden Stumpfnase hängt noch ein Tränlein.
„Geld mögschst du?“ fragte der alte Herr hastig und stellt sich so, dass man die kleine Schwester nicht sehen kann. „Kein Geld hascht und fort mögschst? Glei fahrt der Zug daher — da!“
Er drückt ihr etwas in die Hand. Das Moidele schnellt auf, die dunkle Kutte huscht an dem Alten vorbei, mit beiden Händen hält sie das Moidele hoch, dass es besser springen kann. Ein paar derbe Bauernbeine in blauen Strümpfen kommen zum Vorschein; die blauen Strümpfe rennen über die Strasse zum Schalter, vom Schalter nach dem Bahnsteig, heben sich dann in den Zug, der pustend weiter fährt, eine dicke, schwarze Rauchwolke ausstossend, dass man das weisse, stolze Kloster Ladins nicht mehr sehen kann, das hoch über dem Eisack auf schroffem Fels steht und mit vielen blinkenden Fenstern und drei wuchtigen Türmen über das Tal hinschaut.
Vom Pinkepeter und vom Hasepeter
Es waren einmal zwei Strolche, waschechte Strolche, das heisst Menschen ohne Smoking und nach Mass gemachte Hemden, ohne Skarf modernster Farbe, ohne Rohrplattenkoffer, ohne Sinn für Hygiene und Sport, ja Menschen sogar ohne Vorhemd und Kragen — aber ganz ihrem Beruf hingegeben, hervorragende Pflichtmenschen, voll Streben und Ausdauer in allem, was mit ihrem Berufe, dem süssen Nichtstun — dolce far niente — zusammenhing.
Читать дальше