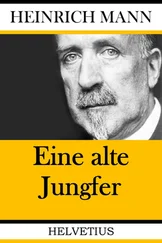»Sobald du dich angezogen hast, hauen wir ab. Mutter findet sonst nur Arbeit für mich, wenn sie mich sieht.« Yann tupft mit einer Papierserviette Marmelade von ihren Mundwinkeln. Ein Brotknust knackt zwischen seinen Zähnen, er spült ihn mit einem Schluck Kaffee aus ihrer Tasse hinunter. »Wenn du ein schlechtes Gewissen kriegst, sage ich ihr, daß du gern beim Servieren helfen würdest.«
»Denkt sie denn nicht, daß ich schuld dran bin, wenn du ihr nicht hilfst?«
Yann läßt sich nach hinten aufs Bett fallen, sein Kopf landet auf Nannas Füßen. Das Porzellan klappert gefährlich.
»Paß auf.« Nanna hebt im letzten Moment das Tablett hoch.
Mit einem Satz ist Yann auf den Beinen, nimmt ihr das Tablett aus den Händen.
»Zieh dir ordentliche Schuhe an. In einer Viertelstunde treffen wir uns unten«, kommandiert er. » Allez! «
Er ist schon aus der Tür, bevor sie etwas erwidern kann.
Yanns Mutter steht über den kleinen Empfangstresen gebeugt, als Nanna die Treppe hinunterläuft. Nanna bekämpft ihren spontanen Wunsch, einfach umzudrehen, sich wieder die Treppe hochzuschleichen und hinter der Tür des Zimmers Schutz zu suchen.
» Bonjour, Madame. «
Das Gesicht, das sich ihr zuwendet, ist verzerrt, wie vom Weinen.
Ohne weiter nachzudenken, geht Nanna einen Schritt auf die andere Frau zu, streckt ihr die Hand entgegen.
» Madame. «
Ein schnelles Kopfschütteln. Die resignierte Haltung verwandelt sich innerhalb einer Sekunde in professionelle Höflichkeit.
»Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen.«
Die Stimme klingt kühl und klar, widerspricht den Tränenspuren auf den blassen Wangen.
Nanna nickt. Die Risse in der Fassade ihrer Schwiegermutter machen sie genauso unsicher wie deren glasharte Ablehnung. Sie schwankt zwischen Bleiben und Gehen. Sorgfältig knöpft sie alle Knöpfe ihrer Wildlederjacke zu. Öffnet sie dann wieder.
»Ich glaube, Yann wartet auf Sie.« Die Schwiegermutter nickt zur Tür hin, tupft ihre Nase mit einem Taschentuch ab, das sie in der Hand versteckt hat.
»Wenn ich etwas tun kann ...«, murmelt Nanna und weiß selbst nicht, was sie damit meinen könnte. Der Gedanke an ihre Person in der Rolle einer Kellnerin oder der an ein vertrauliches, tröstendes Gespräch mit dieser reservierten Frau hinter dem Tresen kommen ihr beide gleich absurd vor.
Die Glaswand ist wieder intakt, das harte Gesicht trocken.
»Was sollte das denn sein?«
Ein ironisches Lächeln. Nanna rafft sich auf, murmelt dem abweisenden Kopf, der sich bereits wieder über die Papiere auf dem Tresen gebeugt hat, einen Abschiedsgruß zu.
Yanns Silhouette zeichnet sich gegen den weißen Himmel ab, er steht von der niedrigen Mauer auf der anderen Seite des kleinen Platzes auf, kommt ihr entgegen.
»Du siehst betrübt aus.«
»Deine Mutter. Ich glaube, sie hat geweint.«
»Kümmere dich nicht darum.«
»Aber solltest du sie nicht lieber trösten? Wenn sie wegen irgend etwas traurig ist?«
»Meine Mutter kann man nicht trösten. Und außerdem würde sie wütend werden, wenn man es versuchen wollte. Nun komm, laß uns gehen.«
Die kleine Stadt liegt sonntagsstill im harten Frühlingslicht. Ein kräftiger Mann in einem weißen Kittel ist dabei, die Markise vor seinem Metzgerladen mit einem quietschenden Geräusch herabzulassen. Yann läßt Nannas Hand los, als der Mann ihn grüßt, die Ladentür steht offen, und Nanna sieht hinter dem Tresen eine Frau mit rundem Kopf stehen, sie reckt den Hals, als die beiden vorbeigehen, kommt anschließend an die Tür. Das Geräusch murmelnder Stimmen verfolgt sie bis um die nächste Ecke.
Sie weiß es bereits. In dieser Stadt wird jeder Schritt, den sie in Yanns Gesellschaft macht, sichtbar sein, als würde sie auf einer Bühne stehen. Sie bekommt unter den neugierigen Blicken eine Gänsehaut. Sie zieht ihren flachen Bauch noch weiter ein, wischt die Feuchtigkeit der Handflächen an ihrem Rock ab, bevor sie wieder Yanns Hand faßt.
Der Strand nördlich der Stadt ist menschenleer, der Sand ist fest unter ihren Füßen. Die Flut hat gewellte Silberstreifen auf dem dunkleren Grund hinterlassen, die Seidenfetzen der grünen Algen glitzern noch feucht in der Sonne. Ein Duft nach Salz und Tang in den ersten Stadien der Verwesung kitzelt Nannas Nase.
Yann legt ihr einen Arm um die Schulter.
»Die Leute glauben, ich wäre verrückt, weil ich das Meer liebe«, sagt er. »Unsere Familie besteht seit mehreren Generationen aus Wirtsleuten, alle anderen hier haben Fischer und Seeleute in der Familie, alle haben einmal jemanden auf dem Meer verloren.« Yann sammelt eine Handvoll kleiner goldener Schneckenhäuser und wirft sie in die Luft, wo der Wind sie mit sich nimmt. »Kurz nachdem wir mit der Realschule angefangen hatten, standen Benoît und seine Mutter eine ganze Nacht lang unten am Hafen und warteten auf das Boot seines Vaters. Ich konnte sie von meinem Fenster aus sehen. Mutter hat mich ins Bett geschickt, sie wollte nicht, daß ich hinunterging. Ich habe die ganze Nacht wach gelegen und dem Sturm gelauscht. Am nächsten Morgen standen sie immer noch da. Der ganze Kai war schwarz vor Menschen, keiner von ihnen sagte ein Wort. All-right hieß das Boot, das war ziemlich pathetisch.«
»Was ist passiert?«
»Benoîts Vater und sein Onkel waren über Bord gespült worden. Sie wurden nie gefunden. Benoîts Mutter hat ihm danach verboten, jemals einen Fuß auf ein Schiffsdeck zu setzen. Jetzt hat er einen Sklavenvertrag, der Staat finanziert ihm eine Lehrerausbildung, dafür muß er vier Jahre hier im Departement arbeiten. Was anderes kann er sich nicht leisten. Aber zumindest kann er in der Hochschule wohnen, so entkommt er seiner Mutter.«
»Ist seine Mutter denn so schrecklich?«
Yann zuckt mit den Schultern.
»Eigentlich nicht«, sagt er. »Aber man kann ja nicht sein ganzes Leben zusammen mit seiner Mutter leben.«
»Und was ist mit dir selbst?«
Die Worte sind ihr einfach aus dem Mund gerutscht, bevor sie noch nachdenken konnte. Yann tritt nach einer leeren Krebsschale, daß sie über den Sand fegt.
»Das ist nicht so einfach.«
Sein Blick sucht nach einem Punkt weit hinten am Horizont, wo ein Leuchtturm seinen dicken Zeigefinger durch einen Riß in der Wolkendecke bohrt.
»Vielleicht sollte ich lieber nicht fragen, aber das steht doch die ganze Zeit zwischen uns.«
Sie bleiben nebeneinander stehen und schauen zum Leuchtturm, wo vereinzelte Möwen ihre Flügel auf dem aufsteigenden Luftstrom ausruhen. Irgendwo hinter ihnen, über der Wiese hinter den flachen Klippen, zwitschern die Frühlingsschwalben.
Yann schüttelt den Kopf.
»Laß uns weitergehen.«
Die Füße sinken in den gröberen Kies ein, und sie gehen lieber zu den flachen braunen Klippen, an denen Girlanden von kleinen Muscheln, kryptische Mitteilungen in blauen Schalen, unter ihren Sohlen zerbrechen.
Zwischen den Dünen führt sie ein schmaler Pfad zu einer Gruppe von Kiefern. Ein Gürtel von schütterem trockenem Gras umgibt einen Kreis aus groben Granitblöcken, ein von Menschenhand geschaffener Kontrast zum Sand der Dünen und dem Strandhafer.
Der Wind vom Meer erreicht sie hier nicht mehr, dennoch hat Nanna das Gefühl, als wäre die Temperatur um ein paar Grade gesunken. Die blaugrünen Nadeln der Bäume neutralisieren das weiße Licht, das Geräusch der leichten Brandung wird von der dumpfen Stille geschluckt, die über den großen Felsen und den windzerzausten Bäumen hängt.
Yann hat sich aufs Gras gesetzt, die Arme um seine angezogenen Beine geschlungen, die Stirn auf die Knie gelegt, ist plötzlich stumm.
Nanna kniet sich neben ihn auf das rauhe Gras, legt ihm eine Hand auf den Arm.
Die Worte purzeln aus ihm heraus.
»Hier war es, hier haben die Deutschen meinen Vater erschossen«, sagt er, und seine Stimme klingt atemlos. »Ich war vier Jahre alt, ich weiß nicht einmal, ob ich mich wirklich noch an ihn erinnern kann oder ob das nur die Bilder in Mémés Album sind.«
Читать дальше