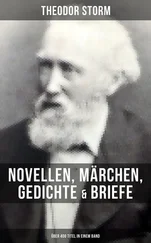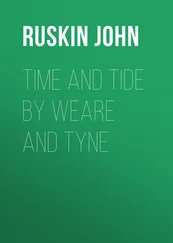Dennoch: Die Zeiten, dass ich in Bielefeld meine Schalke-Liebe verheimlichte, waren endgültig vorbei. Meine kurze Zeit bei Arminia bald ebenso. Gegner Schalke gewann am Ende jener Saison die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Wieder schien eine goldene Generation heranzureifen. Es blieb beim Konjunktiv. Ein Jahr später kratzte die fast noch komplette 72er-Mannschaft ein letztes Mal an der Meisterschale. Es folgte der schleichende Niedergang. Auch der des großartigen Menschen Lütkebohmert.
Aus den Augen verloren habe ich ihn nie. Auch nicht nach dem Ende seiner Profikarriere. Seine unvollendete Geschichte, seine Schicksalsschläge: Das alles birgt Pathos und Mythos in sich. Zwei große Begriffe, die zu Schalke passen. Und ganz besonders zu dieser einmaligen Mannschaft. Lütkebohmerts Geschichte könnte also stellvertretend sein. Für die einer ganzen „verlorenen“ Generation. So viel war mir klar. Es wurde mir noch viel klarer, als ich Anfang 2010 meinen ganzen Mut zusammennahm, um zu seiner Familie Kontakt aufzunehmen. In vielen, oft stundenlangen Gesprächen verfestigte sich mein Eindruck, vervollständigte sich das Bild.
Die Recherche für dieses Buch wurde zu einer aufregenden Reise zurück in meine Jugend. Ich habe dabei alle noch lebenden Spieler der Mannschaft getroffen, den Glanz in ihren Augen gesehen, wenn sie von dieser Zeit erzählen. Ihren Stolz, ein Teil davon gewesen zu sein. Aber auch ihren Schmerz, nicht wenigstens ein einziges Mal die Schale in Händen gehalten zu haben. Bei allen hat die Tragik dieser Geschichte eine spürbare Narbe hinterlassen. Und doch wirkten sie alle irgendwie dankbar, darüber erzählen zu können.
Es sind ihre zahlreichen kleinen Geschichten, Anekdoten und Randnotizen, die mir die an Leid und Liebe reiche Vergangenheit nahegebracht haben. Auf ihnen beruht dieses Buch. Auf persönlichen Erinnerungen und subjektiven Erzählungen. Möglich also, dass nicht jedes wiedergegebene Erlebnis hundertprozentig der tatsächlichen Begebenheit entspricht. Eine ausführliche Auflistung der Geschichten und ihrer „Urheber“ finden Sie in der Danksagung am Ende des Buchs. Dennoch gab es für mich beim Schreiben keine Alternative zur Gegenwartsform, weil sie die Geschehnisse dieser Zeit einfach lebendiger erscheinen lässt. So habe ich beim Hören und Notieren manches wieder und vieles völlig neu erlebt. Ich hoffe und wünsche mir, dass es Ihnen beim Lesen ähnlich ergeht.
Jürgen Thiem, im Winter 2012
Die Diagnose
Da ist er wieder, dieser stechende Schmerz. Aki rappelt sich auf. Der Versuch eines Lächelns. Bloß keine Müdigkeit zeigen. Auch jetzt, mit 44, hat er noch einen Ruf zu verteidigen. Er, den sie Zeit seines Fußballerlebens „Pferdelunge“ genannt haben. Noch immer rennt er allen davon. Hier auf dem Trainingsplatz am Lohrheidestadion, in der Altherrenmannschaft des Wattenscheider Textil-Moguls Klaus Steilmann.
Doch jetzt ist etwas anders als sonst. Das spürt er. Klar, es ist ein harter Zweikampf um den Ball gewesen. Er war wieder mal einen Schritt schneller, der Gegenspieler hat ihn zu Fall gebracht. Alles kein Problem. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Und die Schmerzen in der Hüfte, nichts Neues. Die hat er ja schon über ein Jahr. Ein Hämatom, keine Frage. So etwas kommt selbst bei besten Fußballrentnern vor. Nicht der Rede wert. Und erst recht keinen Arztbesuch. Da hat er schon ganz andere Probleme gelöst. Oder besser, verdrängt.
Diesmal aber fällt es ihm schwer, das Verdrängen. Mit zusammengepressten Lippen quält er sich über die letzten Minuten. Vorzeitig vom Platz gehen, das war noch nie sein Ding. Unter der Dusche vermissen die Mitspieler seine lockeren Sprüche. Erst in der Vereinsgaststätte, beim zweiten Bier, findet er seine Sprache wieder. Die Schmerzen aber bleiben. In der Leiste, in der Hüfte, im Rücken, im Gesäß.
Seine Schwester Luzie, gelernte Krankenschwester, bedrängt ihn, endlich zum Arzt zu gehen. Aki winkt ab: „Das wird schon wieder!“ Drei Monate später, im Urlaub auf Ameland, zwingen ihn die Schmerzen buchstäblich in die Knie. Sein Kreislauf spielt nicht mehr mit. Auch eine Folge der starken Schmerztabletten, die er sich inzwischen wie Halsbonbons einwirft. Es geht nicht mehr anders. Aki muss den Platz, in dem Fall sein geliebtes Eiland, vorzeitig verlassen.
Daheim in Borken veranlasst sein Hausarzt eine Blutuntersuchung. Das Ergebnis ist alarmierend. Noch am selben Tag wird er ins örtliche Marienhospital eingewiesen. Sein Zustand verschlechtert sich stündlich. Eine schwere Lungenentzündung gesellt sich hinzu. In Borken fühlen sich die Ärzte überfordert. Mit Blaulicht wird Aki nach Essen gefahren, in die Uniklinik. Seine Frau Christa hält ihm die Hand, als er, schweißnass im Bett liegend, ins Röntgenzentrum geschoben wird.
Zwei Monate lang hängt er am Tropf, kann keine feste Nahrung zu sich nehmen. Vom einstigen Helden der Nordkurve, dem durchtrainierten Laufwunder und Frauenschwarm, bleibt nur ein schwindender Rest. Dreimal rufen die Ärzte Christa Lütkebohmert in Borken an. Dreimal versuchen sie ihr schonend beizubringen, dass das Ende naht. Sie will es nicht wahrhaben. Nächtelang wacht sie an seinem Bett im Zimmer 205 auf der Station M4. Auf jedes noch so kleine Hoffnungszeichen wartend. Sie redet leise und behutsam auf ihn ein, fordert ihn immer wieder auf, durchzuhalten.
Als sich keine Besserung einstellt, sitzt sie apathisch neben ihm, schaut an ihm vorbei, über ihn hinweg. Sie will bei ihm sein und kann sein Leiden doch nicht mehr mit ansehen. Er habe bisher nur dank seines starken Herzens überlebt, versichern ihr die Fachleute in weißen Kitteln.
Es ist Weihnachten 1992. Und noch keine Zeit zum Sterben. Noch einmal trägt Aki den Sieg davon, noch einmal entscheidet er den Zweikampf für sich. Wenn es auch ein ungleicher ist und der Gegner sich nur vorübergehend geschlagen gibt.
Im Februar 1993 ist Aki stark genug für die Chemotherapie. Auch die setzt ihm mächtig zu. Doch er hat wieder ein Ziel vor Augen, so wie einst bei seinen unzähligen Läufen zuhause in Borken, den Lünsberg rauf und runter, nach dem Training, wenn die anderen längst schon auf der weichen Couch lagen.
Aki will noch einmal nach Hause. Und wer weiß, wenn er dann schon mal raus ist, vielleicht kriegt er die Geschichte ja doch noch in den Griff. So leicht jedenfalls wird er sich auch diesmal nicht besiegen lassen. Es ist ein irrationaler Kampf. Ein Kampf wider besseres Wissen. Ein Kampf, den er nicht gewinnen kann. Er weiß es. Er hat Bücher gewälzt, er hat mit Ärzten gesprochen. Das Urteil war immer das gleiche: ein Todesurteil.
Als es ihm eine Woche nach seiner Einlieferung in Essen erstmals verkündet wird, reagiert er wie immer, wenn es eine schlechte Nachricht zu verarbeiten gilt. Äußerlich gefasst. Mit schwacher, aber ruhiger Stimme schildert er seiner Frau, deren Schwester Marlene und ihrem Mann Jürgen den Befund: Knochenkrebs, Teufelszeug. Als Marlene und Jürgen das Zimmer verlassen haben, zieht er Christa zu sich auf die Bettkante. Sie zittert, schüttelt unentwegt den Kopf. Ihre schönen Augen ertrinken in einem salzigen Meer. Sie hört kaum, was er sagt, vor sich hin stammelt. Es ist mehr ein Selbstgespräch. Allein die Worte sind immer die gleichen: „Das ist die Strafe Gottes für den Mist, den ich gemacht habe!“
Die tragische Geschichte der Mannschaft, die auszog, die Fußballwelt zu erobern, am Ende aber nahezu ungekrönt in ihre Einzelteile zerfällt, beginnt früher. Viel früher. Um genau zu sein, 25 Jahre früher.
Oskar, der Baumeister
Es ist schwül an diesem Abend des 28. Juli 1967. Im Erler Schützenhaus Holz steht die Luft. Draußen sorgt Petrus für die passende Choreografie. Es blitzt und donnert. Auch drinnen rumort es kräftig, bis Oberbürgermeister Scharley zu vorgerückter Stunde ans Mikrofon tritt und einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Einstimmig wird die Wahl des neuen Vorstands vertagt. Zuvor hat die große Mehrheit der knapp 400 Mitglieder Präsident Fritz Szepan ihr Misstrauen bekundet. Unter Tränen hatte sich die Schalker Vereinsikone gegen die Vorwürfe gewehrt. Dies ist der Moment, auf den Günter Siebert so sehnsüchtig gewartet hat. Er springt auf die Bühne, legt seinen Arm um Szepan und ruft der aufgebrachten Menge entgegen: „Pfui, so lasse ich diesen Mann hier nicht behandeln!“
Читать дальше