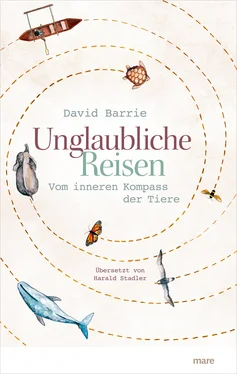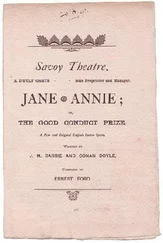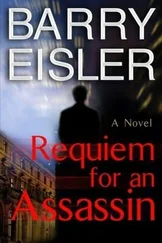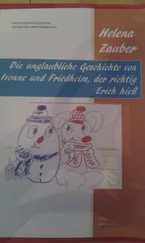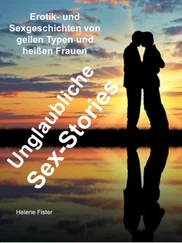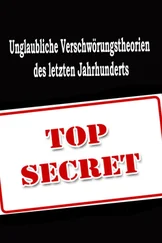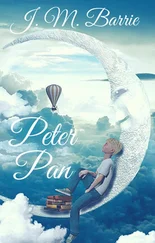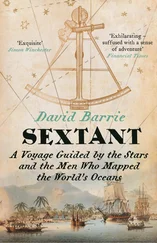Von Frischs Enthüllungen über das Orientierungsvermögen der Honigbiene erregten großes Aufsehen, denn sie schienen darauf hinauszulaufen, dass Insekten – obwohl sie so winzig sind – höchst anpassungsfähig und vielleicht sogar intelligent sind. Für viele Forscher seiner Zeit war das nur schwer zu akzeptieren. Sie waren aus Prinzip davon überzeugt, dass Tiere wie Bienen einfach nicht so hoch entwickelt sein konnten.
Als Problem sah man jedoch die Tatsache, dass von Frisch, genau wie Tinbergen, die meisten seiner Versuche im Freien durchführte, in einem natürlichen Umfeld, das sich nicht so exakt kontrollieren ließ wie ein Laboratorium in geschlossenen Räumen. Den Weißkitteln war es vermutlich schwergefallen, die Thesen eines Mannes ernst zu nehmen, der in Lederhosen über Bergwiesen stiefelte. Vielleicht mischte sich in ihre Skepsis auch ein wenig Neid.
Von Frischs Arbeiten waren jedoch von solcher Sorgfalt und Eleganz, dass sich die meisten Zweifler schon bald überzeugen ließen. Ein führender britischer Verhaltensforscher jener Zeit, William Thorpe (1902–1986), der von Frisch kurz nach dem Krieg besuchte, merkte in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature an: »Dem Zoologen sei in der Tat verziehen, wenn er anfangs Skepsis empfindet – trotz der immensen Ausführlichkeit und Gründlichkeit der Untersuchung.«
Thorpe erwähnte einen Kollegen, der beinahe »leidenschaftlich ungewillt« war, von Frischs Befunde anzuerkennen, deren Folgerungen zugegebenermaßen »sicherlich revolutionär« waren. Thorpe selbst war überzeugt und kam begeistert zu dem Schluss, das Verhalten der Arbeiterbiene zeuge von einer »elementaren Form des Kartierens und Kartenlesens, einer symbolischen Handlung, bei der die Richtung und Bewegung der Schwerkraft 8ein Symbol für die Richtung und den Einfall der Sonnenstrahlen sind«.
Von Frischs revidierte Auslegung des Schwänzeltanzes fand zwar immer mehr Anerkennung und stieß auch weit außerhalb der Zoologie auf Interesse, doch nicht jeder konnte seinen Thesen etwas abgewinnen. Gegen Ende seiner Laufbahn wurden erneut Zweifel in einer besonders beunruhigenden Form laut; im Jahr 1967 veröffentlichten zwei junge amerikanische Forscher die Ergebnisse neuer Versuche mit Honigbienen samt umfangreichen Statistiken, die von Frischs zentrale Erkenntnisse direkt infrage stellten. Es war ein Glück für den alternden Wissenschaftler, dass Studien, die 1970 erschienen, zu den gleichen Ergebnissen kamen wie er und seine Schlussfolgerungen bestätigten. 9
– – – –
Die Küstenseeschwalbe mit ihren pfeilförmigen Flügeln und ihrem geschickten Tauchflug genießt einen ewig währenden Sommer, indem sie zwischen dem hohen Norden und dem tiefen Süden pendelt. Doch bis vor Kurzem war das wahre Ausmaß ihrer saisonalen Wanderungen nicht klar. Im Juni 2011 fingen holländische Wissenschaftler in den Niederlanden sieben Küstenseeschwalben ein und brachten an deren Beinen sogenannte Geolokatoren an, die jeweils ganze 1,5 Gramm wogen. Diese Geräte zeichneten täglich den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs auf. Nachdem fünf der Tiere ein Jahr später wieder eingefangen wurden, konnten die Forscher anhand dieser Informationen die Reisen der Vögel rekonstruieren. Die Küstenseeschwalben hatten sich im Durchschnitt 273 Tage fern von ihren Kolonien in den Niederlanden aufgehalten und 90 000 Kilometer zurückgelegt. Dies zählt (bisher) als der längste je dokumentierte Vogelzug; er übertrifft frühere Schätzungen für dieselbe Spezies um rund 20 000 Kilometer. Bei einer vorherigen Studie hatte man beobachtet, dass Küstenseeschwalben aus Grönland überwiegend im nördlichen und südlichen Atlantik verweilten, wobei sie in einer annähernden Achterkurve hinunter in die Antarktis und wieder zurück flogen. Die Vögel aus den Niederlanden hingegen wanderten zunächst bis zur Südspitze Afrikas und flogen dann quer über das Südmeer fast bis Australien, bevor sie nach Süden zur Antarktis steuerten und schließlich über den Atlantik nach Hause zurückkehrten. Sie bewältigten damit eine viel längere Runde. 10
Bislang kann niemand mit Sicherheit sagen, wie die Küstenseeschwalbe über die riesigen Weiten des offenen Meeres navigiert beziehungsweise wie sie ihre Brutkolonien ausfindig macht.
6. KAPITEL
Koppelnavigation
Heutzutage erscheint es erstaunlich, dass einst so viele Seeleute bereit waren, ihr Leben bei der Überquerung der Ozeane aufs Spiel zu setzen – zu einer Zeit, als die verfügbaren Navigationsgeräte hoffnungslos unzulänglich waren. Sie gingen auf Reisen, die manchmal monatelang dauerten, und hatten keinerlei zuverlässige Hilfsmittel, um die eigene Position zu bestimmen. Da sich Frischkost nicht konservieren ließ und Trinkwasservorräte nur bei Regen aufgefüllt werden konnten, war die Hochseeschifffahrt ein weitaus riskanteres Unterfangen als heute. Navigationsfehler kosteten zahllose Seefahrer das Leben; allerdings fielen mehr Matrosen dem Skorbut, Durst oder Hunger zum Opfer als dem Schiffbruch. Und wie der erschöpfte Streifenwaldsänger deutlich zeigte, sind wir nicht die einzige Spezies, die vor solchen Problemen standen und stehen.
In der ferneren Vergangenheit war die Navigation auf offenen Gewässern ein so großes Wagnis, dass sich die meisten Seefahrer nach Möglichkeit vermutlich an vertraute Routen hielten – was aber gewiss nicht bedeutete, dass sie immer dicht an den Küsten blieben. Solange sie in etwa wussten, wie weit und in welche Richtung sie fahren mussten, und ihre Geschwindigkeit sowie ihren Kurs ungefähr schätzen konnten, durften sie allemal darauf vertrauen, ihr Ziel zu erreichen. Seeleute auf der nördlichen Halbkugel konnten anhand der Höhe des Polarsterns über dem Horizont bequem den Breitengrad feststellen. Und etwa ab dem Jahr 1500 war es dank der sorgfältigen Beobachtungen von Astronomen auch möglich, den Breitengrad zu bestimmen, indem man den Stand der Sonne zur Mittagszeit maß.
Sofern der Breitengrad eines Ziels bekannt war, konnten sich Seefahrer darauf verlassen, es früher oder später zu erreichen; sie mussten einfach entlang dieses Grades segeln. Aber außer Sichtweite von Land war eine genaue Positionsbestimmung aussichtslos, weil sie keine Möglichkeit hatten, ihren Längengrad zu ermitteln. Deshalb ließ sich nie genau sagen, wann sie an ihrem Ziel ankommen würden – eine gefährliche Lage, besonders bei üblem Wetter und schlechter Sicht.
Weil die Längengrade nicht gemessen werden konnten, gab es auch keine genauen Karten. Schätzungen etwa zur Breite des Pazifischen Ozeans schwankten um Tausende Kilometer. So waren beispielsweise die Positionsdaten der Salomoninseln, welche die Spanier Mitte des 16. Jahrhunderts entdeckt hatten, für zweihundert Jahre verloren gegangen. Selbst die Karten für vertraute europäische Gewässer waren häufig sehr ungenau. Das sogenannte Längengradproblem *wurde erst Mitte des 18. Jahrhunderts gelöst, obwohl verschiedene europäische Regierungen in den vorausgegangenen zweihundert Jahren hohe Belohnungen ausgesetzt hatten; und selbst danach dauerte es noch eine ganze Weile, bis die meisten Seeleute Zugang zu der neuen Technologie hatten und diese anzuwenden wussten. 1
Wie also navigierten die Schiffer früher auf hoher See?
Abgesehen von astronomischen Beobachtungen standen ihnen drei einfache Hilfsmittel zur Verfügung: der Magnetkompass (der in Europa wohl ab dem 12. Jahrhundert genutzt wurde), das Handlog und das Handlot.
Der Kompass ermöglichte es natürlich, einen stetigen Kurs zu steuern, doch das war nicht annähernd so einfach, wie es vielleicht klingt; diese Instrumente waren für eine potenziell gefährliche Störung anfällig, die sogenannte Kompassabweichung. Magnetische Eisenobjekte an Bord des Schiffs beeinflussten die Kompassanzeige, und verwirrenderweise variierte der Einfluss, je nachdem, in welche Richtung das Schiff fuhr.
Читать дальше