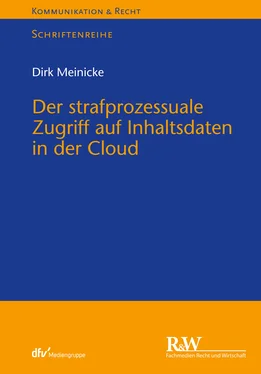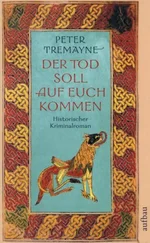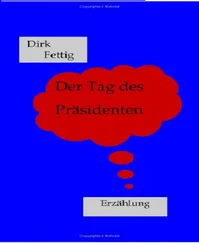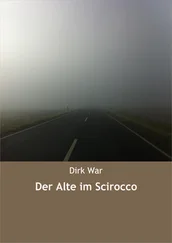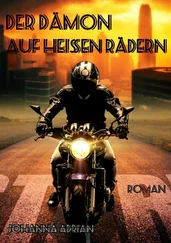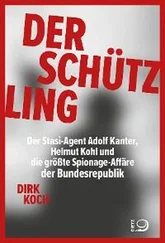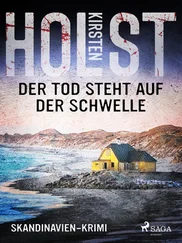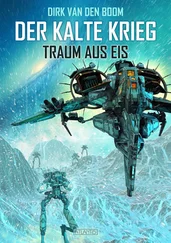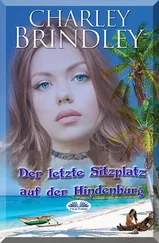Der Parallelbegriff im Bereich der Datenhaltung zum auf physische Ressourcen bezogenen Begriff der Virtualisierung ist das sog. Konzept der Mandantenfähigkeit, der Multi-Tenancy . Dabei wird von physischen Datenbeständen abstrahiert und mit lediglich logisch separierten Einheiten gearbeitet, weshalb nur eine einzige Software-Basis für alle Nutzer zum Einsatz kommt.29
Ein weiteres zentrales Funktionsmerkmal von Cloud Computing-Systemen ist die sog. „rapid Elasticity“ (im Deutschen inzwischen meist als „unverzügliche Elastizität“ übersetzt). Diese hat zur Folge, dass das System extrem flexibel auf wechselnde Belastungen reagieren kann, was für den Nutzer den Eindruck erweckt, er könne über praktisch unbegrenzte Ressourcen verfügen.30 Dieses Phänomen der scheinbaren Unerschöpflichkeit wird auch als „infinite Scalability“ bezeichnet.31 Die Vorteile lassen sich z.B. anhand eines Konzertveranstalters veranschaulichen, der Tickets online anbietet.32 Arbeitet dieser mit einer Cloud Plattform, spielt es keine Rolle, ob gerade Karten für den Auftritt eher unbekannter Bands oder eines internationalen Weltstars im Angebot sind. Selbst wenn es im letztgenannten Fall zu einem plötzlichen und sprunghaften Anstieg der Zugriffe kommt, verhindert die rapid Elasticity, dass die Server „in die Knie gehen“ und die Seite für Nutzer nicht mehr verfügbar ist.
3. On Demand self-service
In engem Zusammenhang mit dem Phänomen der rapid Elasticity steht der sog. „on demand self-service“, was mit „bedarfsorientierter Selbstbedienung“ übersetzt werden kann. Dieses Konzept ermöglicht es dem Nutzer eines Cloud-Dienstes, jederzeit und ohne die Einschaltung von Mitarbeitern des Anbieters praktisch vollautomatisiert („automatic computing“) die erforderliche Menge an Ressourcen anzupassen, wodurch der Anbieter zugleich Personal einspart und so attraktive Preise zur Verfügung stellen kann.33 Zusätzliche Leistungen, z.B. Serverzeit oder Speicherplatz, können vom Nutzer in der Situation einer kurzfristig eintretenden Bedarfserhöhung regelmäßig online gebucht und sodann vom Anbieter meist innerhalb weniger Minuten oder gar Sekunden bereitgestellt werden.34 Diese Automatisierung ist zwingend erforderlich, um die schnelle und flexible Nutzbarkeit der Cloud-Angebote zu realisieren, wodurch deren Attraktivität erheblich gesteigert wird, da Erhöhungen der Leistungsfähigkeit für den Nutzer anderenfalls zumeist mit Installationen oder gar Hardwarezukäufen verbunden sind.35
Die jederzeitige flexible Nutzung von Cloud-Diensten erfordert weiterhin einen umfassenden Netzwerkzugriff („broad network-access“).36 Das besagt im Kern nichts anderes, als dass die angebotenen Leistungen für den Nutzer standardmäßig über das Internet verfügbar sein sollten.37 Dadurch wird insbesondere die dezentrale Nutzung über unterschiedliche Endgeräte gewährleistet, von herkömmlichen Rechnern über Notebooks, Tablets und sogar Smartphones, sofern eine hinreichend große Bandbreite zur Verfügung steht.38
Als fünftes funktionelles Merkmal des Cloud Computing kann die nutzungsbezogene Zahlung angesehen werden, was die Messung des Nutzungsvolumens erfordert, (engl. „measured service“).39 Die Notwendigkeit einer Messung, die je nach Art der genutzten Ressourcen unterschiedlich abläuft, folgt letztlich aus den vier zuvor dargestellten Prinzipien.40 Ein transparentes und einsichtiges Kontrollverfahren dient sowohl den Interessen des Anbieters als auch des Nutzers (vgl. etwa die Internetseite trust.salesforce.com).41
20Vgl. zu den Definitionsschwierigkeiten im Einzelnen Dalby, Grundlagen, S. 149f. 21Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 20; vgl. außerdem den Nachw. zu der – in der Sache ähnlichen, jedoch etwas ausführlicheren – Definition des Branchenverbandes BITKOM bei Schorer, in: Hilber, Handbuch, C/1, Rn. 7. 22Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. ix: „Cloud Computing is using the Internet to access someone else’s software running on someone else’s hardware in someone else’s data center“. 23Nach Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 21 sowie Schorer, in: Hilber, Handbuch, C/1, Rn. 8 m.w.N. 24Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 22. 25Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 18; vgl. zur Virtualisierung in Cloud-Systemen auch Meir-Huber, Cloud Computing, S. 13. 26Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 17; auch Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 15f. 27Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 3f. 28Meir-Huber, Cloud Computing, S. 22. 29Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 22; zur Mandantenfähigkeit auch Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 14. 30Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 14; Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 23. 31Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 23. 32Angelehnt an Meir-Huber, Cloud Computing, S. 12f. 33Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 23f. 34Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 13 mit einem Beispiel. 35Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 23f. 36Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 24. 37Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 13. 38Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 24. 39Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 24; Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 15. 40Vossen/Haselmann u.a., Cloud-Computing, S. 24 41Metzger/Reitz u.a., Cloud Computing, S. 15.
II. Abgrenzung zu ähnlichen Technologien
Bereits in den 1960er Jahren wurden Konzepte entwickelt, mit denen höhere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Rechnern nicht mehr ausschließlich durch die Konstruktion immer leistungsstärkerer einzelner („Super“-)Rechner, sondern durch die (sowohl effizientere als auch flexiblere) Zusammenschaltung mehrerer Rechner bewältigt werden sollten.42 Diese Vorläufer des Cloud Computing und die Unterschiede zur heute verwendeten Technologie werden nachfolgend dargestellt, um auf diesem Wege die Besonderheiten der hier in Rede stehenden Technologie deutlicher herauszuarbeiten.
1. Verteilte Systeme: Cluster- und Grid-Computing
Sowohl beim sog. „Cluster-“ als auch beim „Grid-Computing“ werden zunächst mehrere Rechner zu sog. „Knoten“ verbunden, um dann wiederum mehrere dieser „Knoten“ zu einem Gesamtsystem zu verbinden. Der zentrale Unterschied zwischen „Cluster-“ und „Grid-Computing“ besteht insoweit darin, dass ersteres auf der Zusammenschaltung mehrerer identischer Knoten besteht, die an einem Ort über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk verbunden werden, während bei letzterem die einzelnen „Knoten“ hinsichtlich Hardware, Software sowie im Hinblick auf die Anbindung an das „Grid“ differieren.43 „Grid-Computing“ wird typischerweise für einen sehr begrenzten und klar spezifizierten Anwenderkreis verwendet, z.B. in der Wissenschaft oder im Pharma-Segment.44 Der Zugriff erfolgt insoweit meist eher über ein organisationseigenes Intranet als über das Internet.45
Eine entscheidende Weiterentwicklung bei Cloud-Systemen gegenüber den Vorläufern besteht in der erheblich höheren Dynamik und Flexibilität. Während in Grid- und Cluster-Systemen die verfügbaren Ressourcen meist im Vorfeld verteilt werden, erfolgt bei Cloud-Systemen eine bedarfsorientierte Bereitstellung, weshalb nur Cloud-Systeme auf sich verändernden Ressourcenbedarf adäquat reagieren können.46 Außerdem ist der Grad der Virtualisierung bei Cloud Computing deutlich höher, wo ausschließlich mit virtuellen Ressourcen gearbeitet wird.47 Letztlich dürfte der Hauptgrund für den „Siegeszug“ der Cloud-Technologie nicht zuletzt in ihrer Ausrichtung an Wirtschaftlichkeitsaspekten liegen, die bei Grid- und Cluster-Verfahren nicht bzw. nur in geringerem Maße gegeben ist.48
Читать дальше