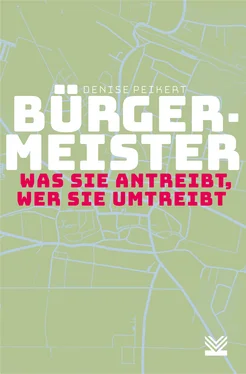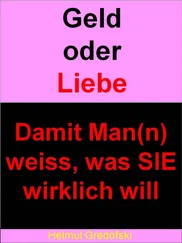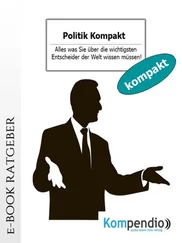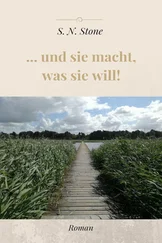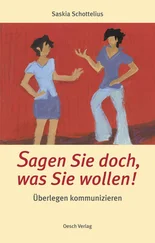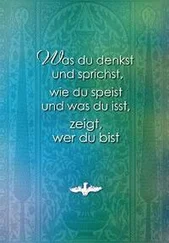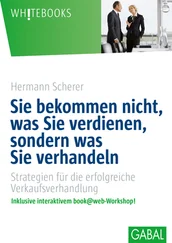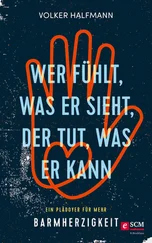Häufig ist auch das Ressentiment zu hören, „die im Rathaus“ oder „die in Berlin“ wüssten ja gar nicht mehr, was „uns“ bedrücke, weil sie in ihrer eigenen Welt lebten. Mehr als ein Drittel der Bürger fühle sich durch die Politik nicht mehr vertreten, referiert Denise Peikert eine Studie von 2019. Das sollte zumal Kommunalpolitiker aufhorchen lassen. In einem Stadtteil von Frankfurt am Main kam es im Frühjahr 2020 zu einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang. Jahrelang hatten Anwohner auf die Gefahrenstelle hingewiesen, im Rathaus, im Ortsbeirat, bei der Bahn. Geschehen war – nichts. Es ist jener Frankfurter Bezirk, in dem die AfD bei der hessischen Kommunalwahl im März 2016 den höchsten Anteil in der ganzen Stadt bekam. Auf der Suche nach Erklärungen bekamen Lokaljournalisten schon seinerzeit immer wieder diesen Bahnübergang zu hören, viel häufiger als „die Flüchtlinge“, als Beispiel für die Entfremdung der Stadtverwaltung vom Lebensalltag der Bürger, für das verbitterte Gefühl, in einem abgehängten Stadtteil zu leben.
Und dennoch: Die große Mehrheit der Kommunalpolitiker – viele von ihnen arbeiten ehrenamtlich –, die sich für oder gegen eine Umgehungsstraße, für oder gegen ein Gewerbegebiet einsetzen, weil ihre Gemeinde ihnen am Herzen liegt, hat es weder verdient noch nötig, sich als ahnungslose, abgehobene, postengierige, lobbyhörige Clique abkanzeln zu lassen. Auch dafür liefert Denise Peikerts Buch reichlich Anschauung. Wer es liest, versteht, wovon Kommunalpolitiker sich leiten lassen, was sie antreibt und warum sie am Wochenende vielleicht auch lieber in der Sonne säßen, es aber für ihre staatsbürgerliche Pflicht halten, der freiwilligen Feuerwehr die Ehre zu erweisen.
Eine Pflicht übrigens, die sie aus eigenem Entschluss übernommen haben, weil sie wissen, dass Demokratie und Bürgergesellschaft in nicht geringem Maße von der freiwilligen Übernahme von Verantwortung leben. Frei nach Ernst-Wolfgang Böckenförde: Der freiheitliche Staat kann politische Teilnahme nicht erzwingen, sonst gäbe er seinen freiheitlichen Charakter auf, deshalb kennen wir beispielsweise auch keine Wahlpflicht. Wenn aber niemand mehr aus freien Stücken Verantwortung übernimmt, wenn alle zwar Radfahren wollen, aber niemand mehr bereit ist, Planfeststellungsbeschlüsse für neue Radwege zu erarbeiten – ja, das macht Arbeit bis spät in die Nacht –, dann sägen wir am Ast, auf dem wir sitzen. Erst wenn die letzte Bürgermeisterin und der letzte Stadtrat resigniert aufgegeben haben, werden die Pöbler und die Nägelausleger merken, dass Wutbürger keine Schulhäuser sanieren und keine Neubaugebiete ausweisen.
Vielleicht stellt ja die Corona-Krise die Verhältnisse vom Kopf auf die Füße. Eine Forsa-Umfrage von Ende Mai 2020 lässt den Schluss zu, dass unter dem Eindruck des von den meisten als umsichtig und angemessen empfundenen Handelns von Bund, Ländern und Kommunen das Vertrauen in die politischen Institutionen wieder wächst – bei allem berechtigten Dissens im Einzelnen. Mehr als die Hälfte der Deutschen und damit wieder mehr als zuvor vertrauen ihren Bürgermeistern und Oberbürgermeistern (58 Prozent), den Gemeindevertretungen (57 Prozent) und den Stadtverwaltungen (56 Prozent). Wer weiß, vielleicht müssen die Neulewiner demnächst ja nicht mehr so lange darauf warten, dass sich jemand bereitfindet, das Bürgermeisteramt zu übernehmen.
Werner D‘Inka Autor und ehemaliger Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Die Texte in diesem Buch berücksichtigen beide Geschlechter. Das bedeutet auch, mit alten Sprach- und Schreibgewohnheiten zu brechen. Deshalb werden im Folgenden männliche und weibliche Form personenbezogener Substantive und Pronomen bis auf wenige Ausnahmen abgewechselt. Ein Beispiel: Sind sowohl männliche als auch weibliche Amtspersonen gemeint, ist an einer Stelle von „den Bürgermeistern“ die Rede – und an anderer Stelle von „den Bürgermeisterinnen“.
Detlef Ebert, Löcknitz
Plötzlich Speckgürtel
Löcknitz an der polnischen Grenze wächst seit Jahren. Bauflächen für Eigenheime mussten her, Schulen; die Supermärkte haben jetzt sonntags offen. Detlef Ebert ist ehrenamtlicher Bürgermeister in dem Dorf.
Er verwaltet den Boom in seiner Freizeit.

In der großen Weite zwischen Berlin und Rostock, in einem Landstrich wie dampfgewalzt, ist die Löcknitzer Burg nicht etwa weithin zu sehen, thronend auf einem Hügel, sondern sie fällt eigentlich nur denen auf, die direkt davorstehen. Der Burgturm erreicht mit Mühe die Höhe eines mittelgroßen Hauses, und im Halbdunkel daneben frieren und schweigen an einem Abend im Oktober 2019 Grüppchen von Menschen. Dann, es ist sechs Minuten vor 19 Uhr, biegt Detlef Ebert in den Burghof ein. Links trägt er seine Aktentasche, mit rechts schüttelt er allen die Hände. Danach schließt er die Tür zu einem flachen Nebengebäude des Turms auf, sein Schlüsselbund von Hausmeister-Dimension klimpert, und so hört Ebert sie nicht, zum Glück vielleicht nicht, die genervte Empörung einer Frau: „Der mit dem Schlüssel kommt zuletzt, so schnapp ab.“
Denn zu dem Zeitpunkt hat Detlef Ebert, 54 Jahre alt und der Bürgermeister von Löcknitz, schon einen ziemlich vollen Tag hinter sich. Er saß schon in seinem eigentlichen Büro in der Wohnungsbaugenossenschaft von Löcknitz, deren Vorstandsvorsitzender er ist. Dort hat er Leute empfangen, die wegen eines Rohrbruchs immer noch kein warmes Wasser haben. Das ist sein Job, damit verdient er sein Geld. Danach ist Ebert in sein zweites Büro gefahren, in das Bürgermeisterbüro in der alten Schule in Löcknitz. Dort hat er Sprechstunde, immer dienstags zwischen 16 und 18 Uhr, und dort schlich von Punkt vier an die Frau vom Arbeitslosentreff herum, die Ebert jede Woche mit Kaffee und Kuchen versorgt. Fünf nach vier, zehn nach vier – immer noch kein Bürgermeister da. Als er dann kam, 20 Minuten zu spät, wegen der Rohrbruch-Leute, balancierte Ebert Apfelkuchen, Kaffee und Aktenkoffer zu seinem Tisch. Dann hat er eilig zwei Männer empfangen, die in der Gegend Windräder bauen und Leitungen verlegen wollen. Weitergebracht, sagt er, hat ihn das Gespräch nicht, die Verhandlungen stünden wieder ganz am Anfang. Danach kam jemand, der sich mit ihm über illegales Parken am Löcknitzer See unterhalten wollte. Dann rief Eberts Lebensgefährtin an, wo er denn bleibe. Dass er gleich komme, hat Ebert ins Telefon gesagt, und dass er natürlich den Sohn vorher noch abhole.
Als Ebert auf den Burghof einbiegt, ist das Gespräch mit seiner Lebensgefährtin 40 Minuten her. 40 Minuten, in denen Ebert tatsächlich irgendwann aus dem Bürgermeister-Büro aufgebrochen ist, seinen acht Jahre alten Sohn abgeholt und nach Hause gefahren hat, zwei Bissen gegessen hat. Nun führt er den kleinen Tross vom Burghof die Treppen hoch in den Gemeindesaal, macht das Licht an, stellt die Stühle herunter, zieht die Funktionsjacke aus, legt seinen Aktenordner auf den Tisch. 19 Uhr, Sitzung der Gemeindevertretung.
Löcknitz liegt in Mecklenburg-Vorpommern an der polnischen Grenze. 3.200 Einwohner hat er Ort, Tendenz steigend. Außerdem drei Supermärkte, vier Schulen, zwei Kindergärten, mehrere Ärzte, zwei Apotheken, ein Bahnhofsgebäude mit Gastwirtschaft und ein Park-Leitsystem. Löcknitz ist, so kann man das sagen, Boom-Town. Und Detlef Ebert verwaltet den Boom in seiner Freizeit, jedenfalls theoretisch. Er ist Bürgermeister im Ehrenamt.
Im Gemeindesaal in Löcknitz geht es an diesem Oktoberabend erst um die richtige Positionierung von Bushaltestellen an der Schule, um verwitternde Kriegsgräber auf dem Friedhof und um die Sache mit den Windrädern. Jetzt kommt die Einwohnerfragestunde, es fragt: Bürgerin Frau Schröder, die, wie sie sagt „in Löcknitz geboren und alt geworden ist.“ Frau Schröder ist diejenige, die bemängelt hatte, wie spät Detlef Ebert mit dem Schlüssel gekommen sei, und hat, das stellt sich nun heraus, noch viel mehr zu bemängeln: Dass die Teiche in Löcknitz zugewuchert seien. Dass manch neu gepflanzter Baum keine Blätter trage. Dass die Mitarbeiter auf dem Friedhof die Grabsteine „mit den Händen“ hinlegen müssen, statt, wie Frau Schröder es angemessen fände, einen Bagger zu benutzen. Überhaupt, der Friedhof: Im Fernsehen, findet Frau Schröder, zeigen sie immer so schöne Friedhöfe, und in Löcknitz, da wachsen die Misteln in den Bäumen und keiner entferne sie. „Was hier los ist in Löcknitz“, ruft Frau Schröder, und macht vor lauter Entflammtheit einen kleinen Schritt nach vorn bei dem Satz, „also man schämt sich.“ Zweimal, sagt Frau Schröder noch, sei sie schon bei Herrn Ebert gewesen wegen der Misteln, „und Sie haben mir keine richtige Antwort gegeben.“
Читать дальше