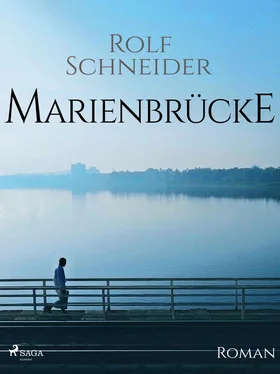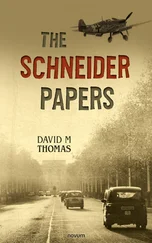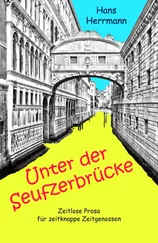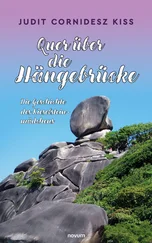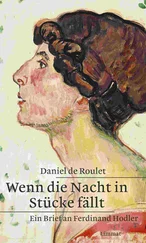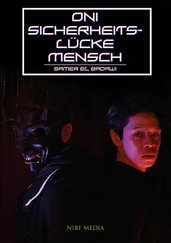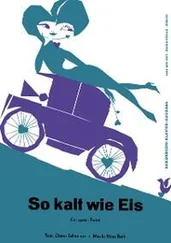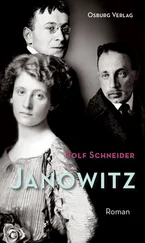Gwendolyns Bilder gefielen Kersting. Sie erinnerten ihn an frühere Arbeiten seines Vaters. Gwendolyn selbst war eine fleischige Person mit großen blauen Augen, dichten rotbraunen Locken und einem Gesicht voller Sommersprossen. Vor unstillbarem Hunger nach Zärtlichkeit schien sie zu beben. Sie hatte eine angenehm heisere Stimme und einen reizenden S-Fehler. Ihre Bewegungen waren von somnambuler Trägheit.
Kersting besuchte sie regelmäßig in ihrem Atelier. Er verbrachte Wochenenden mit ihr in abgelegenen Dorfgasthöfen der Mark Brandenburg. Einmal fuhr er mit ihr, da sie es so wünschte, an die herbstliche Küste der Ostsee. Drei Tage lang wohnten sie in einem Haus, das Creyenveldt gehörte und für das Kersting einen Schlüssel besaß. In der Nachbarschaft lebte eine neurotische junge Frau, die Kersting seit Jahren kannte.
Hinterher sagte er sich, es sei mehr als leichtsinnig gewesen, sich ausgerechnet hier aufzuhalten. Kerstings Frau Sonja erfuhr von Kerstings Besuch, und sie erfuhr von Kerstings Begleitung. Es kam zu langen peinigenden Auseinandersetzungen zwischen den beiden Eheleuten, bis Kersting entnervt die gemeinsame Wohnung verließ. Er suchte sich zwei Zimmer in einem alten Mietshaus hinter dem Oranienburger Tor. Er zog dort ein, mit drei Koffern, ein paar hundert Büchern und einem unfertigen Manuskript über den belgischen Jugendstilarchitekten Henry Clemens van de Velde.
Die Arbeiten daran kamen gut voran. Gwendolyn besuchte ihn, und er besuchte Gwendolyn. Mit Sonja telefonierte er, wenn es Probleme mit David gab, ihrem Sohn, dem die elterliche Trennung offenbar nicht bekam.
Irgendwann hatte Kerstings Verhältnis mit Gwendolyn seinen Höhepunkt überschritten. Gwendolyn interessierte sich inständig für Kerstings Arbeit über Henry van der Velde, obschon sie von belgischem oder europäischem Jugendstil nur wenig wusste und gar nichts verstand. Manchmal warf er ihr Heuchelei vor. Daraufhin brach sie in ein heiseres Schluchzen aus. Ihr weiches, nach erhitztem Eau de Cologne duftendes Fleisch begann ihn zu langweilen. Er überlegte, ob er die Sache mit Gwendolyn beenden und zu Sonja zurückkehren solle.
Da erfuhr er, dass Sonja ihrerseits eine Affäre hatte: mit Gleb Grigorjewitsch Surkow, einem Angehörigen der sowjetischen Botschaft Unter den Linden. Sonja hatte Surkow bei einem der Empfänge zum Jahrestag der Oktoberrevolution kennengelernt. Zu dieser Veranstaltung wurde sie regelmäßig eingeladen, gemeinsam mit Creyenveldt, ihrem Vater, und Kersting, ihrem Mann.
Surkow war ein drahtiger junger Mensch mit rosigem Bubengesicht unter einem schlohweißen Haarschopf. Sonjas Affäre mit ihm lief länger als Kerstings Affäre mit Gwendolyn, was Kersting erst bekannt wurde, als er aus der gemeinsamen Wohnung schon ausgezogen war. Die Mitteilung darüber, sie kam übrigens von Sonja, am Telefon, erbitterte ihn.
Bald darauf zog Gwendolyn es vor, zu ihrem Ehemann zurückzukehren. Dass sie verheiratet war, hatte Kersting erst erfahren, als sein Verhältnis mit ihr schon eine Weile lief, und auch da hatte er es bloß durch einen Zufall erfahren. Gwendolyns Ehemann lehrte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Gwendolyn hieß mit bürgerlichem Familiennamen Schliephake.
Die Beziehung zwischen Sonja und Gleb Grigorjewitsch Surkow ging dann gleichfalls zu Ende, denn es verstieß gegen alle Regeln, dass ein verheirateter sowjetischer Botschaftsrat ein Liebesverhältnis mit einer verheirateten deutschen Frau unterhielt, selbst wenn diese Frau in Moskau geboren war und besser Russisch sprach als Deutsch. Auch die Bedingungen unter dem neuen KPdSU-Generalsekretär Michail Sergejewitsch Gorbatschow änderten an den entsprechenden Vorschriften nichts, oder sie änderten nichts für die sowjetische Botschaft Unter den Linden. Gleb G. Surkow wurde aus Berlin abberufen und nach einem kurzen Zwischenaufenthalt im Moskauer Außenministerium versetzt an die Mission der Sowjetunion in Ulan Bator, Hauptstadt der Mongolischen Volksrepublik.
Sonja reagierte darauf mit einer schweren psychischen Erschütterung. Sie trank viel. Sie verzehrte unentwegt Beruhigungstabletten. Immer öfter hielt sie sich im Haus ihres Vaters an der Ostseeküste auf. Ihr Sohn David schien sie wenig zu interessieren, dafür begann sie einen innigen Umgang mit jener neurotischen Nachbarin, über die sie von Kerstings Affäre mit der Malerin Gwendolyn erfahren hatte.
Kersting telefonierte manchmal mit Sonja. Wenn sie sich in Berlin aufhielt, besuchte er sie, wobei es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kam. Gelegentlich erhielt Kersting Besuch von seinem Sohn. David, einst ein sanfter und liebenswürdige Junge, hatte sich völlig verändert. Er wirkte abweisend und redete nicht viel. Meist verlangte er bloß nach Geld. Kersting schrieb ihm dann einen Scheck aus.
Als Kersting die Möglichkeit zu einem viermonatigen Arbeitsaufenthalt in Wien erhielt, empfand er das als einen erlösenden Ausweg.
Grotenweddingen lag vor dem Gebirge nordöstlich. Nach allen Eingemeindungen während anderthalb Jahrzehnten hatte es eine Gesamteinwohnerzahl von dreißigtausend und wucherte mit seinen Gebäuden in drei Täler hinein. Das Gebirge besaß aufgelassene Bergwerksschächte und Stollen. In den Bergwerken waren schon seit dem zehnten Jahrhundert Eisenerze gefördert worden. Reichsunmittelbare Aristokraten namens Botho, Albrecht und Ferdinand Ernst hatten sie verhütten lassen, bis der Betrieb nicht mehr rentabel war.
Schon im zweiten Jahr des durch Adolf Hitler begonnenen Weltkriegs wurde in ein paar dieser Schächte nahe Grotenweddingen auch der Förderbetrieb wieder aufgenommen. Ächzende Seilbahnen trugen das unverhüttete Erz über Biesenberg und Horstschanze bis zum Güterbahnhof, wo es krachend herabfiel in bereitgestellte Waggons. Die Seilbahn wurde durch eiserne Masten gestützt, in deren Gestängen zu klettern verboten war. Unter der Fahrstrecke drohte nach Auskünften der aufgestellten Warnschilder Steinschlag. Ungeachtet aller Warnungen und Verbote kletterten gerne Kinder in diese Masten hinein oder krochen, was gleichfalls untersagt war, in die verschütteten Einstiege von aufgelassenen Stollen.
Auch Jacob ging gerne dorthin, für eine Weile. Einmal kletterte er in einen der Masten hinein. Mit blanken Knien hing er in den höchsten Verstrebungen und legte prüfend die rechte Hand auf die Metallrollen, über die das Stahlseil mit den Förderkörben lief. Er wartete, bis einer von den Körben heran war, sammelte Nasenschleim in seinem Rachen und spie aus gespitzten Lippen auf die rötlich-grauen Erzbrocken, die der deutschen Kriegswirtschaft entgegenschaukelten. Er hatte danach immer noch genügend Feuchtigkeit im Munde und spie abermals, jetzt bloß aufs Gezweig einer Lärche, wo das hängen blieb, ein glitzernder Klumpen, den sich die Eichelhäher pflücken würden. Anschließend kletterte er wieder herunter.
Er stand vor einem Stolleneingang, der versperrt war mit zwei über Kreuz genagelten Brettern sowie einem Schild, das von drohendem Einsturz wusste. Jacob schob sich, wozu es wenig Mühe brauchte, unter den gekreuzten Brettern hindurch. Er fand sich wieder in einer Höhlung, die niedrig war und weiter ins Dunkel führte. Abgestützt war das seitlich mit Balken, auf denen als Abdeckung Bretter lagen, manche geborsten, womit sie Platz ließen für dürr und leichenblass herabhängende Wurzeln. Jacob kroch weiter. Er versuchte sich vorzustellen, wie früher Bergleute hier eingefahren waren, um Erz zu holen. Sie hatten sich ständig gebückt halten müssen oder waren kleinwüchsig gewesen, Zwerge, es gab Geschichten von Zwergen, die in der Gegend um Grotenweddingen spielten, wie auch Geschichten von Förstern, Riesen, Köhlern, Jägern, Hexen und Mönchen, alles gesammelt in dünnen hochformatigen Büchern mit Frakturbuchstaben.
Jacob las gerne darin. Er las die Geschichten zwei- und dreimal. Die ihm liebste erzählte vom Bergmönch. Der war ein ungeschlachter Kerl, Angehöriger des Zisterzienserklosters Biesenstein, das es längst nicht mehr gab, nicht einmal als Ruine und nicht wenigstens als Flurname, bloß als historische Erinnerung und als Schauplatz von Heimatsagen in dünnen großformatigen Büchern.
Читать дальше