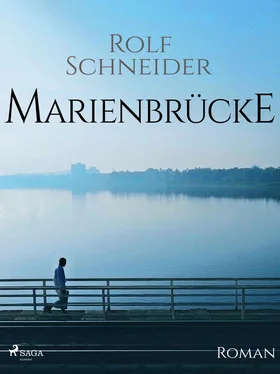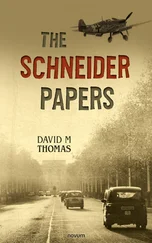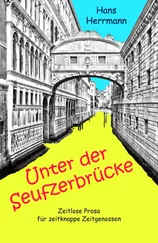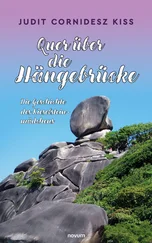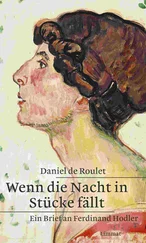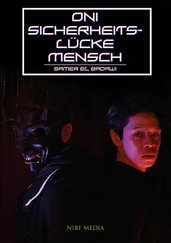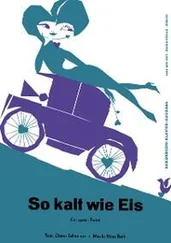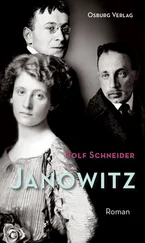Er stand am Michaelerplatz, gegenüber jenem Hause, das 1909, als es Adolf Loos umzubauen begann, der Firma Goldman und Salatsch gehörte. Die Säulen mit ihren grauen Marmorverkleidungen existierten noch. Die oberen Stockwerke hatten ihren glatten weißen Verputz. Die Fenster ohne alle Umrahmung hatte der Kaiser Franz Josef augenbrauenlos genannt, eine hübsche Metapher, doch Franz Josef hatte sie als vernichtenden Tadel gemeint. Die Empörung, die damals ganz Wien erfasst hatte wegen des Loos-Entwurfs und die zu einer Unterbrechung des Baugeschehens im Jahre 1910 führen würde, war inzwischen unbegreiflich geworden. Die Tragödie des Adolf Loos bestand unter anderem darin, dass er sich ausdrücklich als Traditionalist begriff und den Wienern damals als im höchsten Maße modern und umstürzlerisch erschien. Er entwarf mehr, als er baute. Noch seine Entwürfe blieben häufig bloß Sprache, statt wenigstens Bauskizze oder Modell zu sein. Verständlich die ohnmächtige Feindschaft dieses Mannes zu dem beängstigend produktiven Josef Hoffmann, den Loos verächtlich überquellend nannte.
Kersting war gekommen, ein Ausländerkonto zu eröffnen, damit ihm die dafür zuständige österreichische Behörde sein Arbeitsstipendium überweisen konnte. Er stand in der Schalterhalle. Er sagte sein Anliegen. Er musste seinen Reisepass vorweisen. Die Frau hinter dem Schalter durchblätterte die hellblauen Seiten, als sehe sie so was zum ersten Mal. Vielleicht sah sie es zum ersten Mal. Ihr Gesicht zeigte den Ausdruck beflissener Feindseligkeit. Sie bat Kersting um etwas Geduld. Sie ging davon, in Händen Kerstings Reisepass mit dem Abbild des DDR-Staatswappens auf dem Deckel. Kersting hatte Gelegenheit, die anderen Kunden und das übrige Personal zu betrachten.
Die in der langen Schalterhalle aufgestellten Computer-Monitore wuschen, so schien es, mit ihren Strahlungen aus den Angestellten alle Natürlichkeit fort. Die junge Beamtin, die schräg gegenüber von Kersting stand, hatte die Aura einer Untoten. Sämtliche Unterhaltungen erfolgten halblaut. Niemand, der nicht gemeint war, konnte von dem Mitgeteilten etwas verstehen. Die geraunten Laute standen für Konten, Beträge, Anlagen, Zinsen, Kredite, und alle verhielten sich, als sei dies etwas Obszönes.
Die Gesichter der Kunden waren den Mündern der Bankangestellten gierig lauschend zugeneigt. Eine Welle der Lüsternheit lief über ihre Mienen wie ein Lichtstrahl. Kersting stand neben einer mageren alten Dame. Ihr Hals war schlaff. Ihre Hände waren knotig und zeigten Altersflecken. Den Kupon, gegen den an der Kasse die gewünschte Auszahlung erfolgen sollte, erfasste sie, als handle es sich um ein zuckendes Tier oder ein männliches Genital. Der Wiener Seelenarzt Sigmund Freud, erinnerte sich Kersting, hatte das Geld dem Exkrement zugeordnet. Das Tabu ergab sich aus einem die Lust bloß mühsam zurückhaltenden Schamgefühl. Das Wiener Verhalten zum Geld war eine ins Unaufhörliche ausgedehnte anale Phase. Kersting wurde Zeuge eines analen Kapitalismus.
Die Beamtin, die Kersting bediente, kehrte zurück. Sie händigte Kersting eine Kunststoffkarte aus, dazu ein Bündel Scheckvordrucke in einer Kunststofftasche, alles in leuchtendem Gelb. Kersting setzte auf einen Vordruck seine Unterschrift. Der Gesichtsausdruck der Beamtin zeigte jetzt nur mehr Beflissenheit. Kersting war zum Teilhaber des analen Kapitalismus geworden.
Seine ersten Berührungen mit der Bildkunst verdankte er seinem Vater. Robert wollte, dass sein Sohn Jacob ihn immer bloß mit dem Vornamen anredete. Die Wörter Vater oder Papa, ihn betreffend, hasste er.
Robert war 1889 geboren, wie Adolf Hitler, und stammte aus dem gleichen Leipziger Proletarierviertel, in dem Walter Ulbricht groß geworden war. Roberts Vater war ein Mann mit rundem Gesicht und einer groben Nase gewesen: So blickte er von zwei bräunlichen Fotografien in Postkartengröße, in einem Album, das bei Robert im Bücherregal stand. Jacob blätterte manchmal darin. Die Bilder rochen stockfleckig. Robert und Roberts Vater, wusste der Junge, waren einander ähnlich gewesen in den Ausmaßen ihrer Hartnäckigkeit. Als Robert sich weigerte, in die väterliche Zigarrenmacherwerkstatt einzutreten, wurde er nach einer langen lautstarken Auseinandersetzung mit Worten, auch mit wiederholten Faustschlägen auf die Tischplatte, aus dem Haus getrieben.
Robert trat eine Lehre an in Leipzig-Stötteritz, bei einem 1873 gegründeten Unternehmen, das Textilmaschinen produzierte. Er lebte drei Jahre lang in einem Männerheim. Dann erhielt er seinen Gesellenbrief und ging sofort nach Süddeutschland, später nach Italien. Sechzehn Monate blieb er in der Toskana, Pistoia, wo er sich der anarchistischen Alianza della Rivoluzione Sociale von Errico Malatesta anschloss. Die Werkstätten und Fabriken, in denen er arbeitete, achteten ihn seiner Geschicklichkeit wegen. Als er nach Deutschland heimkehrte, weil er von Bremerhaven aus sich nach New York einschiffen wollte, begann der Erste Weltkrieg.
Statt auf dem norwegischen Dampfer Sör-Töndelag fand er sich wieder auf dem Mannschaftsdeck eines Schulschiffs der kaiserlichen deutschen Kriegsmarine, mit dem Heimathafen Kiel. Anschließend tat er als Obermatrose Dienst auf einem im Mittelmeer dümpelnden Schlachtschiff, das die Häfen des türkischen Verbündeten beschützen musste. Bei einer Schießerei mit britischen Kanonenbooten lief dieser Kreuzer, mit Namen Breslau , türkisch Midilli , auf eine Mine, dass er auseinanderbrach, Heck und Steven schräg in die Höhe gestellt. Die Besatzung sprang schreiend ins Wasser. Schwamm, wo des Schwimmens fähig, über eine Stunde, zwei englische Kriegsschiffe fischten die Überlebenden dann auf, unter ihnen Robert.
Reichliche zwei Jahre verbrachte er als Kriegsgefangener auf einer Festung der zu England gehörigen Mittelmeerinsel Malta. Damals begann er zu zeichnen, aus Langeweile, seine Hände zeigten sich auch darin geschickt. Im Frühjahr 1919 wurde er erst in einem Frachtschiff nach Apulien, danach, in einem mehrtägigen Güterbahntransport von Süden nach Norden, durch die gesamte italienische Halbinsel gefahren. In Wilhelmshaven das Feuer unter den Kesseln fortzureißen und die rote Fahne zu hissen, kam er zu spät, obwohl er das Bedürfnis dazu jedenfalls besessen hätte. Als er von Fürth, wo er vorübergehend in Arbeit stand, nach Leipzig fahren wollte, gelangte er bloß bis ins Vogtland. Der Zug wurde angehalten auf freier Strecke. Im Schotter des Bahndammes standen mehrere düstere Männer, Gewehr in der Hand und Signalbinde am rechten Arm. Einer schwenkte eine rote Fahne. Die Menschen sollten ihre Sache in die eigenen Hände nehmen, frei werden von jeglichem Zwang, voran dem ökonomischen, und eine Ordnung errichten, die das Ende war von aller bekannten Ordnung. Das klang sehr nach kollektivem Anarchismus. Augenblicklich beschloss Robert, sich den Männern anzuschließen und sich unter das Kommando ihres Anführers zu stellen, der Max Hoelz hieß.
Robert erlebte ihn als einen Menschen mit der unwiderstehlichen Anziehungskraft des edlen Räubers, wie schon der erfundene Karl Moor und der historische Schinderhannes einer gewesen waren. Einige Zeit behauptete sich ihr Aufstand. Dann befand sich die Reichswehr des sozialdemokratischen Ministers Noske gegen sie auf dem Vormarsch, Max Hoelz löste seine Armee auf und floh mit einigen seiner Freunde, darunter Robert, über die deutsch-tschechische Grenze.
Sie übernachteten in Heuschobern, wateten durch überschwemmte Wiesen und hatten ständig die böhmische Polizei hinter sich. Hoelz wurde aus einem Eisenbahnzug heraus verhaftet, in Marienbad. Robert gelangte bis Prag, wo er einem Mann, der offenbar unter materieller Not litt, auf einem Bahnhofsperron statt der angebotenen silbernen Taschenuhr dessen Identitätspapier und Namen abkaufte. Damit würde er die nächsten Jahre leben. Manchmal fertigte er auf Märkten Zeichnungen, Kohle auf bräunlichem Papier, die Abbilder von dafür zahlenden Passanten.
Читать дальше