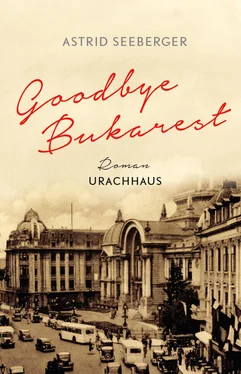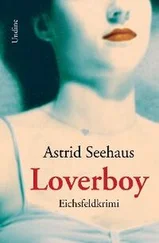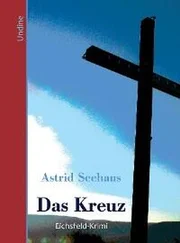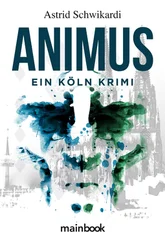Astrid Seeberger
Aus dem Schwedischen von Gisela Kosubek

Für Lech
Es dunkelt.
Europas Karte ist mit Blut befleckt.
Das Violoncello aber gibt nicht auf.
Und der Chor erzeugt die Ordnung,
die der Welt misslungen ist.
Kjell Espmark aus Evangelisten
im Band Skapelsen (Die Schöpfung)
Einige Namen wurden auf Wunsch der Lebenden und Hinterbliebenen geändert .
Auf der Insel, 9. November 2014
Auf der Insel, 10. November 2014
Auf der Insel, 12. November 2014
Auf der Insel, 16. November 2014
Auf der Insel, 22. November 2014
Auf der Insel, 9. Dezember 2014
Auf der Insel, 22. Dezember 2014
Auf der Insel, 1. Januar 2015
Auf der Insel, 12. Januar 2015
Auf der Insel, 2. Februar 2015
Auf der Insel, 11. März 2015
Auf der Suche nach Bruno: Wannsee, im April 2015
Dmitri Fjodorows alias Hannes Grünhoffs Geschichte
Teil 1
Dmitri Fjodorows alias Hannes Grünhoffs Geschichte
Teil 2
Dmitri Fjodorows alias Hannes Grünhoffs Geschichte
Teil 3
Dmitri Fjodorows alias Hannes Grünhoffs Geschichte
Teil 4
Auf der Suche nach Bruno: Bukarest, im Juni 2015
Auf der Suche nach Bruno: Berg, Oktober 2015
Wolfgang Müllers Geschichte
Auf der Suche nach Bruno: München, Oktober 2015
Jakob Seebergers Geschichte
Auf der Suche nach Bruno: München, Oktober 2015
Dinu Adamescus Geschichte
Auf der Suche nach Bruno: Münsing, Oktober 2015
Heimkehr, Oktober 2015
Auf der Insel, 9. November 2014
Das Festland ist nicht zu sehen, nur Nebel, als wäre die Insel weit fortgetrieben. Kälte dringt durch Mark und Bein. Wäre Lech doch hier und würde mich in seinen Armen wärmen.
Einmal – es war im letzten Sommer, als wir gerade aufgewacht waren – sagte er, es gäbe Tage, in die man sich stürze wie in die Arme seiner Geliebten: Tage, an denen alles einen Glanz besaß. Dann gibt es die anderen Tage. Über die aber sprach er nicht, ich auch nicht, damals nicht. Tage, die, wie Lars Gustafsson schrieb, gleich einer Nadelspitze sind. Und »auf dieser Nadelspitze leben wir, wie die Engel«, die fallenden Engel, die »am Kometenschweif ihres langen Haares« in die Tiefe stürzen.
Heute ist so ein Nadelspitzentag. Und diese Nadelspitze ist zu spüren. Lech ist wieder ins Krankenhaus gekommen. Es hatte angefangen, als wir nach Bukarest fahren wollten. Er bekam eine Lungenentzündung. Das geschieht schnell, wenn man COPD hat. Als Ärztin weiß ich das, ich weiß mehr, als ich manchmal wissen will. Auch, dass das Schlimmste passieren kann, wenn man Lungenentzündung und zugleich COPD hat. Es gibt ein Wissen, das wie eine Nadelspitze im Herzen ist.
Gestern saß ich an seinem Krankenbett. Er schlief die meiste Zeit, eine Sauerstoffmaske über Nase und Mund. Als ich seine Hand streichelte, war die heiß. Oder wie sein Arzt sagte: Das Fieber tobt in seinem Körper. Ich musste an einen meiner Patienten denken, einen alten Priester, der lebensgefährlich erkrankt war. Er sagte mit kaum vernehmbarer Stimme, es sei wichtig, die Kategorie des Jubels lebendig zu erhalten. Ich hätte ihn fragen sollen, wie man das macht.
Hätte Lech nicht mit drei anderen Patienten im Zimmer gelegen, wäre ich dortgeblieben. Nun war ich gezwungen, ihn zu verlassen. Es war dunkel, als ich nach Hause fuhr. Kurz vor Råby graste ein Rudel Damhirsche neben der Straße, im Scheinwerferlicht leuchteten ihre Augen rot. Wie das Ewige Licht in der Kirche meiner Kindheit, das stets brannte, dank Alois, dem kleinen rundlichen Pfarrer, der Vaters Freund war. Allmorgendlich füllte er das Öl in der roten Lampe nach. Wie Lech einmal zu mir gesagt hatte: Es sind wir Menschen, die Ewigkeiten füreinander schaffen.
Ich bog von der Straße ab in die Allee. Bei den Briefkästen an der Brücke hielt ich an. Ich hatte einen Brief bekommen, von der rumänischen Fluggesellschaft TAROM. Ich legte ihn auf den Beifahrersitz und fuhr über die Brücke zu unserem Haus. Die Fenster waren dunkel, kein Laut war zu hören. Als ich aus dem Wagen stieg, fühlte ich mich wie die Letzte eines vertriebenen Volkes.
Das Erste, was ich beim Betreten des Hauses sah, war Lechs Pullover. Er lag auf dem Stuhl in der Diele, als hätte er ihn gerade dort abgelegt. Ich berührte ihn, als könnte mir das helfen, und ging ins Schreibzimmer. Dort legte ich den Brief auf den Schreibtisch, ungeöffnet. Wie soll man einen Brief, der alles entscheidet, an einem Nadelspitzentag lesen können?
Stattdessen streckte ich mich im Wohnzimmer auf dem Sofa aus, auf dem mit dem Wolfspelz, einem großen, schönen Wolfspelz. Lech hatte ihn auf einer Auktion für mich erstanden. Noch bevor ich erfahren hatte, wem Großvater seinen Wolfspelz umgelegt hatte. In meiner Kindheit hatte er ihn mir umgelegt. Und gesagt, nun könne mich keine Kälte der Welt mehr treffen. Vielleicht hat er das auch zu der anderen gesagt. Doch sagte er nie das, was Mutter sagte: dass Wölfe nie verstummen, nicht einmal, wenn sie zu Pelzen geworden sind. Erst, wenn sie auch das Letzte vom Menschen verschlungen haben, sein zitterndes Herz.
Ich fühlte die Müdigkeit bleischwer kommen. All diese unruhigen Nächte, in denen die Geräusche, die selbstverständlich waren, fehlten: Lechs Atemzüge, dicht neben mir.
Auf der Insel, 10. November 2014
Ich wachte auf dem Sofa auf, weil ich fror. Die Uhr zeigte nach Mitternacht. Ich holte Lechs Pullover und legte ihn mir um die Schultern. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch und rief im Krankenhaus an. Es dauerte eine Weile, bis jemand antwortete, eine Krankenschwester, die barsch erklärte, Lechs Zustand sei stabil. Als Ärztin weiß man, was das bedeutet: Keine Besserung. Genauso kurzatmig. Genauso fiebrig.
Ich schaute das Bild an, das neben dem Telefon stand: ein Foto von Chopin, das einzige, das es von ihm gibt, im selben Jahr aufgenommen, als er starb, erst neununddreißig Jahre alt. Er sitzt aufrecht an einem Fenster, die eine Hand auf die andere gelegt. Das Gesicht, umrahmt von dunklem welligem Haar, ist schön, mit hoher Stirn, gerader Nase und männlich energischem Kinn. Er hätte kraftvoll aussehen können, wäre da nicht der Mund gewesen – ein feingezeichneter, sinnlicher Mund – und die Augen, vor allem die Augen, die einem Abgrund an Trauer glichen. Vielleicht wusste er, was ihn erwartete.
Das Bild stand da, weil mir ein anderes fehlte, das, das Mutter in ihrem Fotoalbum hatte und Bruno zeigte, ihren ältesten Bruder. Wenn Mutter nicht gesagt hätte, es sei Bruno, hätte man geglaubt, es wäre Chopin. Sie ähnelten einander wie Zwillingsbrüder. Der einzige Unterschied zwischen ihnen war, dass Chopin Dichterkleidung trug und Bruno die Uniform von Hitlers Luftwaffe.
Mutter hatte Brunos Bild verbrannt. Sie hatte alles verbrannt, alle Bilder, alle Papiere, alle Briefe, jedes Detail, das von ihrem früheren Leben zeugte. Sie sei rasend geworden, sagte sie, als sie daran dachte, was aus ihrem Leben geworden war. Ein Leben, das ihr ein Flüchtlingsgesicht gegeben hatte. Das Schlimmste war, dass sie dieses Gesicht noch immer hatte, als sie starb. Bevor sie selbst verbrannt wurde.
Ein einziges Bild war dem Feuer der Raserei entkommen: ein kleines vergilbtes Foto mit gezacktem weißem Rand. Es lag in Mutters Portemonnaie, das mir eine Schwester des Stuttgarter Krankenhauses nach ihrem Tod gegeben hatte. Auf dem Foto steht ein schmales dunkelhaariges Mädchen zwischen zwei jungen Männern mit dunklem welligem Haar. Alle drei lächeln mit ihrem feingezeichneten, sinnlichen Mund. Ihre Augen jedoch sind zu klein, als dass man einen Ausdruck in ihnen erkennen könnte. Das war Mutter mit ihren Brüdern, Bruno und Ewald, ein Jahr bevor der Krieg ausbrach.
Читать дальше