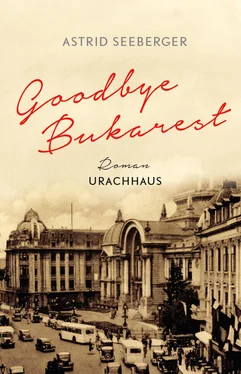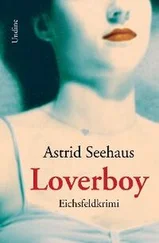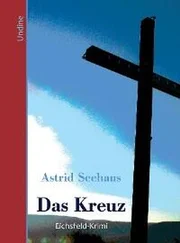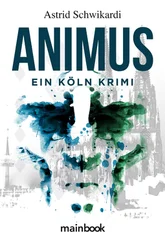Sie sagte, sie würde sie über alles lieben: Bruno, dem es gelang, dass alles, was er berührte, zu zittern aufhörte, auch die Menschen, auch Mutter, und dann Ewald, bei dem die Frauen vor Lust auf ihn erbebten, auch der eine oder andere Mann. Als Mutter erfuhr, dass Ewald den Krieg überlebt hatte, verschwand ihr Flüchtlingsgesicht, doch nur für kurze Zeit. Bruno hingegen war tot. Das hatte Mutter in meiner Kindheit immer wieder gesagt: dass Stalingrad Brunos Grab geworden war.
Als ich klein war und in meinem Bett lag, dachte ich oft an Bruno. Mutter hatte die Nachttischlampe gelöscht, und die Schatten kamen. Doch bekam ich keine Angst, wenn ich an Bruno dachte. Obgleich es Gedanken waren, die ein Kind erschrecken müssten. Ich versetzte mich nach Stalingrad, zu Bruno, der, vom Himmel geschossen, im kalten russischen Schnee lag. Ich sah, wie Stalingrads Ratten kamen und ihn wärmten, sich weich an seinen gekrümmten Körper drückten, bis er nicht mehr zitterte, nur still dalag, vollkommen still und tot. Während die Augen der Ratten im Dunkeln wie kleine rote Lämpchen leuchteten.
Mutter hat gelogen. Bruno war nicht tot. Er war aus einem anderen Grund nicht aus dem Krieg heimgekehrt. Er hatte mit seiner Familie gebrochen. Wollte sie nie mehr wiedersehen. Nicht nach dem, was Großvater getan hatte. Warum hat Mutter gelogen? War die Wahrheit allzu schändlich? Oder war sie zu schmerzhaft?
Vielleicht hätte sie es erzählt, wenn ich bei ihr geblieben wäre. Ich war kaum erwachsen, als ich auf und davon bin. Weg von Mutter, die sagte, ich sei ihr Ein und Alles. Weg von Vater, der immer mehr zusammenschrumpfte, auf jede Weise. Weg von meinem Freund, dem Dozenten für slawische Sprachen, der wollte, dass ich sein Leben mit ihm teilte. Vor allem aber weg aus Deutschland. Ich wollte keine Deutsche sein. Ich wollte zu keinem Land gehören, das so Schreckliches verbrochen hatte. Als ich nach Stockholm kam, erst siebzehn Jahre alt, war ich voller Euphorie. Und frei.
Mutter hat es mir nie erzählt, nur dem Alois, obgleich die beiden sich seit vielen Jahren nicht gesehen hatten. Sie suchte nach ihm, als wäre er der Einzige, den sie noch hatte, um sich ihm anzuvertrauen. Ihm erzählte sie das Unfassbare, was geschehen war. Und dass sie all die Jahre nach Bruno gesucht hatte. Am Ende hatte sie herausgefunden, wo er sich befand: in Bukarest, als Pilot der rumänischen Fluggesellschaft TAROM. Sie hatte mehrere Briefe an seine Adresse gesandt, doch nie eine Antwort erhalten. Wäre sie noch bei Kräften, sagte sie zu Alois, würde sie hinfahren. Kurz nach ihrer Begegnung war sie gestorben, als der einsamste Mensch auf Erden.
Warum hatte sie Alois nicht Brunos Adresse gegeben? Und auch meine nicht, so als spielte ich in Mutters Leben keine Rolle mehr. Erst als eins meiner Bücher in Deutschland herausgekommen war, hatte mich Alois über meinen deutschen Verlag ausfindig gemacht. Er schrieb, er wolle mich treffen. Die Wahrheit über meine Familie gehöre mir. Sie sei Teil meines Erbes.
Ich vermied es, den Brief von TAROM anzusehen, obwohl er auf dem Schreibtisch lag. Vielleicht war es ja ein gutes Zeichen, dass sich die Antwort hinausgezögert hatte. Die Reaktion der rumänischen Botschaft war rasch erfolgt: Sie wollten mir gern helfen, benötigten jedoch die genauen Geburtsdaten von Bruno. Auch deutsche und polnische Archive wollten mehr wissen als nur Brunos Namen und eine vage Angabe zu seinem Alter. Doch in Mutters hinterlassenen Papieren stand nichts über Bruno. Und Alfred, Mutters jüngster Bruder, der Einzige ihrer Geschwister, der noch lebte, war schwer herzkrank und erinnerte sich an nichts.
Ich nahm den Brief zur Hand. Er wog nur wenig, obwohl er über alles entschied. Schon wollte ich ihn wieder weglegen. Aber würde es denn einfacher sein, ihn später zu öffnen? Ich riss das Kuvert auf und las. Las den Brief ein ums andere Mal. Die Buchstaben gerieten immer mehr ins Wanken. Doch stand es da, klar und deutlich: »We regret being unable to help you …«
Auf der Insel, 12. November 2014
Lech geht es besser, das Fieber hat ihn endlich aus seinen Fängen gelassen. Doch braucht er noch immer Sauerstoff. Und mit einer Sauerstoffmaske auf Nase und Mund lässt es sich nur schlecht reden. Also habe ich ihm ein Stück aus W. G. Sebalds Ringe des Saturn vorgelesen, die Geschichte vom Bauern Alec Garrard, der seit zwanzig Jahren an einem Modell des Jerusalemer Tempels baut und daran zweifelt, sein Vorhaben je beenden zu können. Denn die Archäologen kommen ständig mit neuen Erkenntnissen, Erkenntnisse, die man nicht außer Acht lassen darf, wenn man ein wahres Bild des Tempels schaffen will.
Der Erzähler, der Alec Garrard auf seinem Hof getroffen hat, ist schon im Begriff weiterzuwandern, als der Tempelbauer ihm anbietet, in seinem Wagen mitzufahren. Als er dann neben Garrard im Fahrerhaus sitzt, wünscht er, die kurze Fahrt möge nie ein Ende nehmen: »That we could go on and on, all the way to Jerusalem.«
Als ich den letzten Satz gelesen hatte, schaute ich zu Lech. Er war eingeschlafen. Ich wusste nicht, warum ich den Satz noch einmal laut wiederholte. Auch nicht, wer von uns es am meisten brauchte, dass ich meine Hand auf Lechs Hand legte.
Auf der Insel, 16. November 2014
Lech wurde heute entlassen oder, wie er es ausdrückte, freigelassen. Er bat mich, langsam zu fahren, damit er alles eingehend betrachten konnte, während seine Hand auf meinem rechten Knie lag. Als wir zu Hause angekommen waren, machte er eine Runde durch all unsere Zimmer. »Gut, dass es sie noch gibt«, sagte er.
»Das Beste ist, dass es dich gibt«, sagte ich.
»Dass es uns gibt«, sagte Lech und nahm mich in seine Arme.
Am Nachmittag unternahmen wir einen kurzen Spaziergang, ganz langsam, nur die Allee vor und zurück. Von einer der alten Linden hatte sich ein Stück Rinde gelöst und das nackte Holz war sichtbar geworden. Lech fragte, ob ich mich an die Nelly-Sachs-Ausstellung im Jüdischen Museum erinnerte. War mir das Rindenstück von einer Platane im Gedächtnis geblieben, das dort in einer Vitrine lag? Paul Celan hatte es Nelly Sachs geschickt, als sie krank wurde. Sie solle die Rinde zwischen Daumen und Zeigefinger halten, schrieb er, und gleichzeitig an etwas Schönes denken. War es aus dem Grund, weil die Platane, selbst wenn sie schutzlos ist, nicht eingeht? Sie verliert ihre Rinde im Winter, gerade dann, wenn die eisigen Winde an allem zerren und sie diese am meisten benötigt.
Ich erwiderte, dass ich mich auch an etwas anderes erinnerte. In einer weiteren Vitrine lag ein Konvulsator der Marke Siemens, einer der Art, mit dem Nelly Sachs mehr als ein Dutzend Elektroschockbehandlungen erhielt. Bekommt man Elektroschocks, sagte ich, wird man in Narkose versetzt und erhält ein Mittel zur Muskelentspannung. Sodass man, wenn der elektrische Strom durchs Gehirn gejagt wird und man einen epileptischen Anfall erleidet, nichts in seiner Hand halten kann, nicht einmal ein kleines Stück Platanenrinde. »Hauptsache, das Rindenstück lag noch auf ihrem Nachttisch«, sagte Lech, »wenn sie von der Behandlung zurückkam.«
Als wir zu unserem Haus zurückgingen, sagte Lech, es sei merkwürdig, dass Nelly Sachs am selben Tag starb, an dem Paul Celan in Paris beerdigt wurde. Als sei ihr kein anderer Ausweg geblieben, als es ihn nicht länger gab. Vor vielen Jahren hatte er selbst in Thiais an Celans Grab gestanden. Er hatte die kleinen Steine gesehen, die Menschen als eine Art Bitte um Schutz aufs Grab gelegt hatten. Auch er hatte einen kleinen schwarzen Stein hinzugefügt. »Vielleicht könnten wir hinfahren und nachsehen, ob er noch daliegt. Und auch ein Steinchen von unserer Insel mitnehmen. Irgendwann im Frühjahr. Wenn die Platanen in Paris ihre neue Rinde bekommen haben.«
Auf der Insel, 22. November 2014
Читать дальше