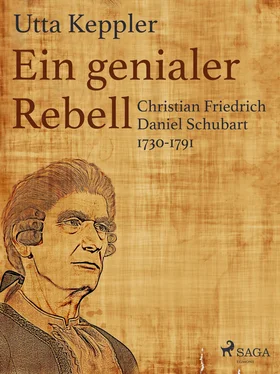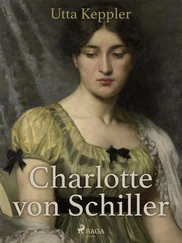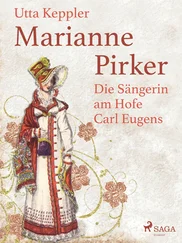„Ich hätte wohl Lust, den Casanova wahrhaftig aufzusuchen“, eröffnete Schubart dem Freund.
„Das wäre das Dümmste, was wir tun könnten.“
„Warum?“ Schubart fing an, im Zimmer herumzutänzeln und beobachtete heiter, wie draußen die Schneeflocken wirbelten. Der andere schob Holz in den Ofen, der dieses Jahr noch nicht geheizt worden war. Es qualmte erbärmlich. „Ja, Baste, das tun wir – oder willst mich allein lassen dabei?“
„Du hörst doch, was denen geschieht, die sich bei Hof mißliebig machen“, warnte Drollinger, „ich bin drauf angewiesen, hierorts eine Stelle zu finden, mindestens Schüler, kann doch nicht den Häschern ungut auffallen.“
„Den Shirren? Er redet sie venezianisch an, der Casanova! Du, das ist ein feiner Herr, gelehrt, hört man, und weiß sich dem jungen Herzog angenehm zu machen, nicht bloß den Damen.“ Er blinzelte sehnsüchtig.
„Tu, was du magst“, murrte Drollinger, „diesmal mußt allein gehen.“
Schubart nickte. „Schad’,“ sagte er unter der Tür und war gleich danach in seinem Gasthof, einem alten Haus in einer unbeleuchteten Gasse, durch die der schmelzende Schnee den Unrat schwemmte. Schubart zog sich um. Er fragte den Wirt nach dem Quartier des Seigneur de Saintgalt und der riß die Augen auf und tuschelte ihm zu, der edle Gast bewohne den „Güldenen Schwanen“, allwo er vier Zimmer gemietet habe. Schubart dankte und übersah die ausgestreckte schmierige Hand.
Im „Schwanen“ fand er den Gesuchten nicht. Man war verstört, man schwieg und druckste an einem Wort, man zuckte die Achseln, bis Schubart zornig rief: „Wenn Ihr’s nicht sogleich bekennet, wo er ist, schick ich die herzogliche Polizei nach ihm!“
„Die hat ihn schon!“ hieß es kleinlaut, „vor einer Stunde ist er geholt worden, wegen eines Händels mit den wirtenbergischen Offiziers, die mit ihm gekartelt haben gestern nacht.“
Schubart überlegte, während er die Gasse entlangpatschte. Es roch übel, nach schlechtem Fett und nach den Misthaufen vor den Zäunen. Aber er war nun einmal im Schwung, er mochte jetzt nicht mehr einhalten.
Nach einigem Befragen fand er das Gefängnis, stand eine Weile vor der Mauer mit den vergitterten Löchern, dann fing er im Dämmern an zu pfeifen. Es war ein Tanz, eine Tonfolge aus der Salierischen Oper, mit ein paar Trillern und Schleifen, die er dazu erfand. Drinnen regte sich nichts, außen schlurfte nur ein Bettelweib schielend vorbei.
Da ratterte ein Wagen heran, und Schubart drückte sich an die Mauer. Das Gerassel wurde lauter und hielt an. Aus dem Gefährt, das nur in Umrissen kenntlich war, glitt etwas Helles, ein wehender Schemen, während der Kutscher das Ledertreppchen zum Aussteigen entrollte. Duft streifte den Wartenden, es rauschte an ihm vorbei aufs Tor zu.
Jetzt wurde er neugierig und folgte dem Diener, der das Licht trug. Niemand fragte, es ging alles zu rasch. Am Tor schellte der Lakai. Der Wärter kam, prüfte unter der Lampe ein Schreiben, öffnete eine Tür. Schubart schlüpfte mit hinein. Das Hofpflaster war glitschig und uneben. Der Diener schaute ihn an und hob die Laterne.
„Ein Freund!“ tuschelte Schubart und bückte sich, um nicht erkannt zu werden. Die Dame drehte sich um. Schubart, in einer Eingebung, ergriff ihren Schal und tat, als habe er ihn eben noch vor dem Abgleiten in den Schmutz bewahrt. Er gab ihn mit einem Bückling zurück, erwischte die Rechte der Dame und küßte den Handschuh. Sie lachte und ließ ihn mit eintreten; drinnen stand ein Kommissar.
„Lady Thibaut of Sothcliff!“ stellte sich die Gestalt vor, die Schubart vergeblich näher zu betrachten suchte; ein rauchblauer Schleier verdeckte das Gesicht unter dem toupierten Haar, auf dem ein winziger Hut schwebte. Schubart drückte sich hinter dem breit wippenden Reifrock weiter, ein Wächter erschien schlüsselrasselnd und schaute erstaunt auf den Kommissar. „Sonderpermission Seiner Gnaden, des Grafen Montmartin!“ schnauzte der und ließ die Dame mit einem Bückling vorbei. Wieder ruckte der Wärter unsicher mit dem dicken Kopf, aber sie ergänzte ohne Zögern: „Mit zweien Bediensteten.“
Eine so vornehme Frau konnte unmöglich ohne Begleiter ein Gefängnis besuchen wollen, und die beiden Beamten zogen sich dienernd an die Wand zurück. Schubart hatte sofort die zuversichtlich-devote Haltung angenommen, die seiner Rolle zustand, und der Lakai, das flackernde Lämpchen erhoben, ging wortlos voraus. Der Gang zog sich hin, ein feuchtes Gewölbe mit vielen Türen, hinter denen man die Gefangenen vermutete. Dann wurde die Decke höher, die Mauern glatter, die Umrisse einer Tür erschienen als schwaches Viereck. Der Kommissar nahm dem Diener die Lampe ab, ließ sich den Schlüssel reichen und öffnete. Helligkeit brach in das dunkle Gelaß, in der Ecke schwang sich ein Mann vom Lager und warf einen Umhang über: Casanova. Im ungewissen Schein erkannte Schubart ein weiches Profil mit angebogener knapper Nase, große Augen, dunkle dichte Brauen; das Haar hing zerzaust um die schmalen Wangen und das schwache Kinn – ein romanisches Gesicht ohne bedeutende Linie – dachte er schnell, als schon die Lady, ungeachtet ihrer Zuschauer, auf den Erschrockenen zuflog und – „Giacomo!“ – ihm am Hals lag. Kommissar und Wärter wandten sich in den Gang zurück und die beiden Begleiter blieben stehen wie Holzklötze.
Casanova faßte sich und schob die Dame sanft von sich ab. „Wie hast du das fertiggebracht, du Hexe?“ fragte er italienisch, was Schubart einigermaßen verstand. Sie sprudelte vergnügt und unaufhörlich, halb deutsch, halb italienisch, eine phantasievolle Erklärung; dann fragte sie flüsternd: „Wie bringen wir dich hinaus?“
„Mylady!“ rief Casanova lachend – er schien seine Haft trotz gräßlicher Drohungen seiner Wärter nicht ernst zu nehmen – „Mylady!“
„Du weißt ganz gut, wer ich bin!“ sagte sie und schlug endlich das Schleierchen zurück, freilich so, daß Schubart ihr Gesicht nicht sah.
„Jetterin, du freches Geschöpf!“ kam es jetzt deutsch und deutlich aus dem Mund des Kavaliers. „Hinauskommen? Nicht ganz leicht, zumal mir hier weder ein dummer Mönch noch ein steiler Dachfirst dienen wird, wie zu Venedig in den Bleikammern.“
Schubart, mit seiner ganzen jungenhaften Abenteuerlust, rief dazwischen: „Aber ich getrau mir, die Wächter abzulenken und Sie zu decken, Mylady und Seigneur!“
„Parbleu, der ladrone redet italienisch!“
„Soltanto un poco!“ wagte Schubart schüchtern, „aber…“
Da war schon der Wächter wieder da, pochte und rasselte, vermeldend, es sei nicht länger statthaft, mit dem Delinquenten zu „karessieren“. Er sagte wirklich so, und Schubart lachte laut, was einem Bedienten kaum angestanden hätte. Aber die Dame winkte gnädig und überreichte mit einem charmanten Lächeln dem Delinquenten ein umfängliches Paket, das sie unter dem Reifrock hervorzog. Dann entfernte sie sich mit Händewedeln und Nicken. Schubart, der als letzter ging, drehte sich um. „Sono sempre al Suo servizio!“ frief er kühn, selber nicht ganz überzeugt von seinen Sprachkenntnissen. Aber – „Mille grazie, amico!“ respondierte der Kavalier und lächelte entzückt. Er war ja auch wirklich in einer Lage, in der man einen dienstbereiten Freund brauchen konnte.
Draußen wandelte sich die Lady in ein kicherndes, ziemlich alltägliches Geschöpf, das Schubart schöne Augen machte. Immerhin hatte es ihr imponiert, daß der junge Mensch die Sprache des berühmten Reisenden beherrschte, wie sie meinte. Und Schubart nahm sich vor, den Faden, der ihn vielleicht schon beim Beginn seiner studentischen Laufbahn an ein Abenteuer knüpfte, nicht so schnell loszulassen.
Die Gelegenheit, ihn weiterzuspinnen, kam bald genug. Schubart, den Freund Baste verlassen hatte, war schon entschlossen, endlich weiterzureisen, als ihn der Diener der Jetterin aufsuchte. Er habe einen Brief im Sack, flüsterte er in derbem Schwäbisch, von der Madame Lady, und er, Schubart, solle ihn gleich lesen, da ja „der andere“ nimmer da sei, wie man erfahre. Das Geschreibe war ziemlich fehlerhaft, die Schrift holprig. Aber der Inhalt elektrisierte ihn: Er möge sich bereithalten, da er der einzig denkbare Helfer sei, sein Versprechen betreffend die bewußte notleidende Person wahrzumachen, und zu diesem Zweck des Abends um halber neune im Schloßpark am Lusthaus hinten warten.
Читать дальше